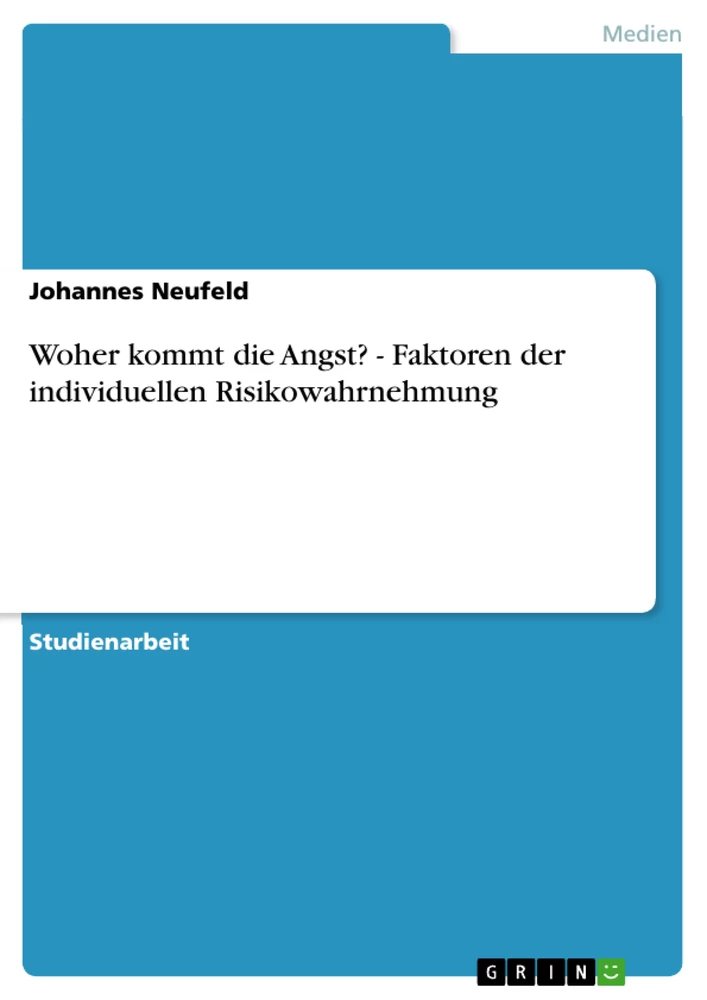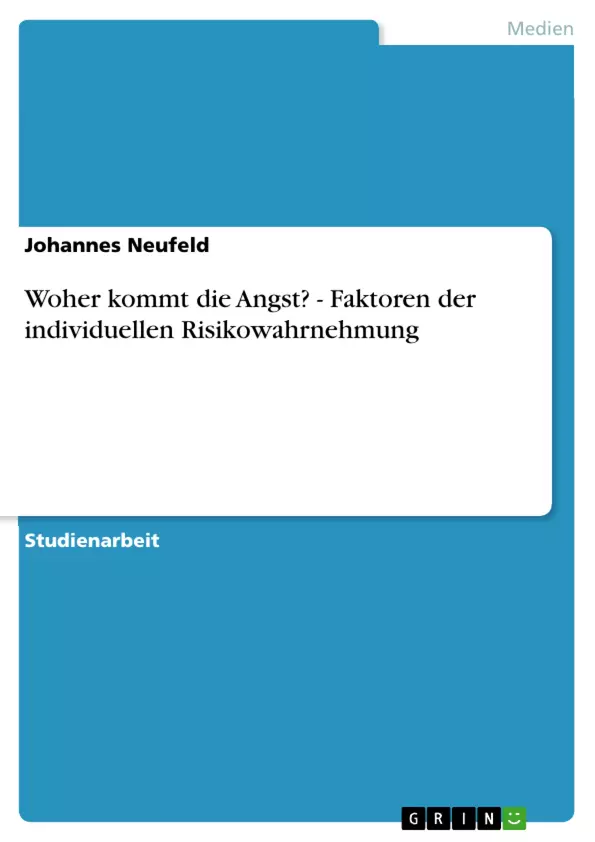Unter der Schlagzeile „Die große deutsche Angst“ berichtet die Süddeutsche Zeitung vom 27.07.2005 über eine aktuelle Studie des Marktforschungsinstituts GfK (vgl. Bovensiepen 2005). Die Studie behandelt die Angst der Deutschen vor Arbeitslosigkeit. Demnach emp-finden 81 Prozent der Bevölkerung die Arbeitslosigkeit als gravierendes Problem. Das Bei-spiel zeigt: Angst ist als ständiger Begleiter des Menschen präsent, und zwar nicht nur, wenn es um den eigenen Arbeitsplatz geht. Ob Krankheiten, Unfälle, Naturkatastrophen: Der Mensch hat mehr oder weniger viel Angst vor allerlei Ereignissen, die möglicherweise Wirklichkeit werden. Angst ist mitunter der größte Geschäftspartner von Versicherungen, die ihr Geld schließlich damit verdienen, durch finanzielle Absicherung von Hausrat, Haftpflicht oder Unfall die Angst ihrer Kunden zu mindern.
Dennoch muss die Frage erlaubt sein, ob es in der Realität tatsächlich der Fall ist, dass die meisten Menschen angsterfüllt ihren Alltag bestreiten und froh sind, wenn ihre Ängste Fiktion bleiben. Hier kann man die Überlegung heranziehen, dass ein Mensch gar nicht überlebensfähig sein kann, wenn er ständig in Angst lebt. Es scheint also so zu sein, dass Risiken nur selektiv und damit äußerst unterschiedlich wahrgenommen werden. Diese An-nahme zieht die Frage nach sich, von welchen Faktoren die individuelle Risikowahrneh-mung abhängt.
In der vorliegenden Arbeit werden daher anhand von Daten aus einer im Jahr 2004 durch-geführten Umfrage mögliche Zusammenhänge aufgezeigt, inwieweit unterschiedliche Le-bensbereiche von der Risikowahrnehmung betroffen sind. Zunächst folgt daher eine Vor-stellung der Umfrage anhand der darin für diese Arbeit enthaltenen relevanten Themen und der angewandten Methode. Anschließend wird anhand von Schaubildern, Tabellen und Beschreibungen veranschaulicht, wie die Risikoeinschätzung allgemein aussieht, bevor sie im Zusammenhang mit weiteren Faktoren wie dem Geschlecht, Alter oder einem sportlich aktiven Lebensstil genauer untersucht wird. Auch die Frage, ob ein Risiko anders einge-schätzt wird, wenn man es schon einmal selbst oder im engeren persönlichen Umfeld erlebt hat, wird hier behandelt. Den Schluss der Ausführungen bildet eine Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Beschreibung der Datenbasis
- Datenanalyse
- Erlebte Schicksalsschläge
- Allgemeine Risikoeinschätzung
- Der Zusammenhang zwischen Risikoeinschätzung und persönlicher Betroffenheit
- Der Zusammenhang zwischen Risikoeinschätzung und Geschlecht
- Der Zusammenhang zwischen Risikoeinschätzung und Lebenserfahrung
- Der Zusammenhang zwischen Risikoeinschätzung und aktivem Lebensstil
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Risikowahrnehmung der Bevölkerung von Mainz anhand einer im Jahr 2004 durchgeführten Telefonbefragung. Ziel ist es, die Faktoren zu identifizieren, die die individuelle Risikowahrnehmung beeinflussen. Dabei wird untersucht, wie verschiedene Lebensbereiche die Risikoeinschätzung beeinflussen.
- Einfluss von erlebten Schicksalsschlägen auf die Risikoeinschätzung
- Zusammenhang zwischen Risikoeinschätzung und soziodemografischen Merkmalen (Geschlecht, Alter)
- Bedeutung des aktiven Lebensstils für die Risikoeinschätzung
- Analyse der allgemeinen Risikoeinschätzung der Mainzer Bevölkerung
- Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Risikoeinschätzung und persönlicher Betroffenheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der Risikowahrnehmung anhand von Beispielen aus der Medienberichterstattung und dem gesellschaftlichen Alltag dar. Sie skizziert die Forschungsfrage und die Vorgehensweise der Arbeit.
Kapitel 2 beschreibt die Datenbasis der Studie. Es werden die Methode der Telefonbefragung, die Stichprobengröße und die wesentlichen Inhalte der Befragung vorgestellt. Zudem werden die Besonderheiten der Stichprobe und ihre Auswirkungen auf die Repräsentativität der Ergebnisse erläutert.
Kapitel 3 widmet sich der Datenanalyse. Es werden die Ergebnisse der Befragung in Bezug auf die Risikowahrnehmung der Mainzer Bevölkerung dargestellt und analysiert. Die Analyse untersucht den Einfluss von Faktoren wie erlebten Schicksalsschlägen, Geschlecht, Alter und aktivem Lebensstil auf die Risikoeinschätzung.
Schlüsselwörter
Risikowahrnehmung, empirische Studie, Telefonbefragung, Mainzer Bevölkerung, soziodemografische Merkmale, Geschlecht, Alter, aktiver Lebensstil, Schicksalsschläge, Lebensqualität, Gesundheit, Mediennutzung, politische Orientierung
Häufig gestellte Fragen
Von welchen Faktoren hängt die individuelle Risikowahrnehmung ab?
Die Wahrnehmung wird durch soziodemografische Merkmale wie Alter und Geschlecht, den persönlichen Lebensstil sowie bereits erlebte Schicksalsschläge beeinflusst.
Wie unterscheidet sich die Risikoeinschätzung zwischen Männern und Frauen?
Studien zeigen oft, dass Frauen bestimmte Risiken (z.B. Krankheiten oder Umweltgefahren) tendenziell höher einschätzen als Männer, was auf unterschiedliche Sozialisation zurückgeführt wird.
Hat persönliche Betroffenheit einen Einfluss auf die Angst vor Risiken?
Ja, wer bereits selbst oder im engen Umfeld einen Schicksalsschlag (z.B. Unfall oder Krankheit) erlebt hat, nimmt das entsprechende Risiko in der Regel bewusster und oft auch als bedrohlicher wahr.
Welchen Einfluss hat ein sportlich aktiver Lebensstil?
Menschen mit einem aktiven Lebensstil schätzen gesundheitliche Risiken oft geringer ein, da sie ein höheres Vertrauen in ihre eigene körperliche Belastbarkeit und Kontrolle haben.
Warum nehmen wir Risiken nur selektiv wahr?
Da ein Mensch nicht überlebensfähig wäre, wenn er ständig vor allem Angst hätte, filtert die Psyche Risiken nach Relevanz und persönlicher Erfahrung aus.
- Arbeit zitieren
- Johannes Neufeld (Autor:in), 2005, Woher kommt die Angst? - Faktoren der individuellen Risikowahrnehmung , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52551