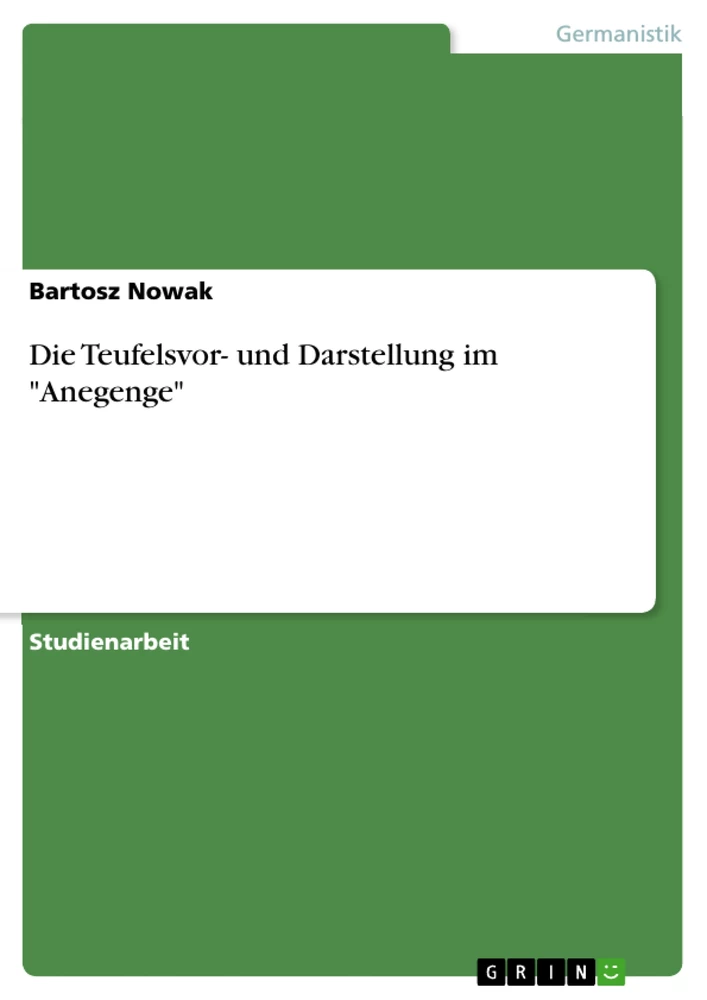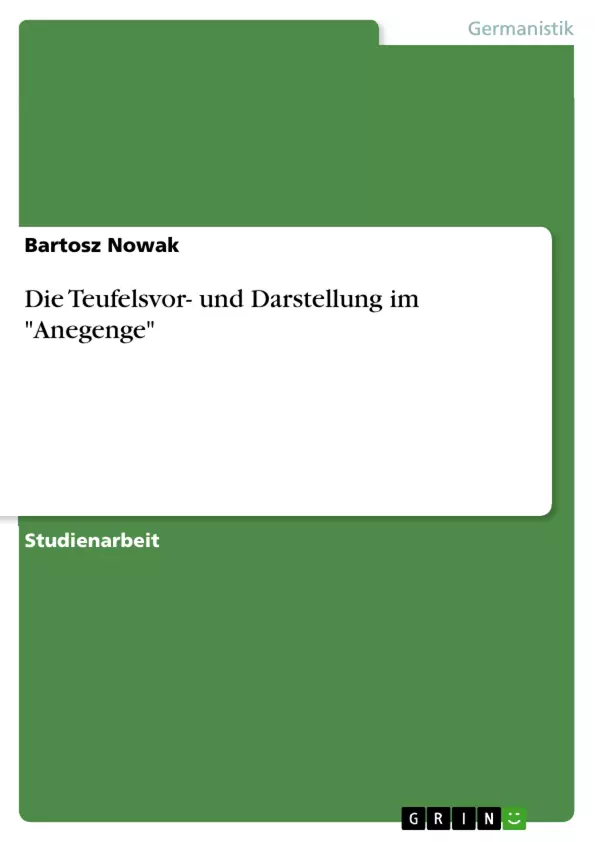Das Anegenge ist wahrscheinlich im letzten Drittel des 12. Jahrhunderts im österreichischen Raum entstanden. Es wird in die Zeit zwischen 1160 und 1170 datiert. In der heutigen Zeit existiert nur eine einzige Überlieferung des Werkes, welche wohl am Anfang des 14. Jahrhunderts in einer Wiener Handschrift verfasst wurde. Bei dem Werk handelt es sich vermutlich um eines der ersten Lehrgedichte dieser Zeitperiode. Ehrismann urteilt über die besondere Stellung dieses Werkes in der Literatur des 11. – 12. Jahrhunderts, „dass es in umfassender Weise und mit scholastischer Methode den Glaubensinhalt auseinandersetzen will, wodurch es mehr als irgend eine andere Dichtung dieser Zeit einen theologischen Charakter trägt“. (Ehrismann, Gustav: Geschichte der deutschen Literatur bis zum Ausgang des Mittelalters. München 1922)
An markanten Stellen des Gedichtes wird hier der Aspekt der Teufelsvor- und -darstellung im Mittelalter untersucht. Von der Schöpfungsgeschichte und dem Fall der Engel über den Sündenfall bis zur Erlösung spielt der Teufel eine herausragende Rolle.
Um die Grundlage der Teufelsdarstellung im Anegenge zu prüfen, soll der Lehrgehalt des Gedichts einbezogen werden, sowie der Vergleich mit anderen biblischen Texten anstrebt werden. Der theologische Gehalt wird auf die Abgrenzung der teuflischen Mächte zum göttlichen Licht, aber auch auf ihre gegenseitige Abhängigkeit untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung - Formales zum Werk und Dichter
- Der Prolog
- Die Schöpfungsgeschichte und der Fall der Engel
- Der Sündenfall
- Die Erlösung
- Die Bibel und das Anegenge
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das mittelalterliche Lehrgedicht „Anegenge“ und untersucht die Darstellung des Teufels im Kontext der christlichen Heilsgeschichte. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, wie der Dichter den Teufel als Gegenspieler Gottes darstellt und welche Rolle er im Hinblick auf die Schöpfung, den Sündenfall und die Erlösung spielt.
- Die Teufelsdarstellung im „Anegenge“
- Die Rolle des Teufels in der Schöpfungsgeschichte
- Der Teufel als Vermittler des Sündenfalls
- Der Einfluss biblischer Texte auf die Teufelsdarstellung
- Die Bedeutung des Teufels in der Heilsgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung - Formales zum Werk und Dichter: Diese Einleitung bietet einen Überblick über das „Anegenge“, seinen Entstehungskontext und den Autor. Es wird hervorgehoben, dass das Werk eines der ersten Lehrgedichte seiner Zeit ist, welches schwierige theologische Fragen in deutscher Sprache behandelt.
- Der Prolog: Der Prolog des Gedichtes beschreibt die Schöpfung und die Rolle Gottes in der Welt. Der Dichter richtet eine Warnung an die Laien, sich vor der Sünde zu hüten und das Gedicht nicht zu lesen, da es nicht für sie bestimmt ist. Der Dichter selbst präsentiert sich als überlegener „litteratus“ und Theologe, der die kompliziertesten Gedanken verstehen kann.
- Die Schöpfungsgeschichte und der Fall der Engel: Dieser Abschnitt widmet sich der Erschaffung der Engel und dem Fall des Teufels. Die Engel werden als freie Wesen geschaffen, die Gott zwar lieben sollen, aber dazu nicht gezwungen werden. Der Fall des Teufels wird auf seine Hochmütigkeit zurückgeführt, die ihn aus dem Himmelreich verstößt.
Schlüsselwörter
Das „Anegenge“, Teufelsdarstellung, Heilsgeschichte, Schöpfungsgeschichte, Sündenfall, Engel, Hochmut, Bibel, Mittelalterliche Literatur, Lehrgedicht, Theologie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das "Anegenge"?
Das Anegenge ist eines der ersten frühmittelhochdeutschen Lehrgedichte (ca. 1160-1170), das theologische Inhalte wie die Schöpfung und den Sündenfall behandelt.
Wie wird der Teufel im Werk dargestellt?
Der Teufel wird als gefallener Engel dargestellt, dessen Sturz durch seinen Hochmut (superbia) gegenüber Gott verursacht wurde.
Welche Rolle spielt der Sündenfall?
Der Teufel agiert als Verführer, der den Menschen zum Ungehorsam gegen Gott bringt, was die gesamte Heilsgeschichte in Gang setzt.
Was ist das Besondere am theologischen Gehalt des Gedichts?
Es nutzt eine scholastische Methode, um komplexe Glaubensinhalte in deutscher Sprache für ein Laienpublikum (mit Warnungen des Autors) zu erklären.
Wie wird das Verhältnis zwischen Licht und Finsternis beschrieben?
Die Arbeit untersucht die Abgrenzung der teuflischen Mächte vom göttlichen Licht, aber auch ihre paradoxe gegenseitige Abhängigkeit im Heilsplan.
- Arbeit zitieren
- Bartosz Nowak (Autor:in), 2001, Die Teufelsvor- und Darstellung im "Anegenge", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52746