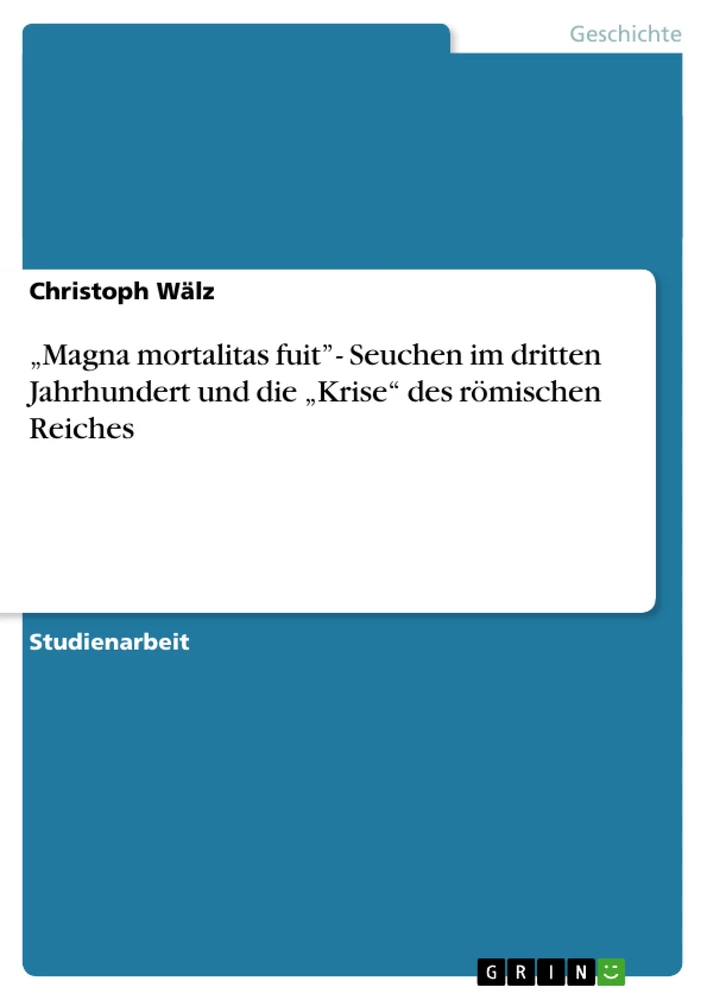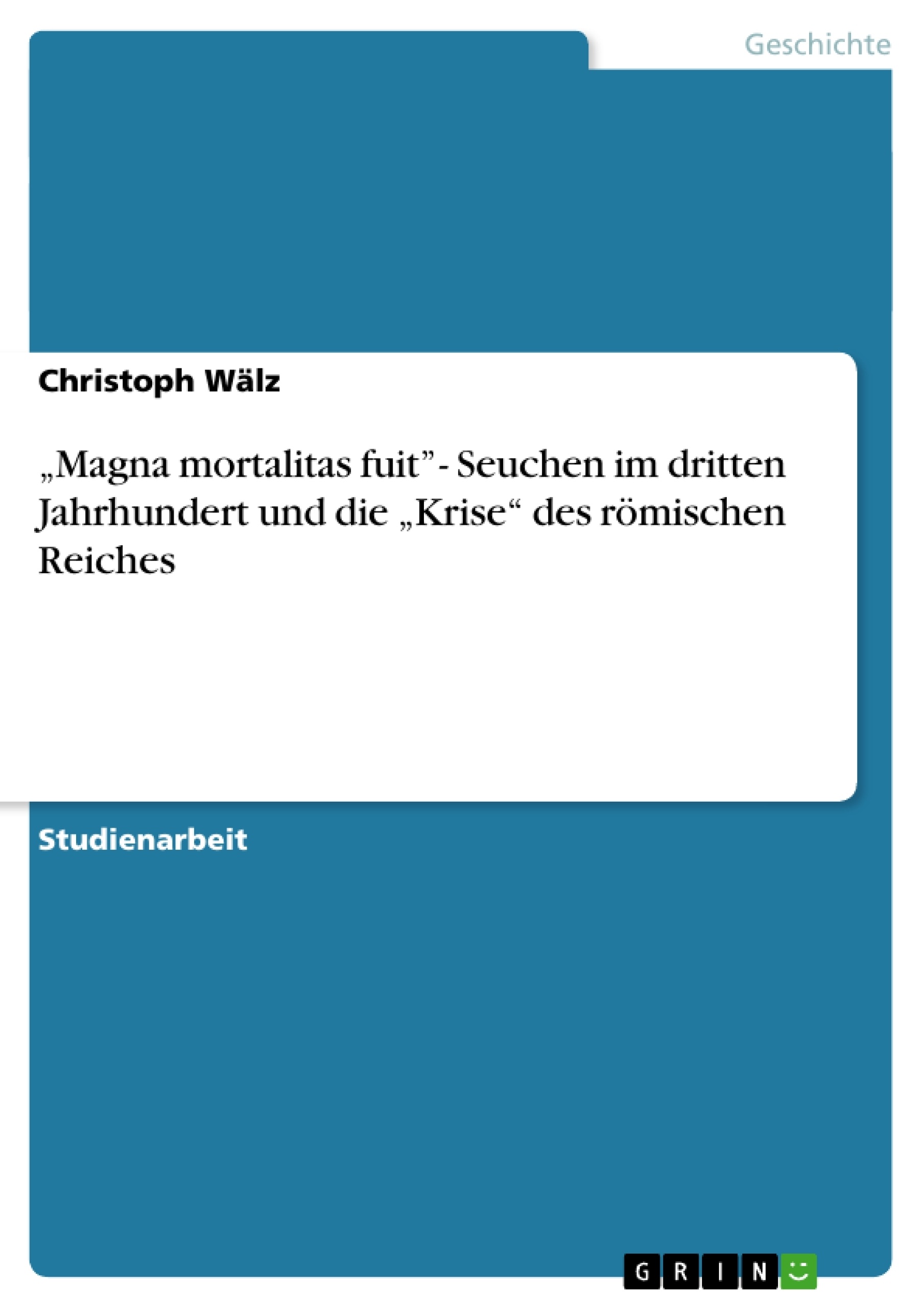Im 3. Jahrhundert kam es zu mehreren Seuchenwellen in Alexandria, Carthago und anderen Orten. Diese Seuchen wurden von der Forschung lange als eines von diversen Phänomenen einer Globalkrise der Römischen Reichs angesehen. Eng verbunden damit ist die Diskussion um Ursachen für den Untergang des Reichs.
Neben den Seuchen kam es zu wirtschaftlichen Krisen, zu gewaltsamen und schnellen Thronwechseln, zu zahlreichen „Barbaren“-Einfällen, unsicheren Grenzen und anderen „Krisen“-Phänomenen. Die Interpretation einer umfassenden Krise wird von der neueren Forschung jedoch zunehmend hinterfragt (Vgl. v.a. Witschel 1999).
In dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, was den vorhandenen Quellen tatsächlich an brauchbaren Informationen entnommen werden kann. Es soll abgewogen werden, welche Schlussfolgerungen daraus für das Ausmaß und die demographischen Auswirkungen der Seuchen möglich sind. Des weiteren stellt sich die Frage, ob die Seuchen subjektiv als Krisenphänomen wahrgenommen wurden.
Das Fehlen statistischer Daten zwingt dazu, sich vor allem an literarischen Quellen zu orientieren, also an Briefen, Chroniken usw., in denen allein direkte Aussagen zu Seuchen zu finden sind. Die überlieferten zeitgenössischen Quellen (Dionysius, Cyprian) sowie spätere, historiographische Zeugnisse der Antike (Zosimus, Orosius, Historia Augusta, Eutropius, Zonaras) werden kritisch untersucht.
Des weiteren werden die verschiedenen Versuche der Forschung, aus anderen Quellen indirekte Hinweise zu Seuchen und demographischen Entwicklungen des 3. Jahrhunderts herauszulesen, vorgestellt und eingeschätzt. Wierschowski (1994), Duncan-Jones (1996), Haberman (1998). Die grundsätzliche Möglichkeit, demographische Aussagen für die Antike zu machen, wurde u.a. von Boak (1955), Finley (1958), Wierschowski (1994) und Witschel (1999) diskutiert. Die Diskussion wird hier zusammengefasst und auf die Frage von Seuchen bezogen.
Es wird ein abgewogenes Fazit auf der Grundlage von Quellen und Forschungslage gezogen. Antike Quellen vermitteln zunächst ein ausschnittartiges Bild von einem individuellen Beobachterstandpunkt. Ihre objektive Aussagekraft gilt es einzuschätzen. Bei allen Problemen, das Ausmaß der Seuchen zu erfassen, ist es bemerkenswert, dass sie sich wie ein roter Faden durch die Geschichtsschreibung der nächsten Jahrhunderte zieht. Ihre Wirkung auf das kollektive Bewusstsein der Spätantike scheint gegeben. Dennoch ist die Kritik gegenüber globalen Krisenmodellen zu betonen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Quellen
- Literarische Quellen
- Zeitgenössische Überreste
- Dionysius
- Cyprian
- Spätere, historiographische Zeugnisse
- Zosimus
- Orosius
- Historia Augusta
- Eutropius
- Zonaras
- Fazit der Quellenanalyse
- Zeitgenössische Überreste
- Indirekte Hinweise auf Bevölkerungsrückgänge
- Literarische Quellen
- Antike und Demographie
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit den Seuchen im 3. Jahrhundert und deren Bedeutung für die “Krise” des römischen Reiches. Ziel ist es, die Quellenlage kritisch zu beleuchten, das Ausmaß der Seuchen anhand von literarischen Quellen und indirekten Hinweisen zu beurteilen sowie die subjektive Wahrnehmung dieser Seuchen als Krisenphänomen zu analysieren. Dabei wird die Arbeit insbesondere auf die Kritik von Witschel an der gängigen Krisentheorie des 3. Jahrhunderts zurückgreifen.
- Kritische Analyse der Quellenlage zum Thema Seuchen im 3. Jahrhundert
- Bewertung des Ausmaßes der Seuchen und ihrer demographischen Auswirkungen
- Die subjektive Wahrnehmung von Seuchen als Krisenphänomen
- Die Rolle von Seuchen im Kontext der “Krise” des römischen Reiches
- Differenzierte Betrachtung des 3. Jahrhunderts unter Berücksichtigung unterschiedlicher Forschungsperspektiven
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Bedeutung von Seuchen im 3. Jahrhundert und deren Rolle in der Debatte um die “Krise” des römischen Reiches dar. Sie führt in die Thematik ein und skizziert den Forschungsstand sowie die methodischen Ansätze dieser Arbeit.
- Quellen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Analyse der literarischen Quellen zur Thematik. Es werden sowohl zeitgenössische Überreste als auch spätere, historiographische Zeugnisse vorgestellt und kritisch untersucht. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Frage der subjektiven Krisenwahrnehmung und der Bedeutung von Quellenkritik.
- Antike und Demographie: Dieses Kapitel untersucht die Möglichkeiten und Grenzen der demographischen Aussagen für die Antike, insbesondere im Hinblick auf das Ausmaß der Seuchen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe dieser Arbeit sind Seuchen, Krise, 3. Jahrhundert, Römisches Reich, Quellenkritik, Historiographie, Demographie, subjektive Wahrnehmung, Witschel.
Häufig gestellte Fragen zu Seuchen im römischen Reich
Welche Seuchen suchten das römische Reich im 3. Jahrhundert heim?
Es kam zu mehreren Wellen, bekannt ist vor allem die "Cyprianische Pest", die weite Teile des Reiches, darunter Alexandria und Karthago, betraf.
Waren die Seuchen die Hauptursache für die "Krise" des Reiches?
Die moderne Forschung sieht sie als einen von vielen Faktoren; wirtschaftliche Krisen, Barbareneinfälle und instabile Thronfolgen spielten ebenfalls eine große Rolle.
Wie glaubwürdig sind die literarischen Quellen dieser Zeit?
Quellen von Zeitgenossen wie Dionysius oder Cyprian sind oft subjektiv und theologisch geprägt; sie müssen kritisch auf ihre objektive Aussagekraft geprüft werden.
Gab es im 3. Jahrhundert einen massiven Bevölkerungsrückgang?
Statistische Daten fehlen, aber indirekte Hinweise in der Historiographie deuten darauf hin, dass die Seuchen einen spürbaren demographischen Einfluss hatten.
Was kritisiert die neuere Forschung an globalen Krisenmodellen?
Historiker wie Witschel betonen, dass viele Regionen des Reiches trotz der Krisen stabil blieben und die Wahrnehmung einer "Globalkrise" oft übertrieben ist.
- Arbeit zitieren
- Christoph Wälz (Autor:in), 2004, „Magna mortalitas fuit” - Seuchen im dritten Jahrhundert und die „Krise“ des römischen Reiches, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52894