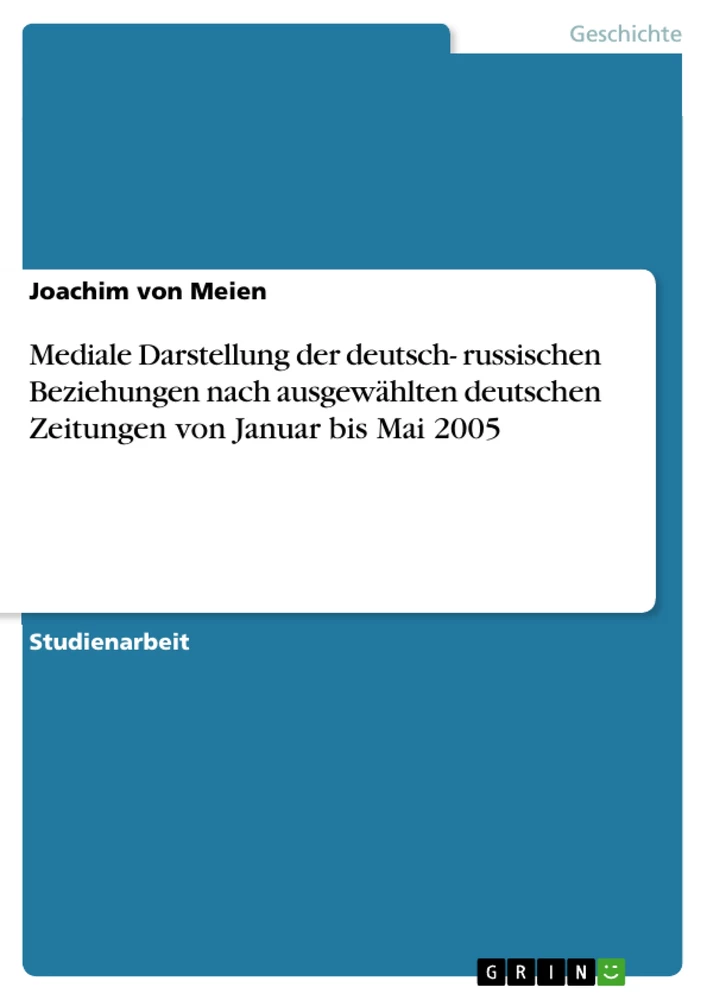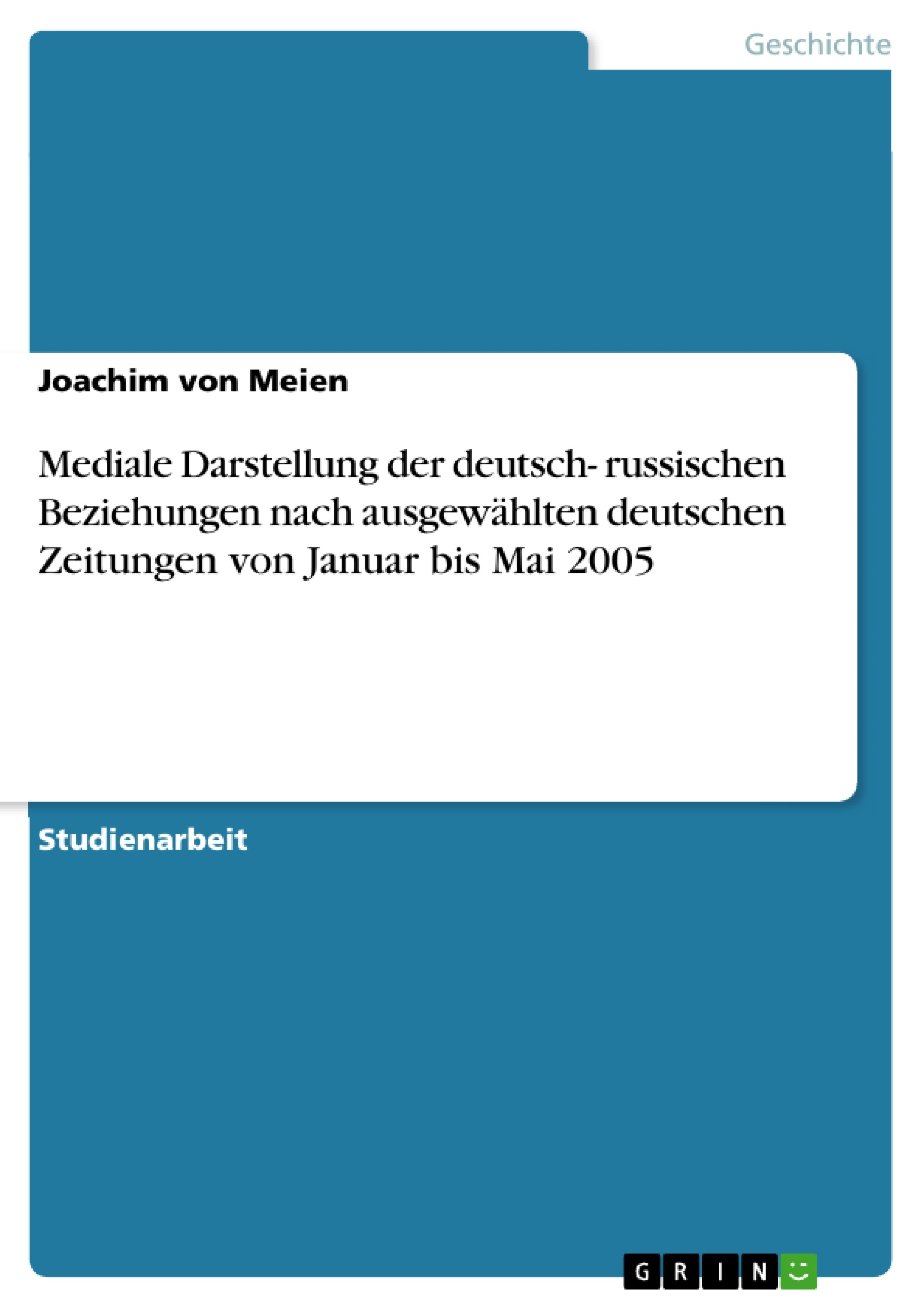Bevor auf das eigentliche Thema dieser Hausarbeit, der Untersuchung der medialen Darstellung der deutsch-russischen Beziehungen eingegangen wird, scheint es angebracht, zunächst folgendes Phänomen näher zu beleuchten: Bei vielen Gelegenheiten hört man heutzutage wieder und wieder, man lebe in einer Mediengesellschaft. Gerhard Schröder etwa wurde als Medienkanzler bezeichnet, weil er den Umgang mit Fernsehen, Hörfunk und Presse meisterhaft beherrschte. Auch noch so renitente Politiker und andere Personen des öffentlichen Lebens beginnen zu erkennen, dass ihre Arbeit ohne Medien nicht mehr funktioniert – ein Merkmal der Mediengesellschaft? Doch was ist es, dass die heutige Gesellschaft in Bezug auf Medien charakterisiert? Eine Antwort auf diese Frage ist natürlich zu komplex, um sie an dieser Stelle in einem kurzen, einleitenden Kapitel abzuhandeln. Dennoch soll versucht werden, auf Probleme hinzuweisen, Denkanstöße zu geben und die ein oder andere These zu wagen. [...] Die Frage ist nun, in wie weit die Ereignisse in der Ukraine für die deutsch-russischen Beziehungen zu Beginn des folgenden Jahres von der ausgewählten Presse immer noch als belastend gesehen werden, oder welche anderen Faktoren als fördernd oder hemmend für die Beziehungen dargestellt werden. Ganz konkret wird dabei neben den Ereignissen in der Ukraine noch auf die Sicht der Presse zum Zustand der Demokratie in Russland und zu der persönlichen Beziehung zwischen Bundeskanzler Gerhard Schröder und Präsident Wladimir Putin eingegangen. Es ist wichtig, folgendes immer im Hinterkopf zu haben: Es geht in dieser Arbeit nicht um die deutsch-russischen Beziehungen, wie sie in besagtem Zeitraum de facto waren, sondern um deren Perzeption und Darstellung durch die Presse. Kapitel 2 dieser Arbeit wird diese wichtige Unterscheidung genauer erläutern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gedanken und Anmerkungen zu Medien als Informationsvermittlern
- Die deutsch-russischen Beziehungen in medialer Darstellung
- Demokratie in Russland?
- Deutsch-russische Beziehung als Schröder-Putin Freundschaft
- Die Rolle der „Orangenen Revolution“ in der Ukraine
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die mediale Darstellung der deutsch-russischen Beziehungen in ausgewählten deutschen Zeitungen von Januar bis Mai 2005. Dabei werden die Rolle der Medien als Informationsvermittler sowie die Darstellung der deutsch-russischen Beziehungen im Kontext der „Orangenen Revolution“ in der Ukraine beleuchtet.
- Rolle der Medien als Informationsvermittler in der Wissensgesellschaft
- Darstellung der deutsch-russischen Beziehungen in ausgewählten Zeitungen
- Einfluss der „Orangenen Revolution“ auf die deutsch-russischen Beziehungen
- Analyse der Medienberichterstattung über die Demokratie in Russland
- Bewertung der Beziehung zwischen Gerhard Schröder und Wladimir Putin
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung skizziert die Bedeutung der Medien in der heutigen Gesellschaft und stellt die Relevanz der medialen Darstellung von politischen Beziehungen dar.
Gedanken und Anmerkungen zu Medien als Informationsvermittlern
Dieses Kapitel befasst sich mit der Rolle der Medien als Informationsvermittler in der Wissensgesellschaft. Es analysiert die Entwicklung der Massenkommunikation und die Auswirkungen auf die öffentliche Meinung.
Die deutsch-russischen Beziehungen in medialer Darstellung
Dieses Kapitel untersucht die mediale Darstellung der deutsch-russischen Beziehungen in ausgewählten deutschen Zeitungen. Es betrachtet die Themen der Demokratie in Russland, der Beziehung zwischen Gerhard Schröder und Wladimir Putin sowie die Rolle der „Orangenen Revolution“ in der Ukraine.
Schlüsselwörter
Medien, Informationsvermittler, Massenkommunikation, öffentliche Meinung, deutsch-russische Beziehungen, „Orangene Revolution“, Ukraine, Demokratie, Russland, Gerhard Schröder, Wladimir Putin.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Zeitraum umfasst die Medienanalyse dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Berichterstattung in ausgewählten deutschen Zeitungen von Januar bis Mai 2005.
Welche Rolle spielte die „Orangene Revolution“ in der Ukraine in der Presse?
Die Ereignisse in der Ukraine wurden von der Presse als belastender Faktor für die deutsch-russischen Beziehungen wahrgenommen und dargestellt.
Wie wurde die Beziehung zwischen Schröder und Putin medial charakterisiert?
Die Berichterstattung fokussierte stark auf die persönliche Männerfreundschaft zwischen Bundeskanzler Gerhard Schröder und Präsident Wladimir Putin.
Was kritisierten die Zeitungen am Zustand der Demokratie in Russland?
Die Presse thematisierte kritisch die Entwicklung der demokratischen Strukturen und die Machtkonzentration unter Putin.
Was versteht der Autor unter einer „Mediengesellschaft“?
Es beschreibt eine Gesellschaft, in der Politik ohne den meisterhaften Umgang mit Fernsehen, Hörfunk und Presse nicht mehr funktioniert.
- Quote paper
- Joachim von Meien (Author), 2006, Mediale Darstellung der deutsch- russischen Beziehungen nach ausgewählten deutschen Zeitungen von Januar bis Mai 2005, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/53029