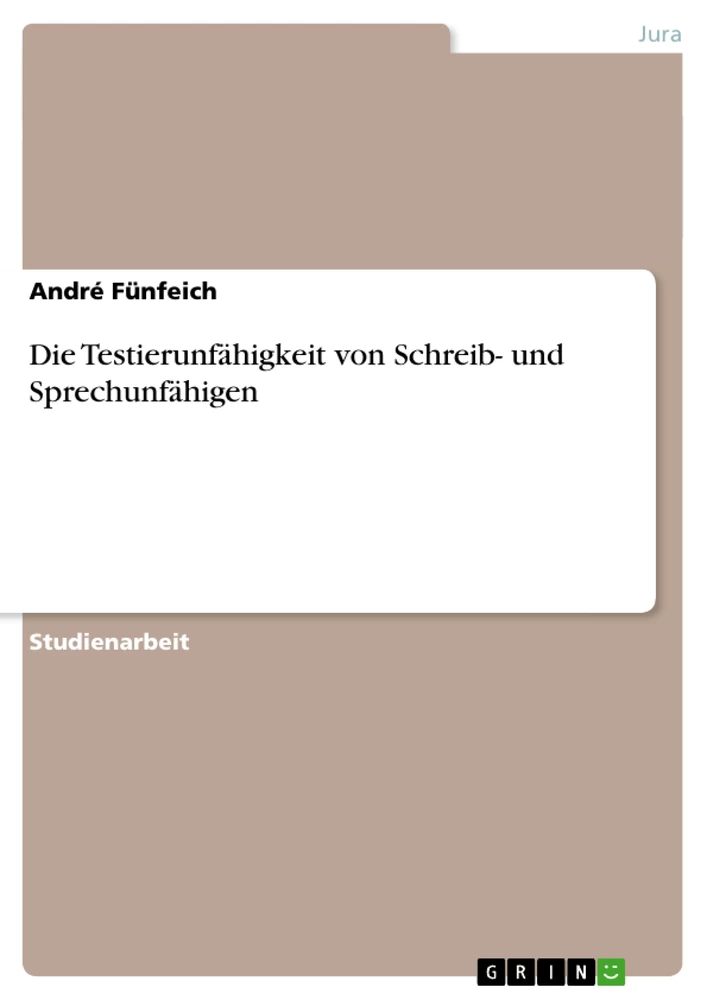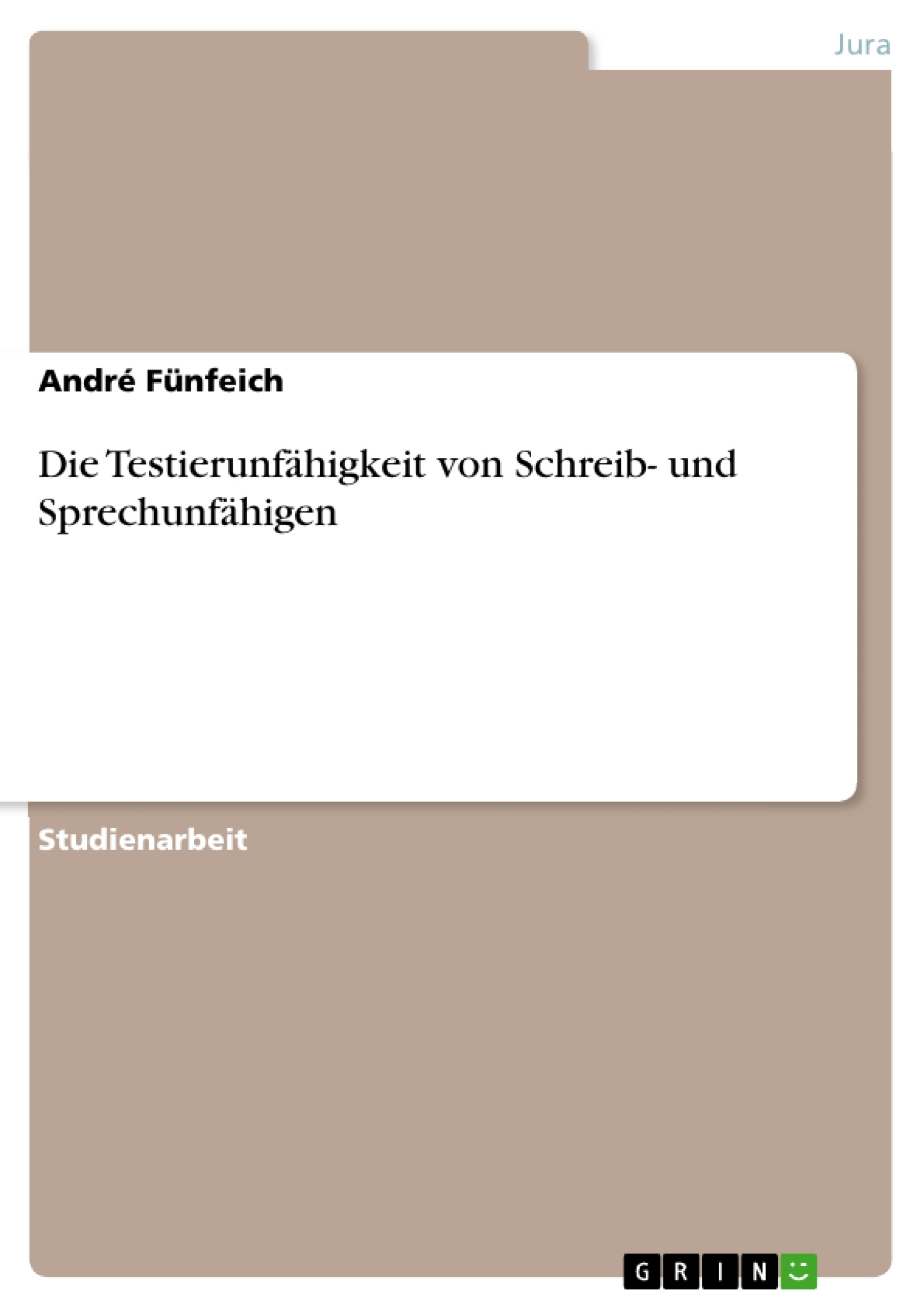Schreib- und sprechunfähige Personen konnten bis zum 19.01.1999 nicht wirksam testieren, weil sie die aus den §§ 2232 , 2233 BGB und dem § 31 S. 1 BeurkG resultierenden einfachgesetzlichen Formvor-schriften nicht erfüllen konnten, was zur Form-nichtigkeit der Testamente führte. Dieser generelle Ausschluß von Schreib- und Sprechunfähigen von der Testiermöglichkeit wurde mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 19.01.1999 als Grundrechtsverstoß gewertet, für verfassungswidrig erklärt und eine Testiermöglichkeit für schreib- und schreibunfähige Stumme eröffnet.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Die Ausgangssituation
- I. Sachverhalt
- II. Verfahrensgang
- III. Die zivilrechtliche Ausgangslage
- C. Urteilsanalyse
- I. Verstoß gegen Art. 14 I 1 GG
- II. Verstoß gegen Art. 3 I GG
- III. Verstoß gegen Art. 3 III 2 GG
- IV. Die verfassungskonforme Interpretation der §§ 2232, 2233 BGB und des § 31 BeurkG
- V. Ergebnis und Konsequenzen des Urteil des BVerfG
- D. Schrifttum und eigene Stellungnahme
- I. Zulässigkeit der Verfassungsmäßigkeitsprüfung
- II. Der Testierausschluß in der Verhältnismäßigkeitsprüfung
- III. Konkurrenzverhältnis zwischen Art. 3 I GG und Art. 3 III 2 GG
- IV. Schutzbereich des Art. 3 III 2 GG
- V. Die verfassungskonforme Interpretation
- VI. Verfassungswidrigkeit ohne Teilnichtigkeitserklärung
- VII. Gültigkeit der Übergangsregelungen für Erbscheine
- VIII. Konsequenzen des Urteils für andere Mehrfachbehinderte
- E. Vorschlag
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 19.01.1999, welches den generellen Ausschluss schreib- und sprechunfähiger Personen von der Testierfähigkeit für verfassungswidrig erklärte. Die Zielsetzung besteht darin, den Sachverhalt, den Verfahrensgang und die juristische Argumentation des BVerfG zu erläutern und die Konsequenzen des Urteils zu untersuchen.
- Verfassungskonforme Auslegung der §§ 2232, 2233 BGB und § 31 BeurkG
- Grundrechtsverletzung durch den Ausschluss von der Testierfähigkeit
- Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderungen
- Verhältnismäßigkeitsprüfung im Erbrecht
- Konsequenzen des Urteils für die Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Ausgangssituation vor dem Urteil des BVerfG vom 19.01.1999, in der schreib- und sprechunfähige Personen aufgrund gesetzlicher Formvorschriften nicht wirksam testieren konnten. Das Urteil erklärte diesen generellen Ausschluss als Grundrechtsverstoß und eröffnete eine Testiermöglichkeit für diese Personengruppe.
B. Die Ausgangssituation: Dieses Kapitel skizziert den Sachverhalt des dem BVerfG-Urteil zugrundeliegenden Falles, in dem ein schreib- und sprechunfähiger Kaufmann sein Testament errichtete und dessen Gültigkeit gerichtlich geprüft wurde. Es wird der Verfahrensgang vor den Vorinstanzen bis zum BVerfG dargestellt und die gesetzliche Ausgangslage erläutert, die den generellen Ausschluss von der Testierfähigkeit für betroffene Personen regelte. Der Fall zeigt exemplarisch die Problematik auf, welche zum Urteil des BVerfG führte.
C. Urteilsanalyse: Die Urteilsanalyse befasst sich mit der Begründung des BVerfG-Urteils. Es wird detailliert auf die Verstöße gegen Art. 14 I 1 GG (Erbrechtsgarantie), Art. 3 I GG (Gleichheitssatz) und Art. 3 III 2 GG (Benachteiligungsverbot für Behinderte) eingegangen. Der Abschnitt erläutert die verfassungskonforme Interpretation der relevanten Paragraphen des BGB und des Beurkundungsgesetzes, welche das BVerfG für notwendig erachtete, um die Verfassungswidrigkeit zu beheben. Der Fokus liegt auf der Begründung der Rechtswidrigkeit des bisherigen Ausschlusses und der notwendigen Folgen für die Rechtsprechung.
D. Schrifttum und eigene Stellungnahme: Dieser Abschnitt analysiert die rechtliche Literatur und die eigenen Schlussfolgerungen zu dem Thema. Es werden die Zulässigkeit der Verfassungsmäßigkeitsprüfung, der Testierausschluss im Lichte der Verhältnismäßigkeitsprüfung, das Konkurrenzverhältnis zwischen den genannten Grundrechtsartikeln, der Schutzbereich von Art. 3 III 2 GG, die verfassungskonforme Interpretation, die Verfassungswidrigkeit ohne Teilnichtigkeitserklärung, die Gültigkeit von Übergangsregelungen für Erbscheine, und die Konsequenzen des Urteils für andere mehrfach behinderte Personen diskutiert. Der Abschnitt liefert somit eine eingehende Auseinandersetzung mit der Rechtslage und ihren Implikationen.
Schlüsselwörter
Testierfreiheit, Erbrecht, Grundrechte, Art. 14 I 1 GG, Art. 3 I GG, Art. 3 III 2 GG, Behinderung, Schreibunfähigkeit, Sprechunfähigkeit, Verfassungskonforme Interpretation, §§ 2232, 2233 BGB, § 31 BeurkG, Bundesverfassungsgericht, Gleichbehandlung, Verhältnismäßigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse des BVerfG-Urteils vom 19.01.1999 zur Testierfähigkeit Schreib- und Sprechunfähiger
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 19.01.1999, welches den generellen Ausschluss schreib- und sprechunfähiger Personen von der Testierfähigkeit für verfassungswidrig erklärte. Sie erläutert den Sachverhalt, den Verfahrensgang, die juristische Argumentation des BVerfG und untersucht die Konsequenzen des Urteils.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die verfassungskonforme Auslegung der §§ 2232, 2233 BGB und § 31 BeurkG, die Grundrechtsverletzung durch den Ausschluss von der Testierfähigkeit, die Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderungen, die Verhältnismäßigkeitsprüfung im Erbrecht und die Konsequenzen des Urteils für die Praxis. Im Detail werden Verstöße gegen Art. 14 I 1 GG (Erbrechtsgarantie), Art. 3 I GG (Gleichheitssatz) und Art. 3 III 2 GG (Benachteiligungsverbot für Behinderte) untersucht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Einleitung, Ausgangssituation (Sachverhalt, Verfahrensgang, zivilrechtliche Ausgangslage), Urteilsanalyse (inkl. verfassungskonformer Interpretation), Schrifttum und eigene Stellungnahme (inkl. Zulässigkeit der Verfassungsmäßigkeitsprüfung, Verhältnismäßigkeitsprüfung, Konkurrenzverhältnis der Grundrechte, Schutzbereich des Art. 3 III 2 GG, Konsequenzen für Mehrfachbehinderte) und einen abschließenden Vorschlag.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Testierfreiheit, Erbrecht, Grundrechte, Art. 14 I 1 GG, Art. 3 I GG, Art. 3 III 2 GG, Behinderung, Schreibunfähigkeit, Sprechunfähigkeit, Verfassungskonforme Interpretation, §§ 2232, 2233 BGB, § 31 BeurkG, Bundesverfassungsgericht, Gleichbehandlung, Verhältnismäßigkeit.
Welche Rechtsgrundlagen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht insbesondere die Verfassungsmäßigkeit des generellen Ausschlusses schreib- und sprechunfähiger Personen von der Testierfähigkeit im Hinblick auf Art. 14 I 1 GG, Art. 3 I GG und Art. 3 III 2 GG. Ferner werden die §§ 2232, 2233 BGB und § 31 BeurkG im Kontext der verfassungskonformen Interpretation analysiert.
Was ist das Ergebnis der Urteilsanalyse?
Die Urteilsanalyse zeigt auf, dass der generelle Ausschluss schreib- und sprechunfähiger Personen von der Testierfähigkeit gegen die genannten Grundrechte verstößt. Das BVerfG führte eine verfassungskonforme Interpretation der relevanten Paragraphen des BGB und des Beurkundungsgesetzes durch, um die Verfassungswidrigkeit zu beheben und eine Testiermöglichkeit für diese Personengruppe zu schaffen.
Welche Konsequenzen hat das Urteil?
Das Urteil hat weitreichende Konsequenzen für die Rechtsprechung und die Praxis. Es sichert schreib- und sprechunfähigen Personen die Testierfähigkeit und gewährleistet ihre Gleichbehandlung im Erbrecht. Die Arbeit diskutiert auch die Konsequenzen für andere mehrfach behinderte Personen und die Gültigkeit von Übergangsregelungen für Erbscheine.
- Arbeit zitieren
- André Fünfeich (Autor:in), 2001, Die Testierunfähigkeit von Schreib- und Sprechunfähigen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/5302