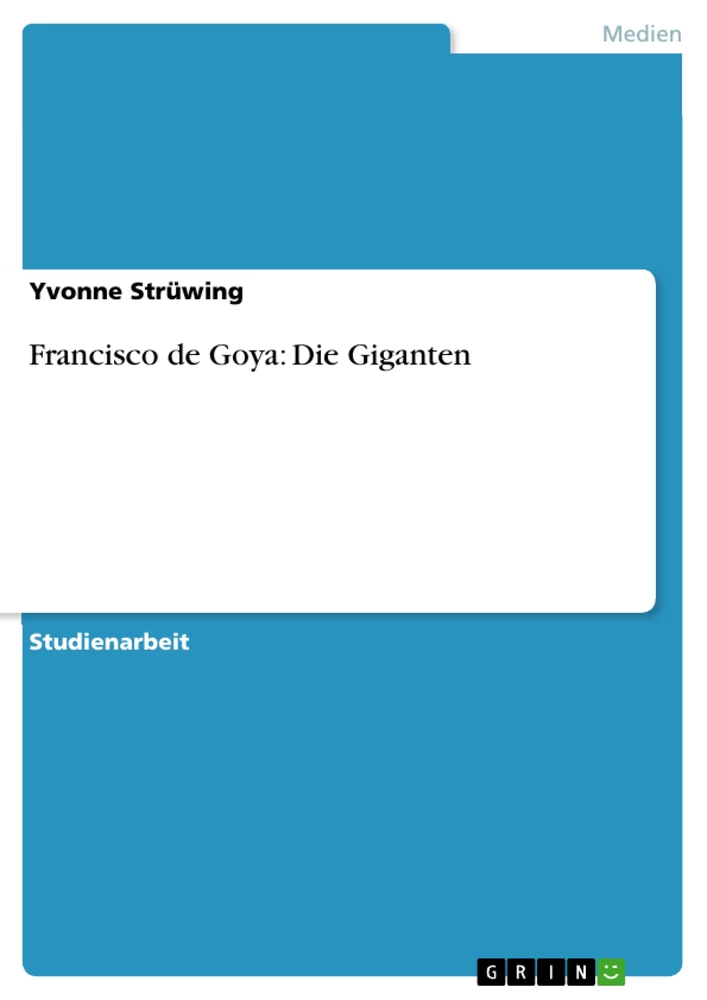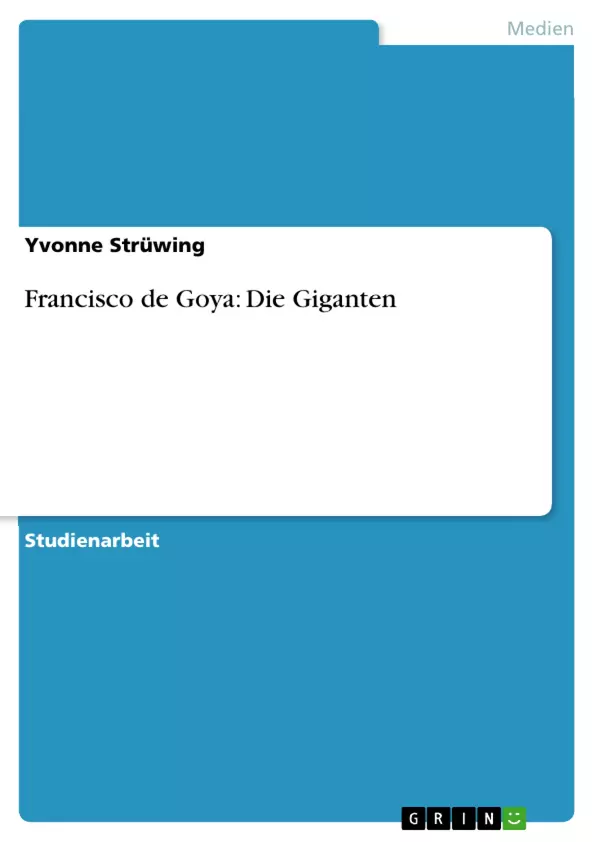Das Thema der vorliegenden Arbeit sind die beiden Giganten von Francisco de Goya, die in die
Zeitspanne zwischen 1808 und 1818 datiert werden und folglich in enger Verwandschaft zu den
Graphikzyklen und zu den schwarzen Bildern stehen.1
Während der Gigant des Gemäldes aus einer Quelle als el gigante hervorgeht2, fehlt dem
graphischen Blatt ein klarer Titel, und somit wird auch dieser üblicherweise als el gigante
bezeichnet. Um Verwechslungen zu vermeiden, werden in der vorliegenden Arbeit die beiden
Giganten mit der kämpfende Gigant und der sitzende Gigant bezeichnet. Obwohl im Prado das
Gemälde als el coloso3 betitelt wird, wird der Ausdruck Gigant dem des Kolosses vorgezogen, da
erstere Formulierung dem spanischen gigante am nächsten kommt und als el gigante aus einer
Bestandsaufnahme hervorging und nicht als el coloso .
Klarheit über die Intention Goyas mehrdeutig geprägte Giganten zu geben, ist ein schweres
Unterfangen, das viele Irrwege birgt. Für die Interpretation der beiden Giganten ist es der
Forschung bis heute nicht gelungen, übereinstimmende und zufriedenstellende Deutungsansätze zu
finden. Es werden sich widersetzende Deutungen angestellt, die sich im historisch-politischen und
sozialen Hintergrund ansiedeln, oder den biographischen persönlichen Hintergrund Goyas zu
durchleuchten versuchen. Psychologisierende Ansätze werden der Vollständigkeit halber angeführt,
jedoch sei bemerkt, dass diese kritisch betrachtet werden müssen und nicht ausschließlich für eine
Interpretation angewendet werden sollten.
Holländers Aufsatz zu den Giganten ist der einzige, der sich ausführlicher mit ihnen
auseinandersetzt - zumindest von der Literatur ausgehend, die in der Arbeit angeführt wird. Er
verfasste diesen anlässlich der Ringvorlesung Meisterwerke der Literatur4 oder besser gesagt, der
Kunstliteratur, in dem er die verschiedensten Interpretationsansätze anführt, diese abwägt und
weiterreichende Deutungen anstellt. Die Entscheidung für das Ausarbeiten dieses Aufsatzes
entspringt dessen Ansicht, dass die Giganten Goyas Meisterwerke darstellen und somit
ausführlicher besprochen und diskutiert werden müssen.5 Um der Frage auf den Grund zu gehen,
warum sie Meisterwerke sind und um mehr Aufschluss über die Bedeutung der Giganten zu
erlangen, werden sie im Kontext weiterer Werke Goyas und seiner Zeitgenossen betrachtet. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1 Datierung, Quellen
- 2.2 Das graphische Verfahren des sitzenden Giganten
- 2.3 Motivation Goyas
- 2.4 Frühromantik und Theorie des Erhabenen
- 2.5 Beschreibung des kämpfenden Giganten
- 2.6 Unabhängigkeit und Abhängigkeit beider Szenen voneinander
- 2.7 Interpretation
- 2.7.1 Prometheus
- 2.7.2 kämpfender Gigant als Symbol des spanischen Volkes und für Goya
- 2.7.3 kämpfender Gigant als Symbol für Napoleon Bonaparte oder Ferdinand VII
- 2.7.4 kämpfender Gigant als Allegorie der Schrecken des Krieges
- 2.8 Vergleiche
- 2.8.1 Schicksalsergebenheit
- 2.8.2 Vorbilder und Vergleiche: die Kampfeshaltung
- 2.9 Beschreibung des sitzenden Giganten
- 2.9.1 Interpretation und Vergleiche zum sitzenden Giganten
- 2.9.2 Die römische Mythologie: das melancholische Temperament von Saturn
- 2.9.3 Goya als Ilustrado
- 2.9.4 Stimmungsbilder: Goya und Friedrich
- 2.9.5 Vergleiche: Satan Miltons und Füsslis Polyphem
- 2.9.6 Vorbild: Torso Belvedere
- 3. Schlussteil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Goyas zwei Gigantenbilder – den kämpfenden und den sitzenden Giganten – und ihre Bedeutung im Kontext von Goyas Gesamtwerk und der Zeit um 1812. Die Zielsetzung besteht darin, die bislang uneinheitlichen Interpretationsansätze zu analysieren und eine kohärente Deutung zu entwickeln, unter Berücksichtigung von ikonographischen, mythologischen und philosophischen Aspekten.
- Datierung und Entstehungsgeschichte der Giganten
- Analyse des graphischen Verfahrens des sitzenden Giganten
- Interpretation der Symbolik beider Giganten im Hinblick auf den historischen Kontext (spanischer Unabhängigkeitskrieg)
- Vergleich mit Werken anderer Künstler und mythologischen Figuren
- Goyas künstlerische Intention und die Bedeutung der Giganten in seinem Œuvre
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit befasst sich mit den beiden Goyaschen Gigantenbildern (kämpfender und sitzender Gigant), die in die Zeit zwischen 1808 und 1818 datiert werden und in enger Beziehung zu seinen anderen Werken dieser Phase stehen. Die Uneinigkeit in der Forschung hinsichtlich ihrer Interpretation wird hervorgehoben, und der Fokus auf eine kohärente Deutung im Kontext von Goyas Werk und der zeitgenössischen Kunst und Philosophie wird betont. Die Arbeit konzentriert sich auf die ikonographische und mythologische Analyse sowie auf den Begriff des Erhabenen.
2. Hauptteil: Dieser Teil der Arbeit widmet sich einer detaillierten Untersuchung der beiden Giganten. Er beginnt mit der Diskussion der Datierung, der Quellen und der technischen Ausführung der Bilder. Anschließend wird die Motivation Goyas, die Frühromantik und die Theorie des Erhabenen in Beziehung zu den Bildern analysiert. Der Hauptteil beschreibt die beiden Giganten detailliert und vergleicht sie miteinander. Verschiedene Interpretationen werden vorgestellt, einschließlich der Betrachtung der Giganten als Symbole des spanischen Volkes, Napoleons, Ferdinand VII. oder als Allegorien der Schrecken des Krieges. Vergleiche mit Werken anderer Künstler und mythologischen Figuren werden gezogen, um die Bedeutung und den Kontext der Bilder zu verdeutlichen. Besondere Aufmerksamkeit wird der Interpretation des sitzenden Giganten gewidmet, inklusive der Analyse seiner Verbindungen zur römischen Mythologie, zu Goyas Rolle als Ilustrado, und zu Werken von Künstlern wie Caspar David Friedrich.
Schlüsselwörter
Francisco de Goya, Giganten, kämpfender Gigant, sitzender Gigant, Frühromantik, Erhabenes, spanischer Unabhängigkeitskrieg, Ikonographie, Mythologie, Interpretationsansätze, Mezzotintotechnik, Aquatinta, Ilustrados.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Goyas Gigantenbildern
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert die beiden Gigantenbilder von Francisco Goya – den kämpfenden und den sitzenden Giganten – und deren Bedeutung im Kontext von Goyas Gesamtwerk und der Zeit um 1812. Der Fokus liegt auf einer kohärenten Deutung unter Berücksichtigung ikonographischer, mythologischer und philosophischer Aspekte.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst die Datierung und Entstehungsgeschichte der Gigantenbilder, eine detaillierte Analyse des graphischen Verfahrens (insbesondere beim sitzenden Giganten), die Interpretation der Symbolik beider Giganten im Hinblick auf den spanischen Unabhängigkeitskrieg, Vergleiche mit Werken anderer Künstler und mythologischen Figuren sowie Goyas künstlerische Intention und die Bedeutung der Giganten in seinem Gesamtwerk.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schlussteil. Der Hauptteil behandelt ausführlich die Datierung, Quellen und die graphische Ausführung der Bilder. Er analysiert Goyas Motivation, die Frühromantik und die Theorie des Erhabenen im Zusammenhang mit den Bildern. Es werden detaillierte Beschreibungen und Vergleiche der beiden Giganten geliefert, verschiedene Interpretationen vorgestellt (z.B. als Symbole des spanischen Volkes, Napoleons, Ferdinand VII. oder als Allegorien des Krieges) und Vergleiche mit anderen Werken und mythologischen Figuren gezogen. Besondere Aufmerksamkeit erhält die Interpretation des sitzenden Giganten, inklusive seiner Verbindungen zur römischen Mythologie, Goyas Rolle als Ilustrado und Vergleichen mit Werken von Künstlern wie Caspar David Friedrich.
Welche Interpretationsansätze werden diskutiert?
Die Arbeit untersucht verschiedene Interpretationen der Gigantenbilder. Es werden unter anderem die Deutungen als Symbole des spanischen Volkes, Napoleons Bonaparte oder Ferdinand VII. sowie als Allegorien der Schrecken des Krieges diskutiert. Die Analyse berücksichtigt auch die Rolle der römischen Mythologie und den Einfluss der Frühromantik und der Theorie des Erhabenen.
Welche Künstler und mythologische Figuren werden zum Vergleich herangezogen?
Die Arbeit zieht Vergleiche zu verschiedenen Künstlern und mythologischen Figuren, um den Kontext und die Bedeutung der Goyaschen Gigantenbilder zu verdeutlichen. Genannt werden unter anderem Caspar David Friedrich, Milton (Satan) und Füssli (Polyphem). Auch der Torso Belvedere wird als mögliches Vorbild diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Francisco de Goya, Giganten, kämpfender Gigant, sitzender Gigant, Frühromantik, Erhabenes, spanischer Unabhängigkeitskrieg, Ikonographie, Mythologie, Interpretationsansätze, Mezzotintotechnik, Aquatinta, Ilustrados.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung der Arbeit besteht darin, die bislang uneinheitlichen Interpretationsansätze zu Goyas Gigantenbildern zu analysieren und eine kohärente Deutung zu entwickeln. Dabei werden ikonographische, mythologische und philosophische Aspekte berücksichtigt.
- Arbeit zitieren
- Yvonne Strüwing (Autor:in), 2004, Francisco de Goya: Die Giganten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/53122