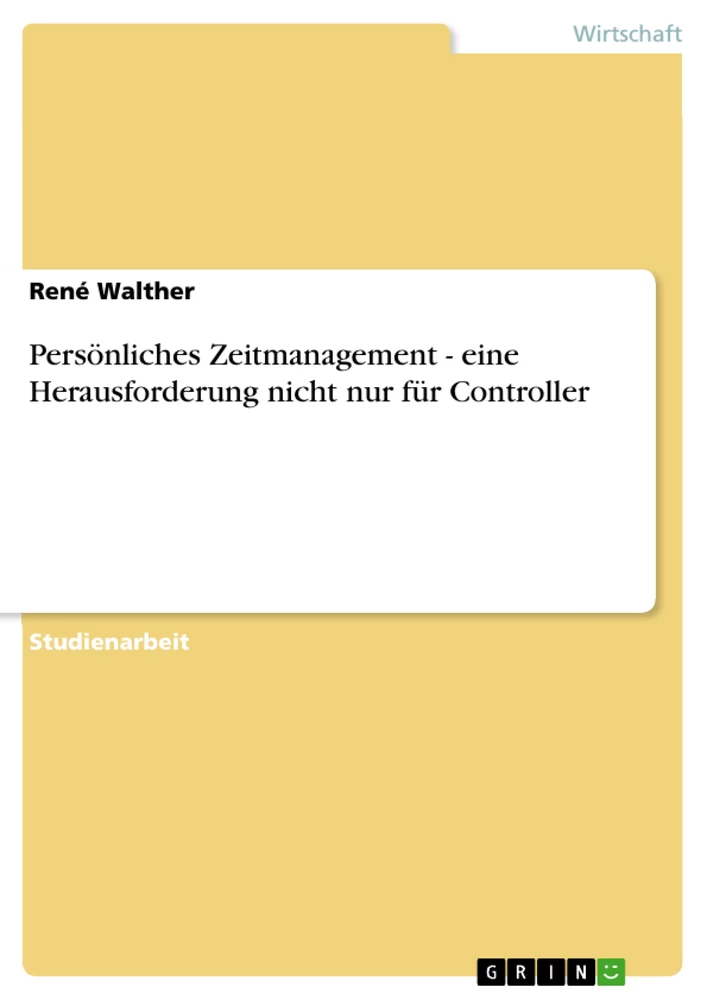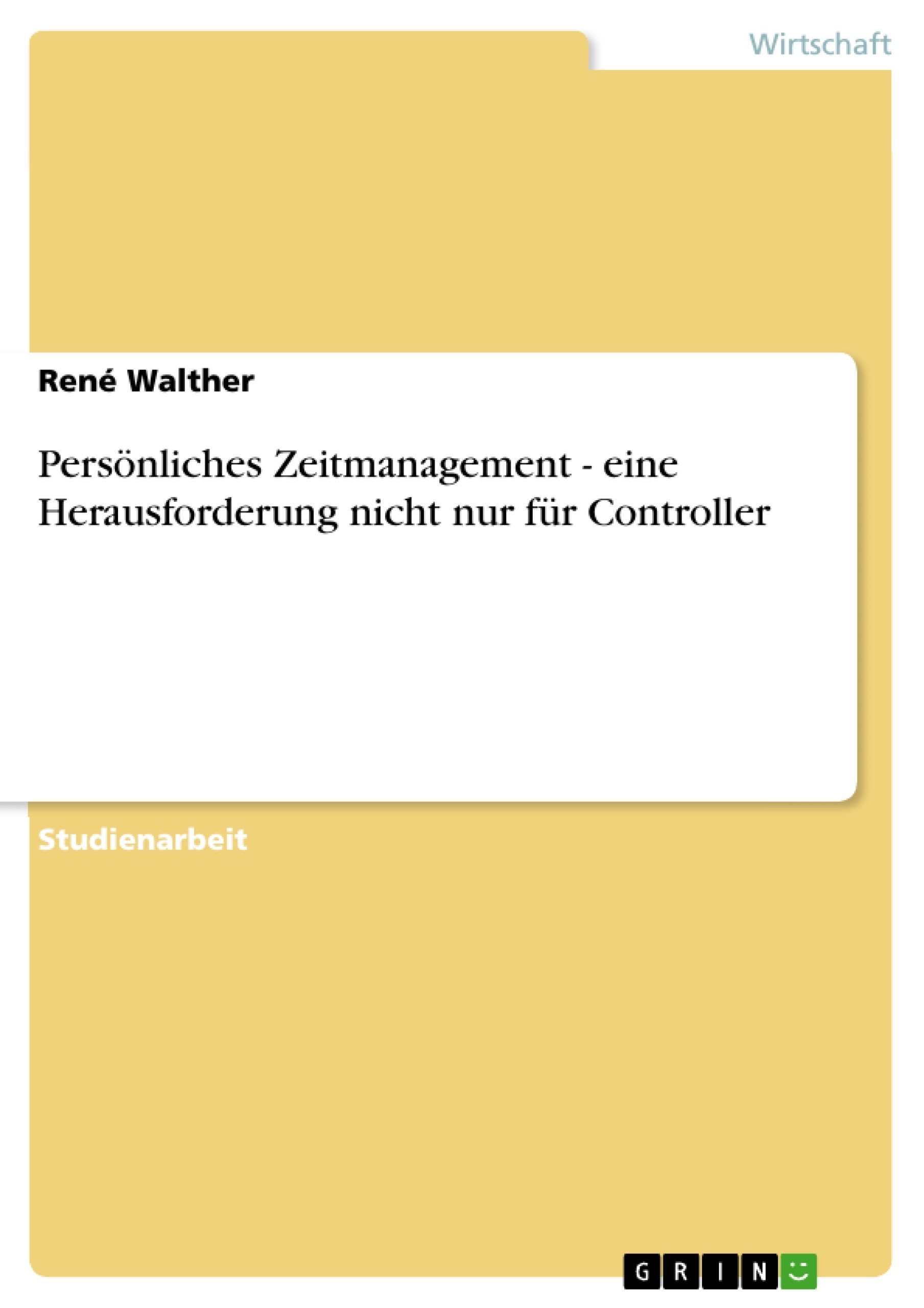Morgens um halb sieben aufstehen, gegen halb acht geht es zur Arbeit, um neun bereits eine Besprechung, zeitraubende Routinearbeiten bis zur Mittagspause um zwölf, gegen 13 Uhr Präsentation im Vertrieb, anschließend wöchentliche Kostenstellenberichte erstellen, um 18 Uhr Feierabend. So könnte sich der Tagesablauf eines Controllers gestalten. Zeit spielt dabei eine herausragende Rolle. Auf vielfältigste Art und Weise sind wir von ihr betroffen, denken über sie nach oder unterwerfen uns ihr. Dies geschieht sowohl im privaten Lebensbereich (Verabredung mit Freunden) als auch im Beruf (Arbeitszeitregelung). Unter Zeit versteht man im Allgemeinen die Abfolge von Ereignissen und Aktivitäten. Ereignisse lassen sich in diesem Zusammenhang als Ursache-Wirkungen definieren. Damit zwischen Menschen oder Institutionen eine zeitliche Koordination möglich ist, benötigen sie gemeinsame Ursache-Wirkungsketten. Die gebräuchlichste ist dabei der Lauf der Erde um die Sonne und die entsprechenden Unterteilungen dieses Zeitraumes, die Kalenderzeit (Vgl. Lücke (2000), S. 31 ff.). Sie ermöglicht es uns mit anderen Personen in Kontakt zu treten, uns mit ihnen zu treffen und Termine einzuhalten. Durch die Kalenderzeit wird unsere wöchentliche und tägliche Arbeitszeit bestimmt. Unser Leben und Arbeiten wird aber häufig durch eine andere Zeit bestimmt: die „gefühlte“ subjektive Zeit. Die schnelle Abfolge von Aktivitäten oder Ursache-Wirkungsketten erzeugt in uns das Gefühl, die Zeit würde schneller laufen. Viele Aktivitäten in kurzer Zeit können zu Stress führen. Obwohl die Zeit objektiv gleichlang bleibt, sind wir der Ansicht, ein Zeitdruck laste auf unseren Schultern. Das Gefühl schnellablaufender Zeit haben wir ebenfalls, wenn wir Tätigkeiten ausüben, die wir sehr gern erledigen. Das langsame Aufeinanderfolgen von Ereignissen bewirkt das gegenteilige Gefühl, die Zeit scheint sich zu dehnen (Vgl. Scott (1995), S. 13). Dies sind allerdings nur subjektive Eindrücke, tatsächlich verrinnt Zeit fortwährend, konstant und unwiederbringlich. Wir können sie nicht dehnen oder beschleunigen. Lediglich optimal nutzen können wir sie. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Unser Verständnis von Zeit
- Gründe und Einflussfaktoren des persönlichen Zeitmanagements
- Komponenten des individuellen Zeitmanagements
- Zeitinventur – die persönliche Analyse
- Zielsetzung
- Zeitplanung
- Entscheidungen und das Setzen von Prioritäten
- Organisation und Realisation
- Kontrolle
- Zeitmanagement für Besprechungen
- Besprechungsvorbereitung
- Im Verlaufe der Besprechung
- Nachbereitung einer Besprechung
- Grenzen des individuellen Zeitmanagements
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema des persönlichen Zeitmanagements, insbesondere im Kontext der beruflichen Herausforderungen von Controllern. Sie analysiert die Bedeutung von Zeit im beruflichen und privaten Alltag und beleuchtet die Faktoren, die ein effektives Zeitmanagement beeinflussen. Ziel ist es, grundlegende Konzepte, Handlungsstrategien und geeignete Instrumente für ein erfolgreiches Zeitmanagement zu erarbeiten.
- Das Verständnis von Zeit und die Unterscheidung zwischen objektiver und subjektiver Zeitwahrnehmung
- Die Analyse von Einflussfaktoren, die das persönliche Zeitmanagement beeinflussen
- Die Komponenten des individuellen Zeitmanagements, wie z. B. Zeitinventur, Zielsetzung, Zeitplanung und Priorisierung
- Die Anwendung von Zeitmanagementstrategien im Kontext von Besprechungen
- Die Grenzen des individuellen Zeitmanagements
Zusammenfassung der Kapitel
- Unser Verständnis von Zeit: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Zeit im täglichen Leben, insbesondere für Controller. Es untersucht die verschiedenen Zeitauffassungen, wie die objektive Zeit und die subjektive Zeitwahrnehmung, und zeigt deren Relevanz für das Zeitmanagement auf.
- Gründe und Einflussfaktoren des persönlichen Zeitmanagements: In diesem Kapitel werden die wichtigsten Gründe für ein effektives Zeitmanagement beleuchtet. Es werden interne und externe Einflussfaktoren analysiert, die die individuelle Zeitnutzung beeinflussen können.
- Komponenten des individuellen Zeitmanagements: Dieses Kapitel behandelt die verschiedenen Komponenten des persönlichen Zeitmanagements, darunter die Analyse der eigenen Zeiteinteilung (Zeitinventur), die Festlegung von Zielen, die Planung von Aufgaben, das Setzen von Prioritäten und die Organisation des Arbeitsprozesses.
- Zeitmanagement für Besprechungen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die effektive Nutzung von Zeit im Kontext von Besprechungen. Es werden Strategien zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Besprechungen vorgestellt, um Zeitverschwendung zu vermeiden und die Effizienz zu steigern.
- Grenzen des individuellen Zeitmanagements: Dieses Kapitel beleuchtet die Grenzen des persönlichen Zeitmanagements. Es werden Faktoren analysiert, die die individuelle Zeitnutzung einschränken können, wie z. B. externe Einflüsse oder strukturelle Probleme innerhalb des Unternehmens.
Schlüsselwörter
Zeitmanagement, Controller, Zeitwahrnehmung, Zeitinventur, Zielsetzung, Zeitplanung, Priorisierung, Besprechungsmanagement, Effizienz, Zeitverschwendung, Grenzen des Zeitmanagements.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Zeitmanagement für Controller besonders wichtig?
Controller müssen oft unter hohem Zeitdruck Berichte erstellen, Besprechungen koordinieren und Routinearbeiten bewältigen, was eine effiziente Planung erfordert.
Was ist der Unterschied zwischen objektiver und subjektiver Zeit?
Objektive Zeit ist die konstante Kalenderzeit, während subjektive Zeit das individuelle Empfinden beschreibt (z.B. Zeitdruck oder das Gefühl, die Zeit „verrinne“ im Flug).
Was gehört zu einer persönlichen Zeitinventur?
Es ist die Analyse der aktuellen Zeiteinteilung, um Zeitfresser zu identifizieren und die eigene Produktivität kritisch zu hinterfragen.
Wie verbessert man das Zeitmanagement in Besprechungen?
Durch gründliche Vorbereitung, klare Zeitvorgaben während des Verlaufs und eine strukturierte Nachbereitung zur Vermeidung von Zeitverschwendung.
Was sind die Grenzen des individuellen Zeitmanagements?
Externe Faktoren wie strukturelle Probleme im Unternehmen, unvorhersehbare Krisen oder die Abhängigkeit von der Zuarbeit Dritter können die eigene Planung einschränken.
Welche Rolle spielt die Priorisierung?
Priorisierung hilft dabei, wichtige von dringenden Aufgaben zu unterscheiden und die begrenzte Zeit auf wertschöpfende Tätigkeiten zu konzentrieren.
- Citar trabajo
- René Walther (Autor), 2005, Persönliches Zeitmanagement - eine Herausforderung nicht nur für Controller, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/53239