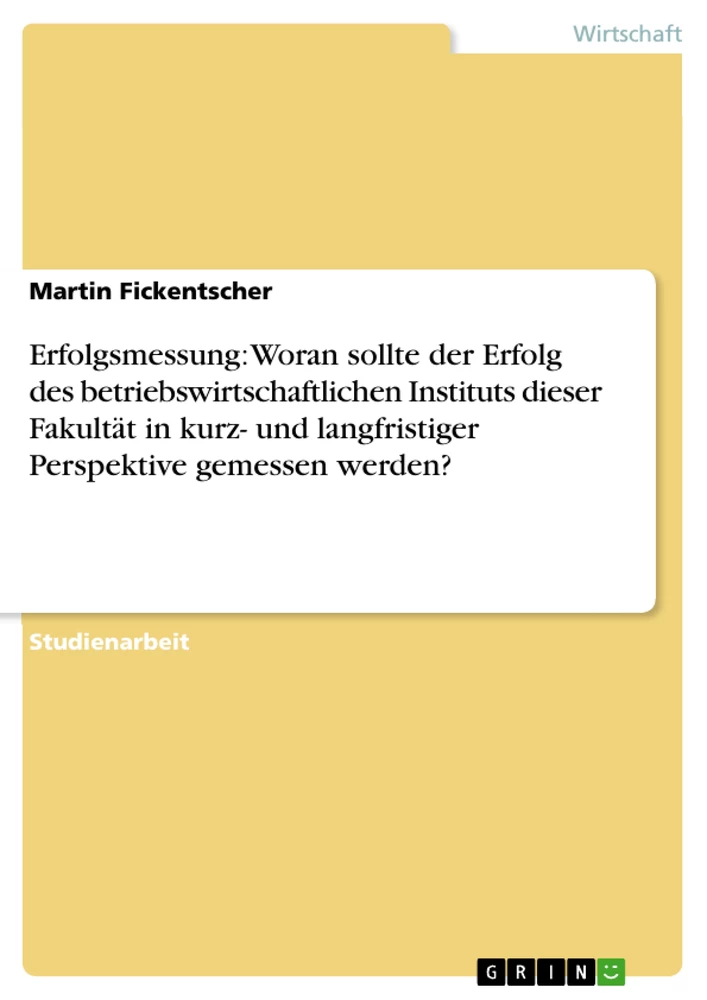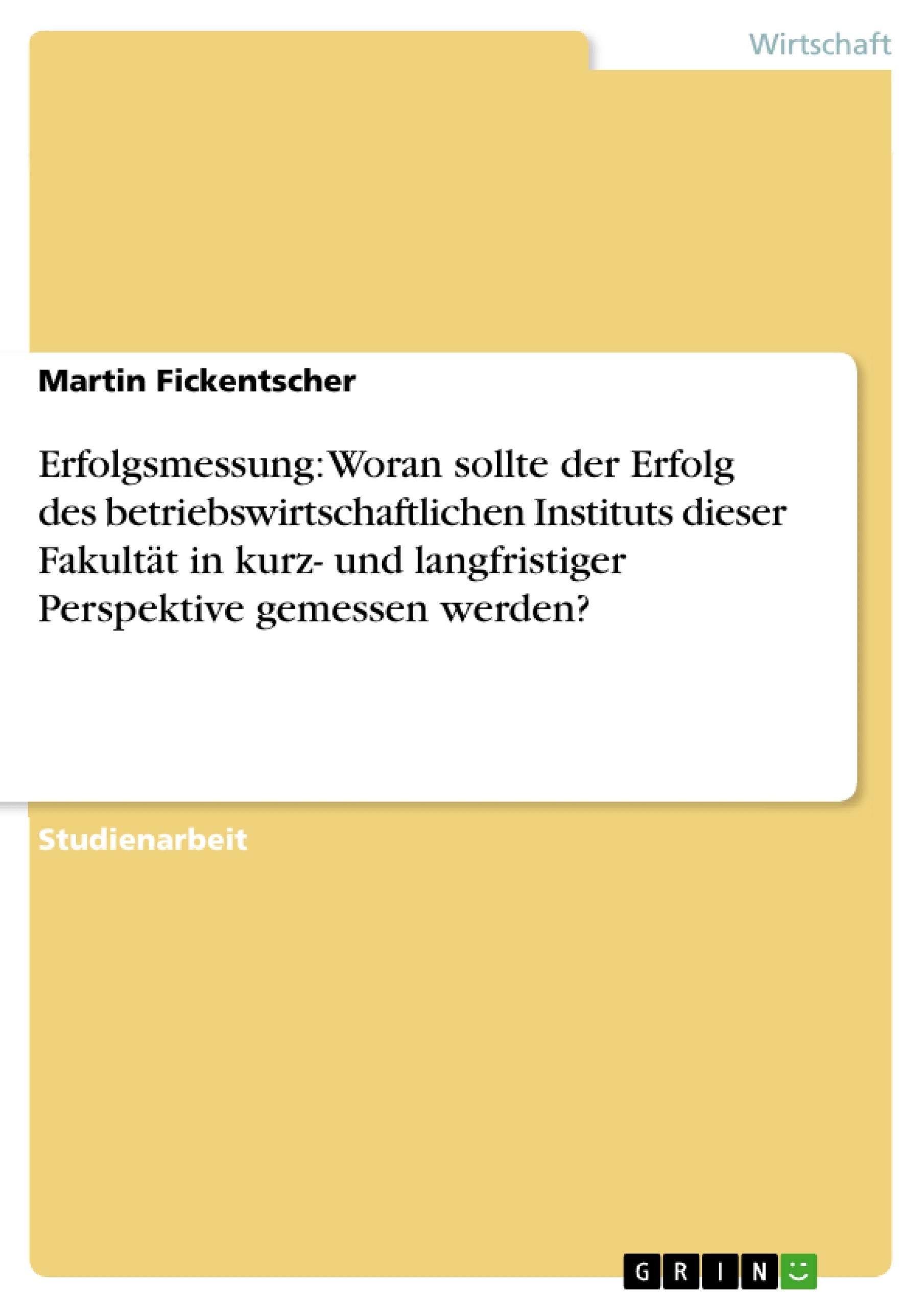Mit der Schaffung eines einheitlichen europäischen Hochschulraums im Zuge des Bolognaprozesses verschärft sich der Wettbewerb im Hochschulsektor. Durch die Europäisierung erhöht sich nicht nur die Vergleichbarkeit der Leistungen, sondern auch der Leistungsdruck auf allen Ebenen der Hochschulen, die sich als Non-Profit Organisationen nun ökonomischen Anforderungen gegenüber stehen sehen. Um in Zukunft an diesem Wettbewerb - auch im Hinblick auf die Mittelknappheit im öffentlichen Sektor und die Umwerbung von Spendenmitteln - in möglichst großem Umfang teilhaben zu können ist es nötig, die eigene Leistung ständig zu verbessern und im Rahmen eines ausgereiften Hochschulmarketings zu kommunizieren. Vorraussetzung dafür sind eine permanente Evaluation der Ist-Leistung sowie Zielvereinbarungen zur Formulierung der Soll-Leistung, auch disaggregiert auf Fakultäts-, Institutions- und Lehrstuhlebene. Ein Vergleich von Soll- und Ist-Leistung lässt auf Effektivität und Effizienz, und damit auf den Erfolg der einzelnen Ebenen schließen. Im Gegensatz zu Unternehmen lässt sich der Erfolg hier nicht direkt an eindeutig messbaren monetären Größen ausmachen. Vielmehr helfen qualitative Indikatoren neben Kennzahlen mit quantitativen In-formationen wie Input-, Throughput- und Outputgrößen die finanziellen Größen zu ersetzen. Diverse Institute, wie z.B. das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE), versuchen die Qualität von Hochschulen durch Rankings zu messen, veranschaulichen und zu vergleichen. Dabei greifen Sie auf Indikatoren und Kennzahlen zurück, die die Performance in Forschung und Lehre möglichst gut widerspiegeln sollen. Ziel dieser Arbeit ist es, quantitative und qualitative Indikatoren in diesen Bereichen vorzustellen und deren Eignung als transparentes Erfolgsmaß auf Institutionsebene kritisch zu überprüfen. Nach einem Blick auf die Erfolgsvermarktung herausragender Wirtschaftsfakultäten soll eine Empfehlung abgegeben werden, woran der Erfolg des betriebswirtschaftlichen Instituts der Universität Regensburg in kurz- und langfristiger Perspektive konkret gemessen werden sollte.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Erfolgsmessung an Hochschulen
- Erfolgsmessung in der Lehre
- Quantitative Maße
- Zahl der Studienanfänger
- Absolventenquote
- Durchschnittliche Fachstudiendauer
- Betreuungsverhältnis
- Studienabbruch- und Studienfachwechselquote
- Qualitative Maße
- Evaluation von Lehre und Lehrveranstaltungen
- Internationalisierung
- Praxisnähe
- Quantitative Maße
- Erfolgsmessung in der Forschung
- Quantitative Maße
- Publikationsraten
- Promotionen und Habilitationen
- Qualitative Maße
- Rankings
- Zitierhäufigkeit
- Drittmittelquote
- Peer Reviews und Forschungspreise
- Quantitative Maße
- Erfolgsmessung bei herausragenden Fakultäten
- Universität Mannheim
- Universität Münster
- Universität St. Gallen (HSG)
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Erfolgsmessung an Hochschulen und insbesondere an Wirtschaftsfakultäten im Kontext des Bologna-Prozesses und des sich dadurch verstärkenden Wettbewerbs. Sie analysiert die Herausforderungen der Erfolgsmessung in einem Bereich, der sich durch die Schwierigkeit der Produktdefinition und die subjektive Bewertung von Qualität auszeichnet. Ziel ist es, quantitative und qualitative Indikatoren zur Messung der Leistung in Forschung und Lehre vorzustellen und deren Eignung für eine transparente Erfolgsmessung auf Institutionsebene kritisch zu überprüfen. Schließlich soll anhand von Beispielen herausragender Wirtschaftsfakultäten eine Empfehlung für die Erfolgsmessung des betriebswirtschaftlichen Instituts der Universität Regensburg in kurz- und langfristiger Perspektive gegeben werden.
- Erfolgsmessung in Forschung und Lehre
- Quantitative und qualitative Indikatoren
- Herausforderungen der Erfolgsmessung in der Wissenschaft
- Best-Practice-Beispiele aus der Praxis
- Empfehlungen für die Erfolgsmessung an der Universität Regensburg
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext der Erfolgsmessung an Hochschulen im Zuge des Bologna-Prozesses und des zunehmenden Wettbewerbs beschreibt. Anschließend werden die Herausforderungen der Erfolgsmessung an Hochschulen im Allgemeinen und insbesondere die Schwierigkeiten bei der Definition des "Produkts" und der subjektiven Bewertung von Qualität erläutert. Im folgenden Kapitel werden quantitative und qualitative Indikatoren zur Messung der Leistung in Lehre und Forschung vorgestellt und deren Eignung für eine transparente Erfolgsmessung kritisch geprüft. Es werden verschiedene Kennzahlen und Indikatoren, wie die Zahl der Studienanfänger, die Absolventenquote, die Publikationsraten und die Drittmittelquote, sowie qualitative Kriterien, wie die Evaluation von Lehre und Forschung, die Internationalisierung und die Praxisnähe, beleuchtet.
Schlüsselwörter
Erfolgsmessung, Hochschulen, Wirtschaftsfakultäten, Bologna-Prozess, Wettbewerb, Produktdefinition, Qualität, Lehre, Forschung, quantitative Indikatoren, qualitative Indikatoren, Kennzahlen, Rankings, Evaluation, Internationalisierung, Praxisnähe, Best-Practice-Beispiele.
Häufig gestellte Fragen
Wie lässt sich Erfolg an Hochschulen messen?
Erfolg wird an Hochschulen über quantitative Kennzahlen (z.B. Absolventenquote, Drittmittel) und qualitative Indikatoren (z.B. Rankings, Evaluationen) in Lehre und Forschung gemessen.
Welche quantitativen Maße sind in der Lehre wichtig?
Dazu zählen die Zahl der Studienanfänger, die Absolventenquote, die durchschnittliche Fachstudiendauer und das Betreuungsverhältnis.
Welche Rolle spielen Rankings wie das CHE-Ranking?
Rankings versuchen, die Qualität von Hochschulen vergleichbar zu machen und dienen als Instrument im Hochschulmarketing, um Studierende und Spender zu gewinnen.
Wie wird Forschungserfolg bewertet?
Über Publikationsraten, die Anzahl von Promotionen und Habilitationen, die Zitierhäufigkeit sowie die eingeworbenen Drittmittel.
Warum ist die Erfolgsmessung an Hochschulen schwierig?
Im Gegensatz zu Unternehmen fehlen eindeutige monetäre Größen, und die Definition des „Produkts“ sowie die Bewertung von Qualität sind oft subjektiv.
- Quote paper
- Martin Fickentscher (Author), 2005, Erfolgsmessung: Woran sollte der Erfolg des betriebswirtschaftlichen Instituts dieser Fakultät in kurz- und langfristiger Perspektive gemessen werden?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/53404