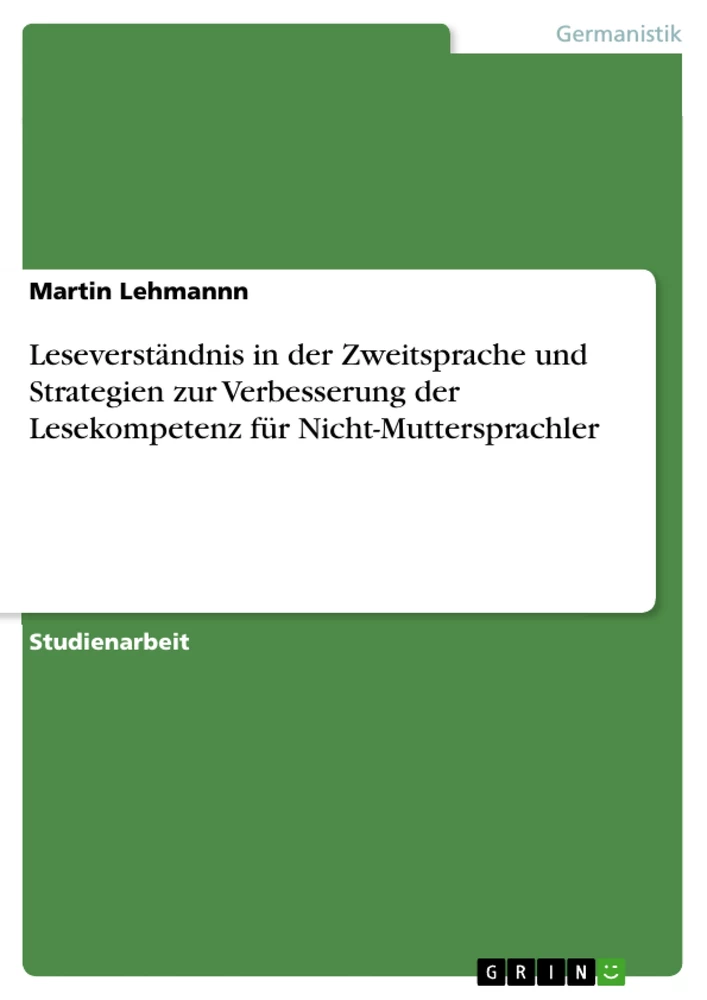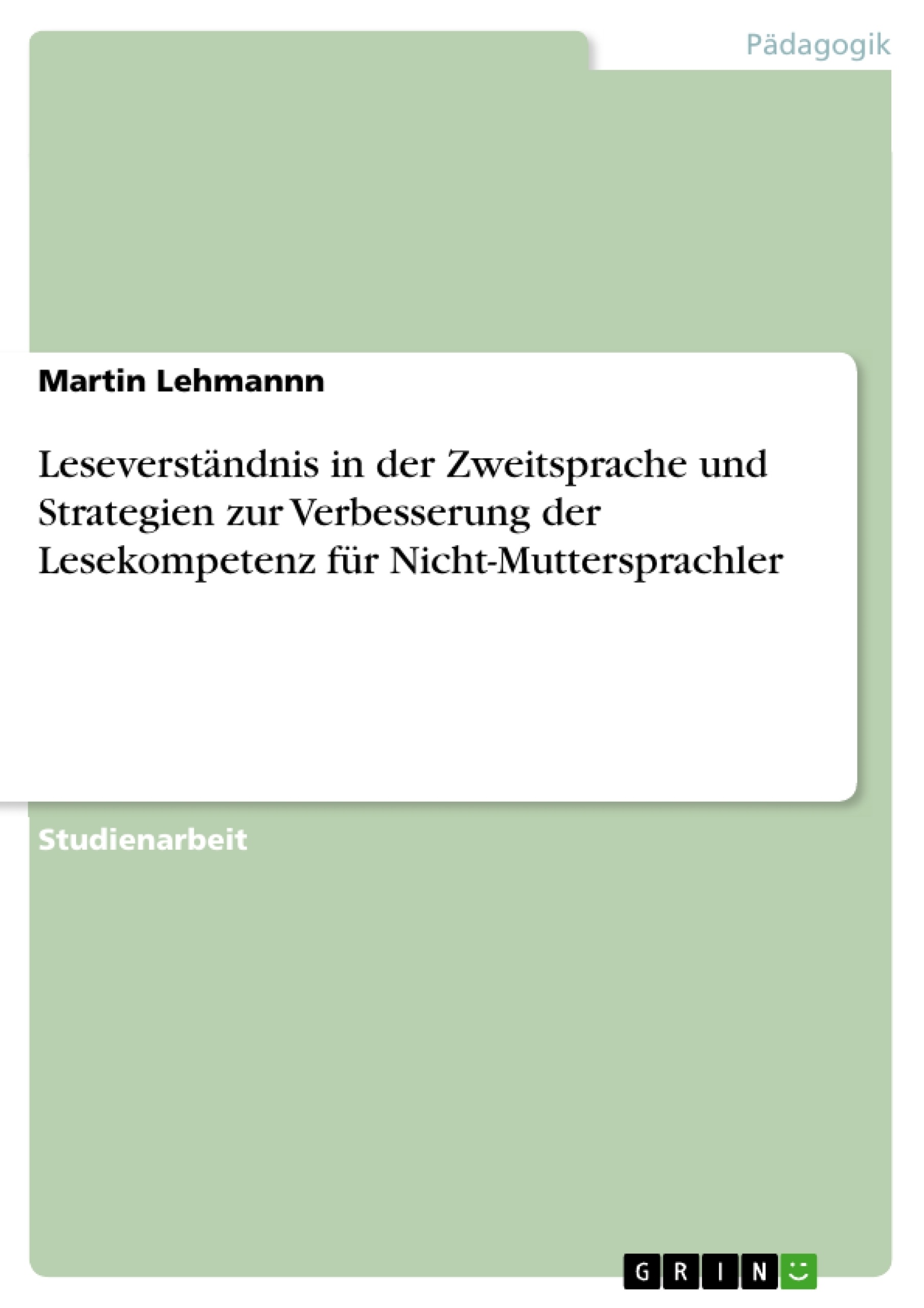Lesen ist die Schlüsselqualifikation schlechthin: Es vermittelt Wissen, es bedeutet Welterfahrung, es weitet den Horizont in jeder Hinsicht. Lesen vermittelt Einblicke in unterschiedliche Fachgebiete, Zeiten und Räume - insbesondere in die geistigen Räume und die Vorstellungswelten verschiedenster Autoren. Es fördert Phantasie und Kreativität, denn die Bilder zum Text werden nicht einfach geliefert und passiv konsumiert, sondern sie müssen aus dem abstrakten Medium Schrift individuell und aktiv erzeugt werden. Auf diese Weise trainiert das Lesen die Geduld und das Konzentrationsvermögen. Dass das Lesen auch die eigene „Sprache“ bereichert, dass Wortschatz und Ausdrucksfähigkeit wachsen, versteht sich von selbst. Schließlich wird durch das langsame, reflektierende, kritische Lesen das Denkvermögen und die Urteilskraft in besonderem Maße geschult.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was tun wir, wenn wir lesen?
- Was ist anders, wenn wir einen fremdsprachlichen Text lesen?
- Einige ausgewählte Strategien zur Verbesserung des Textverständnisses
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Prozesse des Lesens, insbesondere im Kontext des Deutsch-als-Zweitsprache-Unterrichts. Sie beleuchtet die Unterschiede zwischen muttersprachlichem und fremdsprachigem Lesen und präsentiert Strategien zur Verbesserung der Lesekompetenz von Nicht-Muttersprachlern. Das Hauptziel ist es, ein besseres Verständnis für die Herausforderungen des fremdsprachigen Lesens zu schaffen und Lösungsansätze aufzuzeigen.
- Prozesse des Lesens (muttersprachlich und fremdsprachlich)
- Rollen von Vorwissen und Schemata beim Lesen
- Herausforderungen beim fremdsprachigen Lesen
- Strategien zur Verbesserung des Leseverstehens
- Bedeutung des Lesens als Schlüsselqualifikation
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung betont die immense Bedeutung des Lesens als Schlüsselqualifikation und Kulturtechnik, die weit über den Erwerb von Wissen hinausgeht und Phantasie, Kreativität, Denkvermögen und Urteilskraft fördert. Sie führt in die Problematik des fremdsprachigen Lesens ein und skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich mit den Prozessen des Lesens, den Unterschieden zwischen muttersprachlichem und fremdsprachlichem Lesen und Strategien zur Verbesserung des Leseverstehens auseinandersetzt.
Was tun wir, wenn wir lesen?: Dieses Kapitel untersucht die kognitiven Prozesse beim Lesen. Es beginnt mit einem fiktiven Schülergespräch, das unterschiedliche Leseerfahrungen verdeutlicht. Der Text analysiert die Definition von „Verstehen“ nach Krischer, die das Einordnen von Aussagen in einen Zusammenhang und das Bezugnehmen auf den Kontext beinhaltet. Wichtige Aspekte sind die Selektion von Informationen, Abstraktion, Antizipation und die Rolle von Schemata. Am Beispiel der Satzfragmente "Ich habe den Film..." und "Fer..." wird die Aktivierung von Schemata und deren Beitrag zum schnellen und effizienten Leseprozess erläutert. Die Bedeutung von Vorwissen, sowohl sprachlichem als auch kulturellem und Weltwissen, wird hervorgehoben, da neue Informationen leichter verarbeitet werden, wenn sie an Bekanntes angeknüpft werden können. Ein Beispiel mit einem kriminellen Fall veranschaulicht, wie kulturelles Wissen implizite Informationen aus dem Text erschließt.
Schlüsselwörter
Leseverständnis, Zweitsprache, Deutsch als Fremdsprache, Lesestrategien, Textverständnis, Schemata, Vorwissen, Kognition, Lesemethoden, Leseerwerb.
Häufig gestellte Fragen zu: Prozesse des Lesens im DaF-Unterricht
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit den Prozessen des Lesens, insbesondere im Kontext des Deutsch-als-Zweitsprache-Unterrichts. Sie analysiert die Unterschiede zwischen muttersprachlichem und fremdsprachigem Lesen und präsentiert Strategien zur Verbesserung der Lesekompetenz von Nicht-Muttersprachlern. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der Herausforderungen beim fremdsprachigen Lesen und der Entwicklung von Lösungsansätzen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Prozesse des Lesens (muttersprachlich und fremdsprachlich), die Rolle von Vorwissen und Schemata beim Lesen, die Herausforderungen beim fremdsprachigen Lesen, Strategien zur Verbesserung des Leseverstehens und die Bedeutung des Lesens als Schlüsselqualifikation.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu einer Einleitung, einer Analyse der Prozesse beim Lesen (Was tun wir, wenn wir lesen?), den Unterschieden zwischen muttersprachlichem und fremdsprachigem Lesen (Was ist anders, wenn wir einen fremdsprachlichen Text lesen?) und ausgewählten Strategien zur Verbesserung des Textverständnisses. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detaillierter beschrieben.
Wie wird das Lesen im muttersprachlichen und fremdsprachlichen Kontext verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Prozesse des Lesens im Muttersprachen- und Fremdsprachenkontext, indem sie die kognitiven Prozesse, die Rolle von Vorwissen und Schemata sowie die Herausforderungen beim Fremdsprachenlesen beleuchtet. Die Unterschiede werden anhand von Beispielen und fiktiven Schülergesprächen verdeutlicht.
Welche Strategien zur Verbesserung des Leseverstehens werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert verschiedene Strategien zur Verbesserung des Leseverstehens im Fremdsprachenunterricht. Diese Strategien werden im Kapitel "Einige ausgewählte Strategien zur Verbesserung des Textverständnisses" detailliert erläutert, wenngleich die konkreten Strategien selbst nicht explizit in der Vorschau genannt werden.
Welche Rolle spielen Vorwissen und Schemata beim Lesen?
Die Arbeit betont die wichtige Rolle von Vorwissen und Schemata beim Lesen. Vorwissen, sowohl sprachliches als auch kulturelles und Weltwissen, erleichtert die Verarbeitung neuer Informationen. Schemata helfen beim schnellen und effizienten Leseprozess, indem sie den Leser ermöglichen, Informationen einzuordnen und Zusammenhänge herzustellen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Leseverständnis, Zweitsprache, Deutsch als Fremdsprache, Lesestrategien, Textverständnis, Schemata, Vorwissen, Kognition, Lesemethoden, Leseerwerb.
Was ist das Hauptziel der Arbeit?
Das Hauptziel der Arbeit ist es, ein besseres Verständnis für die Herausforderungen des fremdsprachigen Lesens zu schaffen und Lösungsansätze aufzuzeigen. Es soll ein besseres Verständnis der Prozesse des Lesens vermittelt und Strategien zur Verbesserung der Lesekompetenz von DaF-Lernern aufgezeigt werden.
- Quote paper
- Martin Lehmannn (Author), 2005, Leseverständnis in der Zweitsprache und Strategien zur Verbesserung der Lesekompetenz für Nicht-Muttersprachler, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/53435