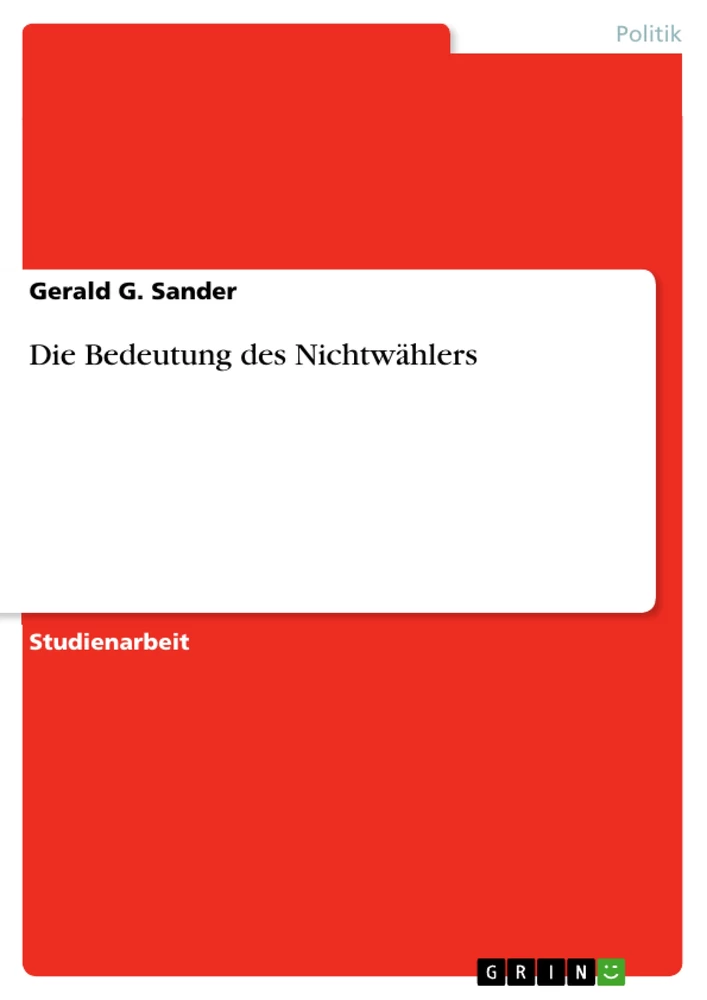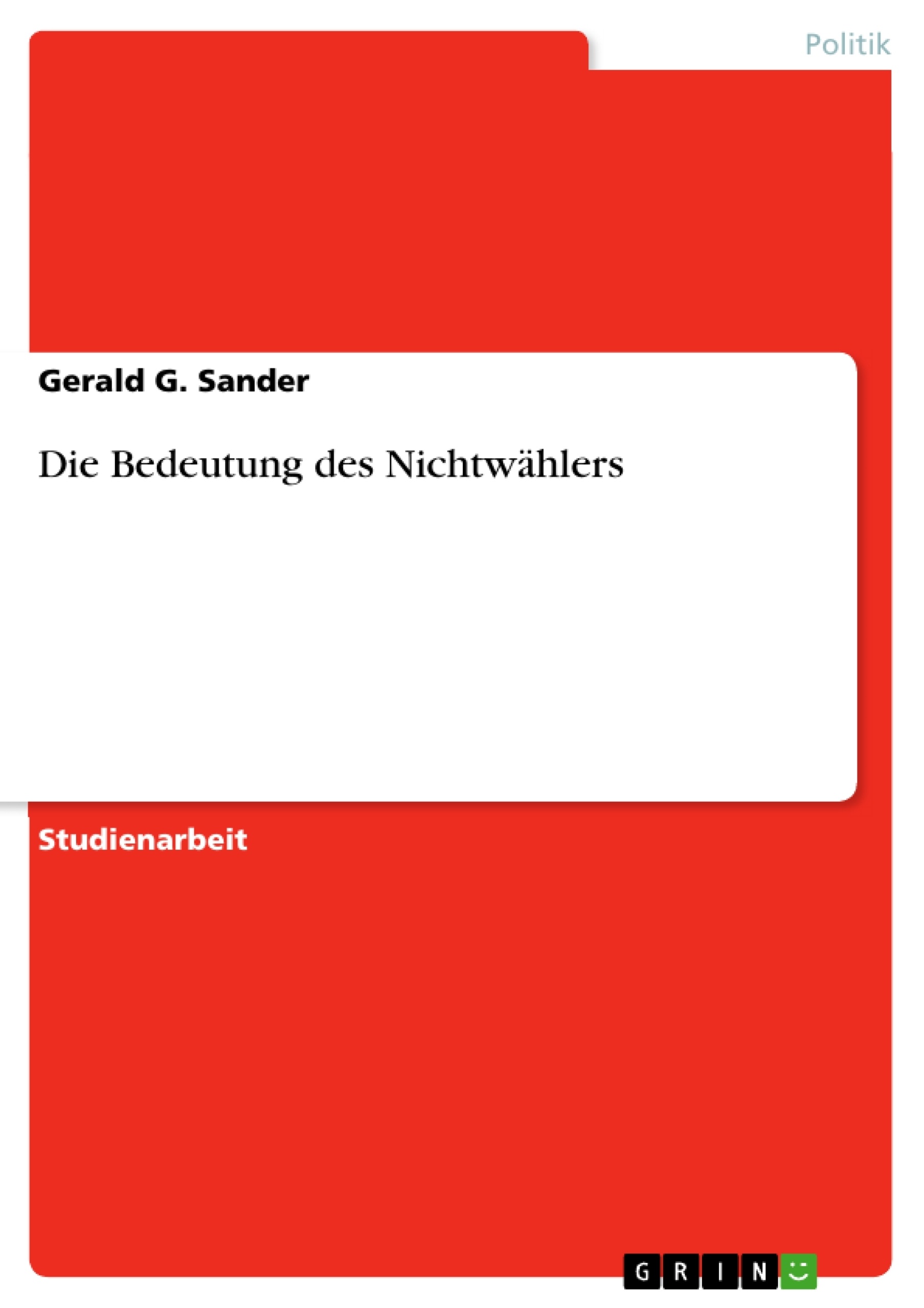Mit der Bundestagswahl 1991 hat die Wahlbeteiligung in der Bundesrepublik Deutschland ihren vorläufigen Tiefpunkt erreicht. Vieles spricht dafür, daß dieser Abwärtstrend noch einige Zeit anhalten wird. Die Politikverdrossenheit, oder besser die Parteiverdrossenheit weiter Kreise der Bevölkerung wird für diese Entwicklung verantwortlich gemacht. Alle Anzeichen sprechen dafür, daß sich in Deutschland, wie schon seit längerem in anderen westeuropäischen Staaten und den USA, die Wahlbeteiligung auf einem niedrigeren Niveau einpendeln wird und die Zeiten von Rekordwahlbeteiligungen endgültig vorbei sind.
Konkret findet diese Tendenz ihren Ausdruck darin, daß die "Partei der Nichtwähler"1bei den letzten Landtagswahlen in Bayern schon fast so stark war, wie die CSU, und bei der Bürgerschaftswahl 1991 in Hamburg sogar schon stärker als der Wahlsieger SPD. Die vorliegende Arbeit nimmt diese Entwicklung zum Anlaß, den "Nichtwähler" zu untersuchen. Es wird der Frage nachgegangen, in welcher Situation und unter welchen Umständen Wahlberechtigte ihre Stimmabgabe verweigern und was für verschiedene Grundtypen von Nichtwählern es gibt. Besonderes Augenmerk wird dabei auf den sog. "Protestnichtwähler" gelegt, den für die heutige Zeit wohl typischen Nichtwähler, der vielleicht bei anhaltender Frustration, am Ende sogar eine extreme Partei wählt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bedeutung und Auswirkungen der Wahlenthaltung
- Geschichte der Wahlbeteiligung in Deutschland
- Die Probleme bei der Erfassung von Nichtwählern
- Die Gründe für eine Wahlenthaltung
- Der unechte Nichtwähler
- Der Dauernichtwähler
- Der konjunkturelle Nichtwähler
- Die Prädispositionen für eine Wahlenthaltung
- Das Alter
- Das Geschlecht
- Die Konfession und Kirchgangshäufigkeit
- Der Sozialstatus und die Bildung
- Die Integration in die Gesellschaft
- Der Wohnort und die Wohndauer
- Die politischen Umstände
- Bedeutung der Wahl, Wahlmüdigkeit und Prognosen
- Wahlenthaltung aus Protest
- Der Systemgegner
- Denkzettel
- Der resignierte Nichtwähler
- Der moralisierende Nichtwähler
- Andere Einflüsse auf das Wahlverhalten
- Die Massenmedien
- Die Wahlkämpfe
- Die Wahlgesetze
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ursachen und Hintergründe der steigenden Wahlbeteiligung in der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere im Kontext der Bundestagswahl 1991. Sie analysiert verschiedene Typen von Nichtwählern und deren Motive, wobei der „Protestnichtwähler“ im Fokus steht.
- Analyse der Gründe für Wahlenthaltung
- Kategorisierung verschiedener Nichtwählertypen
- Untersuchung soziodemografischer Prädispositionen für Wahlenthaltung
- Einfluss politischer Umstände auf das Wahlverhalten
- Bedeutung von Massenmedien und Wahlkämpfen auf die Wahlbeteiligung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht den Anstieg der Nichtwählerzahlen in Deutschland nach der Bundestagswahl 1991 und deren Bedeutung für das politische System. Sie fokussiert auf die verschiedenen Motivationslagen der Nichtwähler und deren Typologisierung.
Bedeutung und Auswirkungen der Wahlenthaltung: Dieses Kapitel diskutiert die abnehmende Bedeutung der Wahlbeteiligung als Ausdruck von Staatsbürgerschaft. Es wird die Frage nach der Funktion von Wahlen beleuchtet: dienen sie primär der Machtzuweisung (output-orientiert) oder der Interessenvereinigung der gesamten Bevölkerung (input-orientiert)? Der Text zeigt, dass eine hohe Wahlbeteiligung nicht automatisch Systemstabilität bedeutet und eine hohe, durch Mobilisierung uninteressierter Bürger erreichte Wahlbeteiligung sogar systemgefährdend sein kann.
Geschichte der Wahlbeteiligung in Deutschland: Dieser Abschnitt skizziert die Entwicklung der Wahlbeteiligung in Deutschland vom Kaiserreich über die Weimarer Republik bis zur Bundesrepublik. Es wird deutlich, dass die Wahlbeteiligung im Laufe der Geschichte stark schwankte und in der Bundesrepublik nach einem Höhepunkt in den 1970er Jahren wieder abnimmt. Die unterschiedlichen Wahlbeteiligungen bei Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen werden ebenfalls angesprochen.
Die Probleme bei der Erfassung von Nichtwählern: Das Kapitel beschreibt die Schwierigkeiten bei der Erhebung von Daten zu Nichtwählern aufgrund von Datenschutzbestimmungen und der Geheimhaltung von Wahlentscheidungen. Es werden die Grenzen amtlicher Statistiken und Umfragen aufgezeigt, wobei der soziale Druck, öffentlich die Enthaltung zuzugeben, als Problematik hervorgehoben wird. Die eingeschränkten Möglichkeiten der Datenerhebung werden kritisch diskutiert.
Die Gründe für eine Wahlenthaltung: Hier werden verschiedene Motive für Wahlenthaltung kategorisiert. Der Text unterteilt die Nichtwähler in vier Kategorien (obwohl die Kategorien im gegebenen Auszug nicht detailliert definiert sind), um die Vielfalt der Gründe für die Enthaltung zu illustrieren. Es wird angedeutet, dass es sowohl persönliche als auch politische Gründe für das Nichtwählen gibt.
Schlüsselwörter
Nichtwähler, Wahlbeteiligung, Wahlenthaltung, Protestwähler, politische Partizipation, Wahlforschung, Deutschland, Parteiverdrossenheit, soziodemografische Faktoren, politische Systeme.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text über Wahlenthaltung in Deutschland
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text analysiert die Ursachen und Hintergründe der Wahlenthaltung in Deutschland, insbesondere im Kontext der Bundestagswahl 1991. Ein Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung verschiedener Nichtwählertypen und deren Motive, wobei der "Protestnichtwähler" im Fokus steht. Der Text bietet einen umfassenden Überblick, inklusive Einleitung, Inhaltsverzeichnis, Zielsetzung, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselbegriffen.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die Bedeutung und Auswirkungen von Wahlenthaltung, die Geschichte der Wahlbeteiligung in Deutschland, die Probleme bei der Erfassung von Nichtwählern, die Gründe für Wahlenthaltung (einschließlich der Unterscheidung verschiedener Nichtwählertypen wie unechte, dauerhafte und konjunkturelle Nichtwähler), soziodemografische Prädispositionen für Wahlenthaltung (Alter, Geschlecht, Konfession, Bildung, Sozialstatus, Wohnort), den Einfluss politischer Umstände (Wahlmüdigkeit, Protestwahlverhalten, verschiedene Protesttypen), und den Einfluss von Massenmedien und Wahlkämpfen auf das Wahlverhalten.
Welche Nichtwählertypen werden unterschieden?
Der Text unterscheidet verschiedene Nichtwählertypen, darunter den unechten Nichtwähler, den Dauernichtwähler und den konjunkturellen Nichtwähler. Im Kontext des Protestwahlverhaltens werden Systemgegner, Nichtwähler, die einen Denkzettel geben wollen, resignierte und moralisierende Nichtwähler unterschieden. Die genauen Definitionen dieser Typen werden im Text jedoch nicht detailliert ausgeführt.
Welche soziodemografischen Faktoren beeinflussen die Wahlenthaltung?
Der Text untersucht den Einfluss von Alter, Geschlecht, Konfession und Kirchgangshäufigkeit, Sozialstatus, Bildung, Integrationsgrad in die Gesellschaft sowie Wohnort und Wohndauer auf die Wahrscheinlichkeit der Wahlenthaltung.
Wie werden die Probleme bei der Erfassung von Nichtwählern beschrieben?
Der Text beschreibt die Schwierigkeiten bei der Datenerhebung zu Nichtwählern aufgrund von Datenschutzbestimmungen und der Geheimhaltung von Wahlentscheidungen. Amtliche Statistiken und Umfragen haben hier ihre Grenzen, und der soziale Druck, die Enthaltung öffentlich zuzugeben, wird als zusätzliche Problematik hervorgehoben.
Welche Rolle spielen politische Umstände und Massenmedien?
Der Text untersucht den Einfluss von politischen Umständen wie der Bedeutung der Wahl, Wahlmüdigkeit und Wahlprognosen auf die Wahlenthaltung. Auch die Rolle von Protestwahlverhalten und die Einflussnahme von Massenmedien und Wahlkämpfen auf die Wahlbeteiligung werden behandelt.
Welche Schlussfolgerungen zieht der Text?
Der Text zeigt, dass die Wahlenthaltung ein komplexes Phänomen ist, das durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst wird. Er betont die Schwierigkeiten bei der Erfassung und Analyse von Nichtwählerdaten und hebt die Bedeutung der Unterscheidung verschiedener Nichtwählertypen hervor. Der Text argumentiert, dass eine hohe Wahlbeteiligung nicht automatisch Systemstabilität bedeutet, und dass eine durch Mobilisierung uninteressierter Bürger erreichte hohe Wahlbeteiligung sogar systemgefährdend sein kann.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Text am besten?
Schlüsselwörter sind: Nichtwähler, Wahlbeteiligung, Wahlenthaltung, Protestwähler, politische Partizipation, Wahlforschung, Deutschland, Parteiverdrossenheit, soziodemografische Faktoren, politische Systeme.
- Quote paper
- Dr. Gerald G. Sander (Author), 1993, Die Bedeutung des Nichtwählers, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/53466