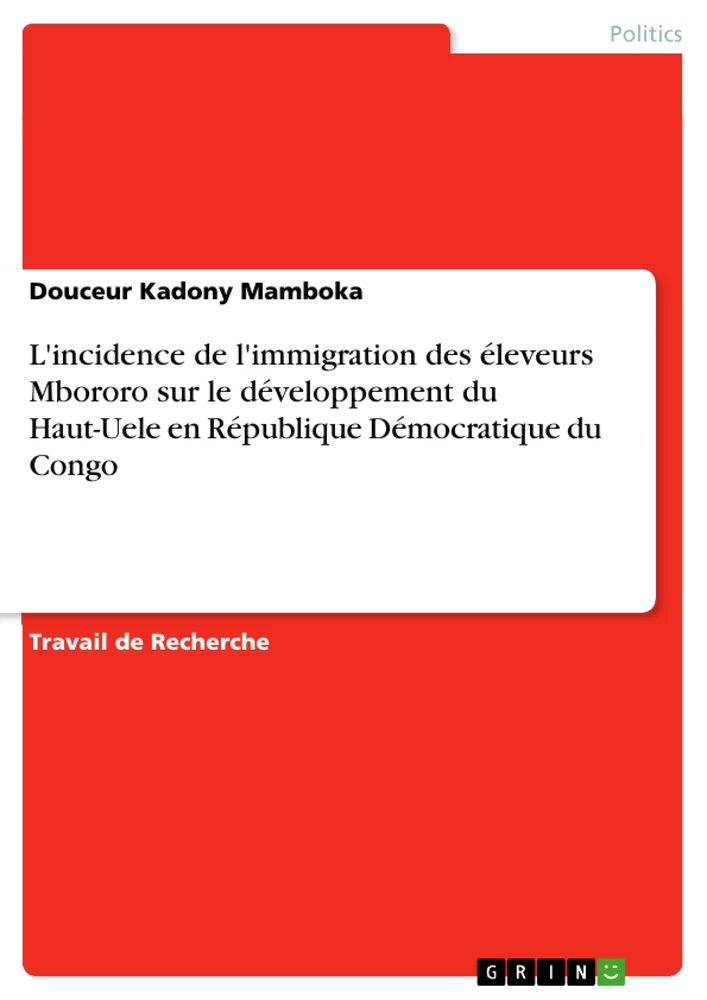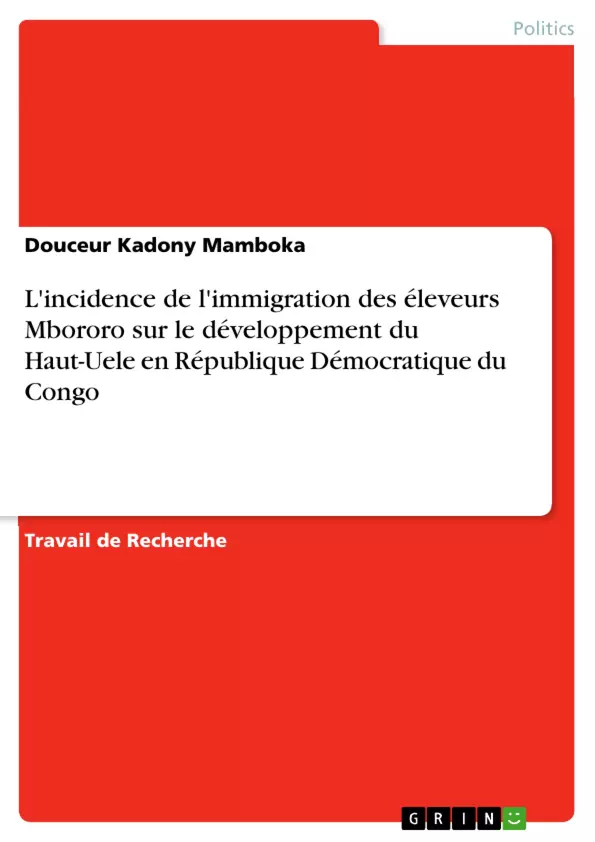Il sera la question de démontrer, dans cette étude, comment l’immigration des Mbororo est une obstruction au processus de développement du Haut-Uele sur le plan sécuritaire, économique, social et environnemental.
La question migratoire est actuellement au cœur des conférences internationales, au centre des préoccupations des gouvernements, au socle de débats scientifiques et politiques. En effet, en ce qui concerne la République Démocratique du Congo, elle a connu depuis plusieurs années des vagues des migrations transfrontalières des paternalistes nomades appelés Mbororo. Les Mbororo appartiennent au groupe des Peuls ou des Fulani, l’un des plus importants groupes ethniques d’Afrique occidentale. Ils vivent dans au moins 18 Etats notamment le Nigeria, le Niger, la Guinée, le Sénégal, le Mali, la Mauritanie, la République Centrafricaine, Cameroun.
Inhaltsverzeichnis
- Introduction
- Aperçu sur la province du Haut-Uele
- Les précisions sur ce que sont les Mbororo
- Croyancеs religieuses
- Activités économiques des Mbororo
- Schéma sociologique des Mbororo
- Système d'information primitif et efficace
- Chronologie de la pénétration des Mbororo sur le sol Hautuélien
- Pénétration des années 1940
- Pénétration des années 1980
- Pénétration actuelle
- Statut des Mbororo sur le sol hautuélien
- Les implications de l'immigration des Mbororo sur le développement de la province du Haut-Uele
- Les menaces sécuritaires présentes et futures
- Le Complot international
- L'ampleur des tensions sociales
- Le désastre économique
- La dégradation de l'environnement
- Pistes de solution pour l'éradication du phénomène Mbororo dans le Haut-Uele
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studie untersucht den Einfluss der Mbororo-Immigration auf die Entwicklung der Provinz Haut-Uele in der Demokratischen Republik Kongo. Ziel ist es, aufzuzeigen, ob und inwiefern diese Immigration zum Fortschritt der Provinz beiträgt oder ob sie eher negative Auswirkungen hat.
- Der Einfluss der Mbororo-Immigration auf die Sicherheit in der Provinz Haut-Uele.
- Die Auswirkungen der Weidewirtschaft der Mbororo auf die Umwelt und die Landwirtschaft.
- Die sozioökonomischen Folgen der Mbororo-Ansiedlung für die lokale Bevölkerung.
- Die Herausforderungen der Integration der Mbororo in die Gesellschaft der Provinz Haut-Uele.
- Mögliche Lösungsansätze zur Bewältigung der Probleme im Zusammenhang mit der Mbororo-Immigration.
Zusammenfassung der Kapitel
Introduction: Die Einleitung stellt die Thematik der Mbororo-Immigration in den Kontext internationaler Migrationsdebatten und fokussiert auf die spezifische Situation in der Provinz Haut-Uele. Sie formuliert die zentrale Forschungsfrage: Trägt die Mbororo-Immigration zur Entwicklung der Provinz bei, oder stellt sie ein Problem dar? Die Hypothese geht von negativen Auswirkungen aus.
Aperçu sur la province du Haut-Uele: Dieses Kapitel beschreibt die geographische Lage, die Größe, die Bevölkerung und die administrative Struktur der Provinz Haut-Uele. Es werden klimatische Bedingungen und die wirtschaftliche Grundlage der Region (Landwirtschaft, Viehzucht, Fischerei, Bergbau) erläutert. Die Beschreibung der natürlichen Gegebenheiten legt die Grundlage für das Verständnis der Anziehungskraft der Region für die Mbororo-Hirten.
Les précisions sur ce que sont les Mbororo: Dieses Kapitel beschreibt die Mbororo als Teil der größeren Peul-Gruppe, beleuchtet ihre Herkunft, ihre Lebensweise als Nomadenhirten und ihre starke Bindung an ihr Vieh. Die zentrale Bedeutung der Kühe für ihre Kultur und ihr Überleben wird hervorgehoben. Es wird der Unterschied zwischen sesshaften Peul und nomadischen Mbororo verdeutlicht.
Chronologie de la pénétration des Mbororo sur le sol Hautuélien: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Phasen der Mbororo-Immigration in die Provinz Haut-Uele, beginnend in den 1940er Jahren, über die 1980er Jahre bis hin zur aktuellen Situation. Es werden die jeweiligen Umstände der Zuwanderung und die Reaktionen der lokalen Bevölkerung skizziert, ohne jedoch konkrete Details der einzelnen Phasen preiszugeben.
Les implications de l'immigration des Mbororo sur le développement de la province du Haut-Uele: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen der Mbororo-Immigration auf die Entwicklung der Provinz. Es wird auf die negativen Folgen auf die Sicherheit, die Umwelt, die Wirtschaft und die sozialen Beziehungen eingegangen, ohne jedoch detailliert auf konkrete Konflikte einzugehen. Der Fokus liegt auf der Darstellung der vielschichtigen Problematik.
Pistes de solution pour l'éradication du phénomène Mbororo dans le Haut-Uele: Dieses Kapitel skizziert mögliche Lösungsansätze, um die Probleme zu lösen, die durch die Mbororo-Immigration entstanden sind. Die genauen Vorschläge werden jedoch nicht im Detail besprochen, um keine Lösungen vorwegzunehmen.
Schlüsselwörter
Immigration, Mbororo, Haut-Uele, Demokratische Republik Kongo, Entwicklung, Umwelt, Sicherheit, Konflikte, Nomaden, Viehzucht, Landwirtschaft, sozioökonomische Auswirkungen, Integration.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Einfluss der Mbororo-Immigration auf die Entwicklung der Provinz Haut-Uele
Was ist der Gegenstand dieser Studie?
Diese Studie untersucht den Einfluss der Immigration der Mbororo, einer nomadischen Hirtengruppe, auf die Entwicklung der Provinz Haut-Uele in der Demokratischen Republik Kongo. Sie analysiert sowohl positive als auch negative Auswirkungen dieser Immigration.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Themen: Eine Einführung in die Thematik, einen Überblick über die Provinz Haut-Uele, detaillierte Informationen über die Mbororo (ihre Lebensweise, Religion und Wirtschaftsaktivitäten), die Chronologie ihrer Immigration in die Provinz Haut-Uele, die Auswirkungen dieser Immigration auf die Sicherheit, die Umwelt, die Wirtschaft und die sozialen Beziehungen in der Region, sowie mögliche Lösungsansätze für die bestehenden Probleme.
Welche Ziele verfolgt die Studie?
Die Studie möchte aufzeigen, ob und inwiefern die Mbororo-Immigration zur Entwicklung der Provinz Haut-Uele beiträgt oder ob sie eher negative Auswirkungen hat. Sie analysiert den Einfluss auf Sicherheit, Umwelt, Wirtschaft und soziale Beziehungen.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in mehrere Kapitel gegliedert: Eine Einleitung, einen Überblick über die Provinz Haut-Uele, eine Beschreibung der Mbororo, die Chronologie ihrer Immigration, eine Analyse der Auswirkungen der Immigration und schließlich mögliche Lösungsansätze. Es enthält außerdem ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden angeboten?
Das Dokument bietet Zusammenfassungen für jedes Kapitel. Diese beschreiben kurz den Inhalt und die Schwerpunkte jedes Abschnitts. Die Zusammenfassungen geben einen Überblick über die behandelten Themen, ohne jedoch detaillierte Ergebnisse vorwegzunehmen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter, die den Inhalt des Dokuments beschreiben, sind: Immigration, Mbororo, Haut-Uele, Demokratische Republik Kongo, Entwicklung, Umwelt, Sicherheit, Konflikte, Nomaden, Viehzucht, Landwirtschaft, sozioökonomische Auswirkungen, Integration.
Welche konkreten Auswirkungen der Mbororo-Immigration werden analysiert?
Die Studie analysiert die Auswirkungen auf die Sicherheit (potentielle Konflikte), die Umwelt (durch Weidewirtschaft), die Wirtschaft (sozioökonomische Folgen für die lokale Bevölkerung) und die sozialen Beziehungen (Herausforderungen der Integration).
Welche Lösungsansätze werden vorgeschlagen?
Das Dokument skizziert mögliche Lösungsansätze für die durch die Mbororo-Immigration entstandenen Probleme. Konkrete Vorschläge werden jedoch nicht im Detail besprochen.
Wer ist die Zielgruppe dieses Dokuments?
Die Zielgruppe dieses Dokuments sind Personen, die sich akademisch mit dem Thema Migration, Entwicklung und sozioökonomischen Auswirkungen in Afrika auseinandersetzen, insbesondere im Kontext der Demokratischen Republik Kongo.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen Aspekten?
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Aspekten finden sich in den jeweiligen Kapiteln des vollständigen Dokuments. Die hier gegebenen Zusammenfassungen dienen lediglich als Überblick.
- Quote paper
- Douceur Kadony Mamboka (Author), 2020, L'incidence de l'immigration des éleveurs Mbororo sur le développement du Haut-Uele en République Démocratique du Congo, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/534836