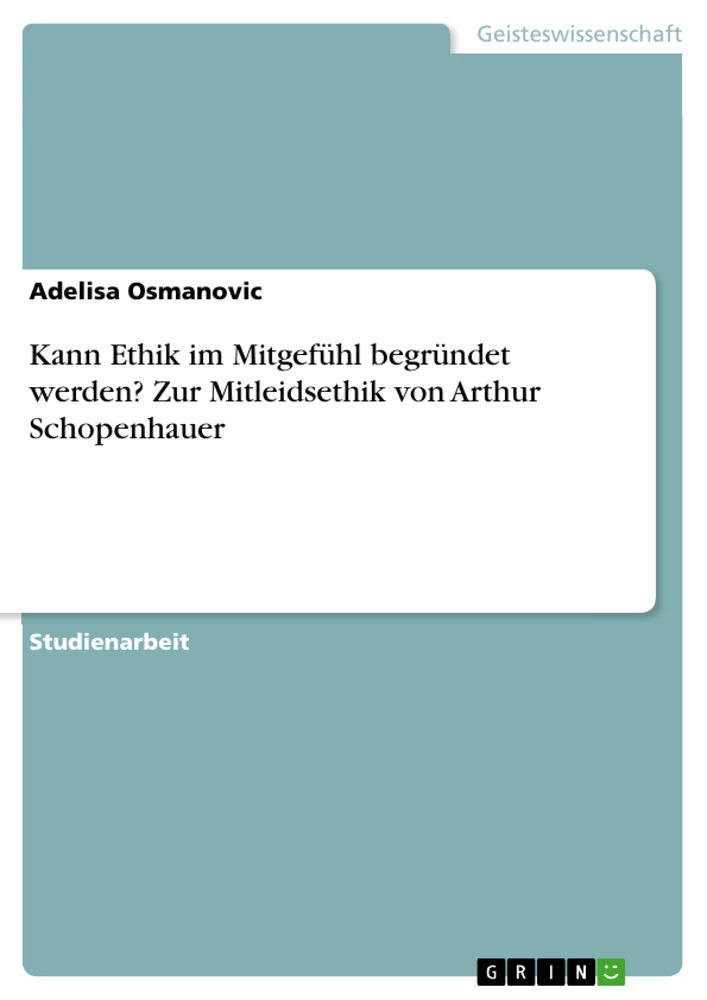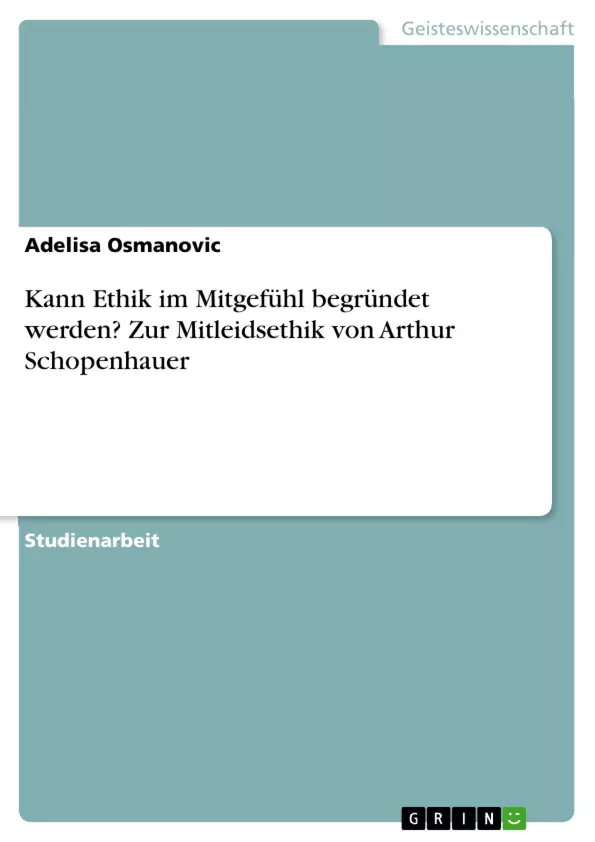Kann die Ethik überhaupt auf einem Gefühl des Mitleids basieren, in ihm sogar begründet werden? Gefühle sind zwar ein wesentlicher Bestandteil des Lebens; ein Leben ohne Gefühle ist unmöglich. Ist eine Handlung, die aus dem Gefühl des Mitleids geschieht, notwendig eine moralisch wertvolle? Darauf wird sich die leitende Frage dieser Seminararbeit beziehen.
Arthur Schopenhauer legt seine Ethik mit dem Begriff der Mitleidsethik in zwei Werken dar: Einerseits im vierten Buch der beiden Bände seines Hauptwerks "Die Welt als Wille und Vorstellung"; anderseits in zwei Preisschriften, nämlich in "Über die Freiheit des menschlichen Willens" und "Über die Grundlage der Moral". Am 30. Januar 1840 veröffentlichte Arthur Schopenhauer seine "Preisschrift zur Grundlage der Moral" als Antwort auf die von der Königlichen Dänischen Sozietät der Wissenschaften zu Kopenhagen gestellten Frage, was die Quelle und Grundlage der Moral denn überhaupt sei. Die Antwort darauf war das Mitleid. Schopenhauer hat in seiner Ethik nicht nur egoistische von moralisch wertvollen Handlungen abzugrenzen versucht, sondern gab ihr das Mitleid als Fundament, welches er auch noch metaphysisch begründete, um seine Ethik besonders standfest zu machen. Jedoch fand seine Preisschrift weder bei der Sozietät noch beim breiteren Publikum Zuspruch.
Die Arbeit wird wie folgt aufgebaut sein: Zuerst wird die Darstellung von Schopenhauers Mitleidsethik erfolgen. Im ersten Kapitel beschäftige ich mich mit dem Mitleid als Grundlage der Moral. Darauf aufbauend wird sich aus der Abgrenzung zu Kant die weitere Ausführung von Schopenhauers Ethik darstellen lassen. Es folgen somit Erläuterungen zu den beiden antimoralischen Triebfedern, unter denen er schließlich die einzige moralische Triebfeder ausfindig machen will. Nach dem Beweis der echten moralischen Triebfeder, der Untersuchung der beiden Kardinaltugenden und dem metaphysischen Erklärungsversuch der Ethik widme ich mich im zweiten Kapitel der Rolle des Gefühls in Schopenhauers Ethik.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schopenhauers Mitleidsethik
- Das Mitleid als Grundlage der Moral
- Abgrenzung zu Immanuel Kant
- Die beiden antimoralischen Triebfedern
- Handlungen von moralischem Wert
- Mitleid und Mitgefühl
- Die Rolle des Gefühls bei Schopenhauer
- Bewertung des Mitleids als moralisches Gefühl
- Das Mitleid als Grundlage der Moral
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert Schopenhauers Mitleidsethik und untersucht, ob diese als Basis für eine solide moralische Grundlage dienen kann. Dabei wird die Frage diskutiert, ob eine Handlung, die aus dem Gefühl des Mitleids entsteht, tatsächlich eine moralisch wertvolle Handlung ist.
- Schopenhauers Abgrenzung zu Kant und seine Kritik an dessen Ethik
- Die Rolle des Mitleids als moralische Triebfeder und dessen Abgrenzung zu egoistischen und bösen Motiven
- Die Bedeutung des Gefühls in Schopenhauers Ethik und dessen Verhältnis zur Vernunft
- Die Bewertung des Mitleids als moralisches Gefühl und dessen Auswirkungen auf das menschliche Handeln
- Die metaphysische Begründung Schopenhauers Ethik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Diese Arbeit befasst sich mit Arthur Schopenhauers Ethik, die er als Mitleidsethik bezeichnet. Sie untersucht die Grundlage seiner moralischen Philosophie und diskutiert die Rolle des Mitleids im Kontext seiner Werke.
Schopenhauers Mitleidsethik: Dieses Kapitel beleuchtet Schopenhauers Abgrenzung zu Immanuel Kant, wobei die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Philosophen hervorgehoben werden. Die beiden antimoralischen Triebfedern Egoismus und Bosheit werden erläutert und schließlich wird der Weg zu den Handlungen von moralischem Wert erörtert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Begriffen wie Mitleidsethik, Schopenhauer, Kant, Moral, Gefühl, Vernunft, Egoismus, Bosheit und Handlung. Darüber hinaus werden relevante Themen wie die metaphysische Grundlage von Ethik, die Abgrenzung von moralisch wertvollen und antimoralischen Motiven sowie die Rolle des Mitleids als moralische Triebfeder behandelt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Schopenhauers Mitleidsethik?
Schopenhauer sieht das Mitleid als die alleinige Quelle echter Moral, da es die Barriere zwischen Ich und Nicht-Ich vorübergehend aufhebt.
Wie grenzt sich Schopenhauer von Kant ab?
Während Kant Moral auf der Vernunft und dem kategorischen Imperativ begründet, lehnt Schopenhauer dies als abstrakt ab und setzt auf das unmittelbare Gefühl des Mitleids.
Was sind die antimoralischen Triebfedern nach Schopenhauer?
Schopenhauer nennt den Egoismus (das eigene Wohl) und die Bosheit (das fremde Wehe) als die Hauptantriebe, die moralischem Handeln entgegenstehen.
Sind Handlungen aus Mitleid immer moralisch wertvoll?
Für Schopenhauer ja, da sie die einzige Triebfeder sind, die nicht auf eigennützigen Motiven beruht.
Was ist die metaphysische Begründung seiner Ethik?
Sie basiert auf der Erkenntnis der Einheit des Willens: Der Leidende und der Mitleidende sind im tiefsten Wesen (dem Willen) identisch.
- Citar trabajo
- Adelisa Osmanovic (Autor), 2018, Kann Ethik im Mitgefühl begründet werden? Zur Mitleidsethik von Arthur Schopenhauer, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/534854