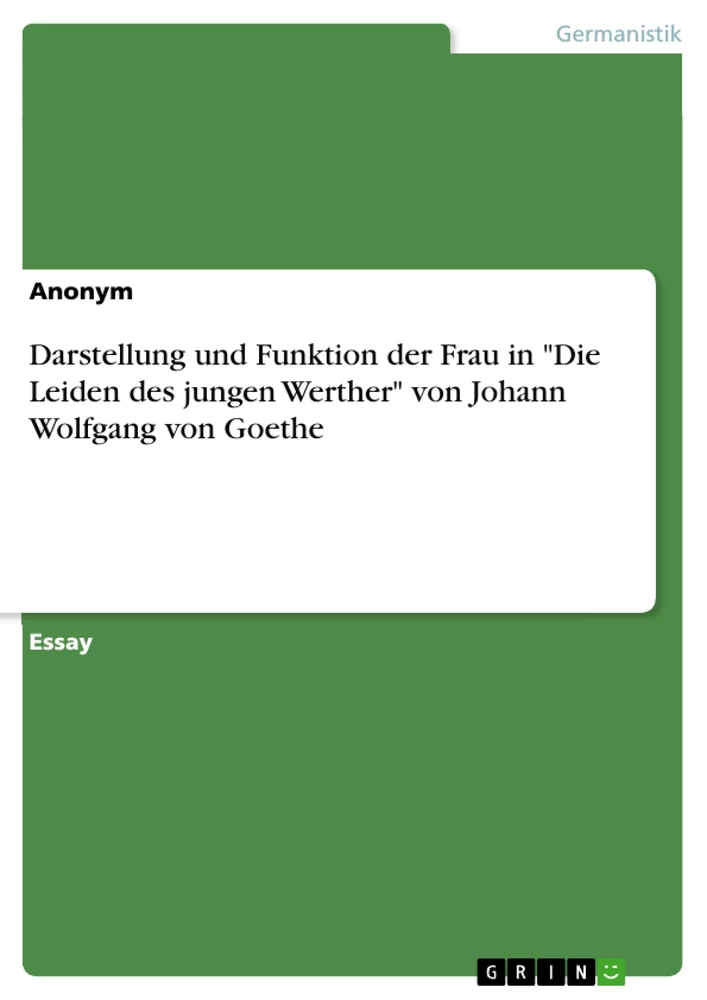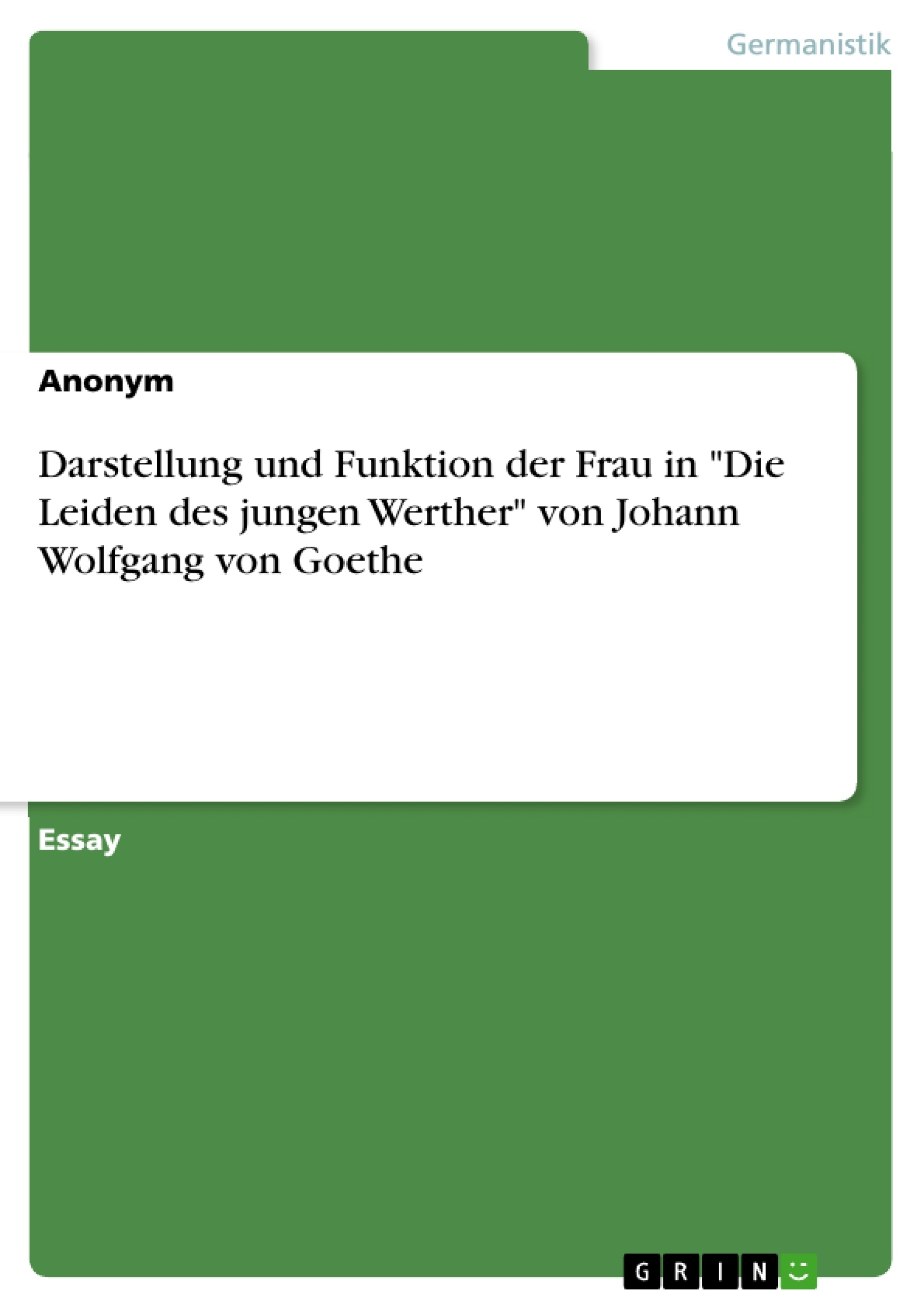Dieser Essay basiert auf einer sorgfältigen Lektüre des Briefromans "Die Leiden des jungen Werther" (1774) von Johann Wolfgang von Goethe und zielt darauf ab, die Darstellung und Funktion der weiblichen Hauptfigur Lotte aus einer genderspezifischen Perspektive nachzuvollziehen.
Da Werthers Begegnung mit Lotte und die unerfüllte Liebe zu ihr in seiner tragischen Selbsttötung endet, wird ihr eine entscheidende Bedeutung zuteil. Die Tatsache, dass es sich zudem um eine Frau handelt, wirft Fragen zur Inszenierung von Geschlechterverhältnissen auf. Die Leitfrage "Wer ist eigentlich Lotte?" soll bei der Herausbildung des weiblichen Subjekts dienlich sein. Das Wort "eigentlich" verweist auf die Ungewissheit darüber, ob Lotte eine eigene Subjektivität überhaupt zugebilligt werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Darstellung und Funktion der Frau in Die Leiden des jungen Werther von Johann Wolfgang von Goethe
- Werthers Begegnung mit Lotte und die unerfüllte Liebe zu ihr
- Die Inszenierung von Geschlechterverhältnissen
- Die Leitfrage „Wer ist eigentlich Lotte?\"
- Der Brief vom „16. Junius“ (W 20)
- Das fühlende, männlich codierte Subjekt
- Werthers Unvermögen, seine Empfindungen in Worte zu fassen
- Lotte als 'liebenswürdigstes Geschöpf' (W 20)
- Lotte als 'Engel' (W 20)
- Lottes „Einfalt bei so viel Verstand“ (W 20)
- Lotte als „reizendste Schauspiel“ (W 22)
- Lotte als „Mädchen von schöner Gestalt“ (W 22)
- Lotte als „weiße[s] Kleid“ (W 22)
- Lotte als „Frauenzimmer“ (W 21)
- Lottes „schwarzen Augen“ (W 25)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay analysiert die Darstellung und Funktion der weiblichen Hauptfigur Lotte in Goethes „Die Leiden des jungen Werther“ aus genderspezifischer Perspektive. Er befasst sich insbesondere mit dem Frage, ob Lotte eine eigene Subjektivität im Kontext der männlich codierten Erzählperspektive des Werthers zugestanden wird.
- Die Rolle der Frau in der männlich dominierten literarischen Welt des Sturm und Drangs
- Die Ambivalenz der Beschreibung Lottes durch Werther zwischen Idealismus und Realismus
- Die Analyse der Sprache und Bildsprache, die zur Konstruktion der Figur Lotte verwendet wird
- Die Verbindung zwischen Lottes Darstellung und den Geschlechterrollen des 18. Jahrhunderts
- Die Rezeption von Lottes Schönheit als ästhetisches Erlebnis und dessen Einfluss auf Werthers Selbstwahrnehmung
Zusammenfassung der Kapitel
Der Essay untersucht Werthers Brief vom „16. Junius“ (W 20), in dem die erste Begegnung mit Lotte beschrieben wird. Der Fokus liegt auf den sprachlichen und bildlichen Referenzen, die sich auf Lotte beziehen und die Funktion der Figur innerhalb der Erzählung verdeutlichen. Dabei wird die Unzuverlässigkeit des Erzählers Werther und seine Fixierung auf die idealisierte Figur Lotte hervorgehoben.
In weiteren Ausführungen werden Werthers Beschreibungen Lottes analysiert, wobei ihre „liebenswürdige“ (W 20) und „vollkommene“ (W 20) Natur, die sich durch einen Zusammenspiel von gegensätzlichen Polen auszeichnet, in den Vordergrund gestellt wird. Die Figur Lotte wird als eine „schöne Seele“ (vgl. Stephan) betrachtet, die eher ein Produkt dichterischer Imagination als ein realer Mensch darstellt.
Des Weiteren wird die Rolle des „Schauspiels“ (W 22) in der Darstellung Lottes untersucht, wobei auf ihre Konstruktion als Objekt des künstlerischen Schaffens und die Verbindung zwischen Kunst und Natur hingewiesen wird. Die Analogie zwischen Lotte und dem christlichen Messias wird durch die Szene der Brotverteilung an die Kinderschar (W 22) diskutiert. Die Analyse zeigt, wie Lotte dem Idealbild der bürgerlichen Frau entspricht, die sich um den privaten Raum kümmert und den Mann im öffentlichen Bereich unterstützt.
Schließlich werden Werthers Beschreibungen von Lottes „schwarzen Augen“ (W 25) und ihrer „lebendigen Lippen“ (W 25) als Ausdruck ihrer Schönheit analysiert, die Werther in einen Trancezustand versetzt und zur Bildung seines Selbstbewusstseins beiträgt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Konzepte des Essays umfassen die Analyse der Figur Lotte in Goethes „Die Leiden des jungen Werther“, die Rolle der Frau in der Literatur des Sturm und Drangs, die Konstruktion von Geschlechterrollen im 18. Jahrhundert, die Bedeutung der Sprache und Bildsprache für die Charakterisierung der Figur Lotte, die Funktion des Erzählers Werther, sowie die Rezeption von Lottes Schönheit als ästhetisches Erlebnis und dessen Einfluss auf Werthers Selbstwahrnehmung.
Häufig gestellte Fragen
Wer ist Lotte im Roman „Die Leiden des jungen Werther“?
Lotte ist die weibliche Hauptfigur, die von Werther idealisiert wird. Sie verkörpert das bürgerliche Ideal der Frau des 18. Jahrhunderts.
Wird Lotte als eigenständiges Subjekt dargestellt?
Kritische Analysen hinterfragen dies, da der Leser Lotte fast ausschließlich durch die subjektive und idealisierende Brille Werthers wahrnimmt.
Was bedeutet Lottes „Einfalt bei so viel Verstand“?
Es beschreibt die damals geschätzte Kombination aus natürlicher Unschuld und moralischer Klugheit, die Werther an ihr so fasziniert.
Welche Funktion hat die Szene der Brotverteilung?
Sie inszeniert Lotte in einer fast mütterlich-sakralen Rolle (Analogie zum Messias), die sich aufopferungsvoll um ihre Geschwister kümmert.
Wie spiegeln sich Geschlechterrollen des 18. Jahrhunderts wider?
Lotte ist auf den privaten, häuslichen Raum begrenzt, während Werther als fühlendes, aber im öffentlichen Raum scheiterndes männliches Subjekt agiert.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Darstellung und Funktion der Frau in "Die Leiden des jungen Werther" von Johann Wolfgang von Goethe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/534875