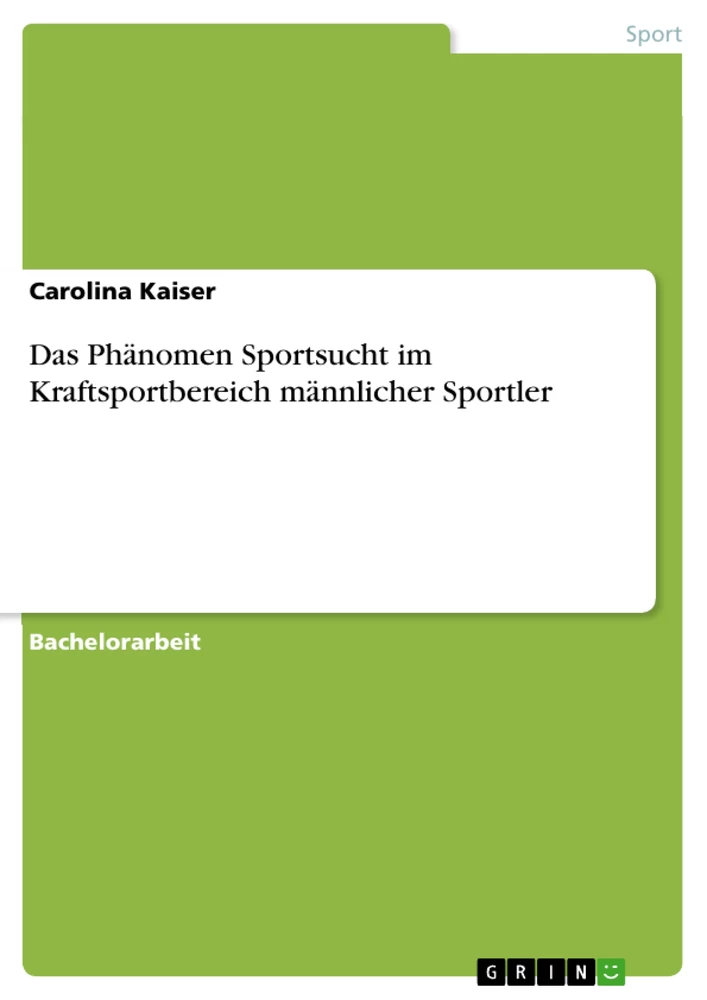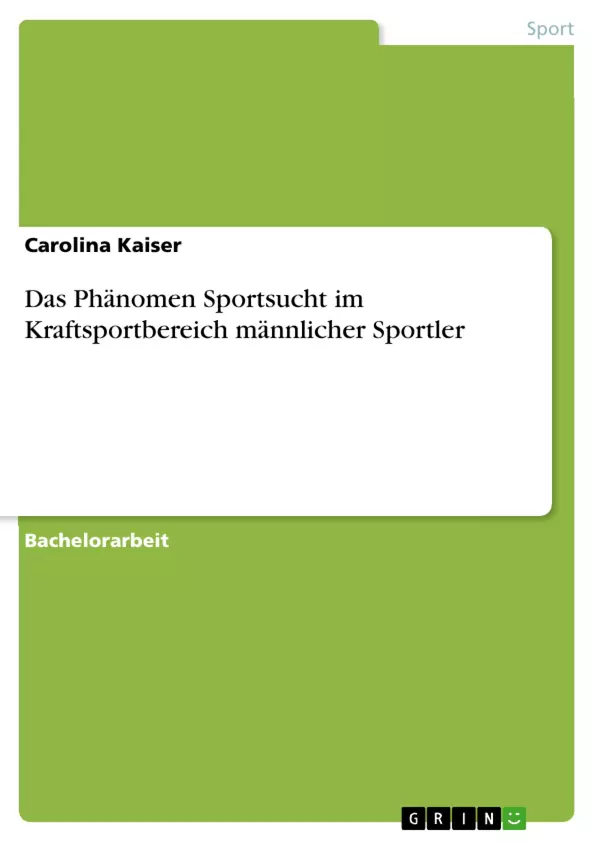Ist Sportsucht nur ein Mythos beziehungsweise bloß eine Begleiterscheinung klinisch eingetragener Krankheitsbilder, wie beispielsweise Magersucht? Wo liegen die Grenzen hinsichtlich einer Sportbindung zu einer manifestierten Sucht? Diese und weitere Fragen sollen in der vorliegenden Arbeit untersucht werden.
Das noch uneinheitlich erforschte Thema der primären Sportsucht stellt derzeit ein hochaktuelles Feld der Sportwissenschaft dar. Bei der primären Sportsucht handelt es sich nach Rasche um „suchtartige[s] Verlangen nach sportlicher Betätigung, [was] sich in unkontrolliertem, exzessivem Trainingsverhalten äußert“. Der Fortschritt an Forschungen und Studien nahm vor allem im Bereich des Laufens enorm zu, ließ jedoch andere Sportarten weitestgehend außer Acht, sodass der Forschungsbestand in diesen Bereichen eher spärlich ausfällt. Demnach sollen in der vorliegenden Arbeit weitere Erkenntnisse hinsichtlich dieses Störungsbildes herausgestellt werden. Im Fokus steht dabei der Kraftsport, welcher eine hohe Präsenz in den Fitnesscentern zeigt und somit einen interessanten Forschungsgegenstand bezüglich sportsüchtigen Verhaltens bietet.
Bereits bei der Abgrenzung der Begriffe „Sucht“ und „Abhängigkeit“ wird deutlich, dass die Vielfalt an Definitionen und Beschreibungen kaum einen gemeinsamen Konsens zulässt und weiterhin Diskussionsstoff bietet. Auch Formen der Verhaltenssucht sind bislang kaum charakterisiert oder eindeutig beschrieben, wodurch die Sportsucht nicht als eigenständiges Krankheitsbild in den internationalen Klassifikationssystemen psychischer Störungen aufgenommen werden kann und Wege zu diagnostischen Schlüssen und den darauffolgenden Therapiemaßnahmen versperrt bleiben. Dennoch wird von Parallelen zwischen einer Verhaltenssucht und stoffgebundenen Abhängigkeiten gesprochen. Diese spiegeln sich im Hergang und im Verlauf der Sucht sowie in Überschneidungen diagnostischer Merkmale wieder.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretischer Bezugsrahmen
- 2.1 Begriffsklärung
- 2.1.1 Sucht und Abhängigkeit
- 2.1.2 Verhaltenssucht
- 2.1.3 Sportsucht
- 2.2 Ursachen und Entwicklung einer Sportsucht
- 2.2.1 ,,Hedonic Management Model of Addiction\" nach Brown
- 2.2.2 Allgemeines Prozessmodell nach Breuer und Kleinert
- 2.2.3 Modell zur Sportsuchtentwicklung nach Knobloch, Allmer und Schack
- 2.3 Diagnostik
- 2.4 Therapieansätze
- 2.5 Forschungsfragen
- 3 Empirischer Teil
- 3.1 Methode
- 3.1.1 Untersuchungsplan
- 3.1.2 Stichprobe
- 3.1.3 Untersuchungsdurchführung
- 3.2 Ergebnisse
- 3.2.1 Auswertung
- 4 Diskussion
- 5 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit widmet sich dem Phänomen der Sportsucht im Kraftsportbereich männlicher Sportler. Ziel ist es, das Phänomen im Kontext der Verhaltenssucht zu beleuchten und die Besonderheiten im Vergleich zu anderen Formen der Sportsucht zu untersuchen. Hierfür werden die relevanten theoretischen Grundlagen herangezogen und anhand von Interviews mit Kraftsportlern empirische Erkenntnisse gewonnen.
- Definition und Abgrenzung der Begriffe „Sucht“ und „Abhängigkeit“ im Kontext von Sportsucht
- Analyse der Ursachen und Entwicklung einer Sportsucht im Kraftsportbereich
- Identifizierung von diagnostischen und therapeutischen Ansätzen im Umgang mit Sportsucht
- Untersuchung der Beweggründe und Auslöser von süchtigem Verhalten im Kraftsport
- Empirische Erfassung von Hinweisen auf eine Tendenz zu süchtigem Verhalten bei männlichen Kraftsportlern.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Phänomen der Sportsucht im Kontext der aktuellen Sportkultur und den Wandel des Sportverständnisses thematisiert. Dabei wird die Relevanz der Untersuchung von Sportsucht im Kraftsportbereich männlicher Sportler hervorgehoben.
Der theoretische Bezugsrahmen beleuchtet die Begrifflichkeiten „Sucht“ und „Abhängigkeit“ im Kontext von Sportsucht und beschreibt verschiedene Modelle zur Entstehung und Entwicklung einer Sportsucht. Darüber hinaus werden diagnostische und therapeutische Ansätze vorgestellt.
Der empirische Teil der Arbeit erläutert die Methodik der Untersuchung, die auf Interviews mit Kraftsportlern basiert, und präsentiert die Ergebnisse der Auswertung der Interviews.
Abschließend erfolgt eine Diskussion der Ergebnisse und eine Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse.
Schlüsselwörter
Sportsucht, Kraftsport, Verhaltenssucht, Hedonic Management Model of Addiction, Prozessmodell, Diagnostik, Therapie, Interview, männliche Sportler.
Häufig gestellte Fragen
Was ist primäre Sportsucht?
Es handelt sich um ein suchtartiges Verlangen nach sportlicher Betätigung, das sich in unkontrolliertem und exzessivem Trainingsverhalten äußert.
Warum wird Sportsucht oft nicht als eigenständiges Krankheitsbild anerkannt?
Da Formen der Verhaltenssucht bislang schwer eindeutig zu charakterisieren sind, fehlt sie oft in internationalen Klassifikationssystemen wie dem ICD.
Welche Parallelen gibt es zwischen Sportsucht und Drogensucht?
Beide zeigen Ähnlichkeiten im Hergang, Verlauf und in diagnostischen Merkmalen wie Toleranzentwicklung und Entzugserscheinungen.
Warum steht der Kraftsport im Fokus dieser Untersuchung?
Kraftsport hat eine hohe Präsenz in Fitnesscentern und bietet einen interessanten Forschungsgegenstand für sportsüchtiges Verhalten bei Männern.
Welche Modelle erklären die Entstehung von Sportsucht?
Die Arbeit nennt unter anderem das „Hedonic Management Model of Addiction“ nach Brown und das Prozessmodell nach Breuer und Kleinert.
- Citation du texte
- Carolina Kaiser (Auteur), 2013, Das Phänomen Sportsucht im Kraftsportbereich männlicher Sportler, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/534892