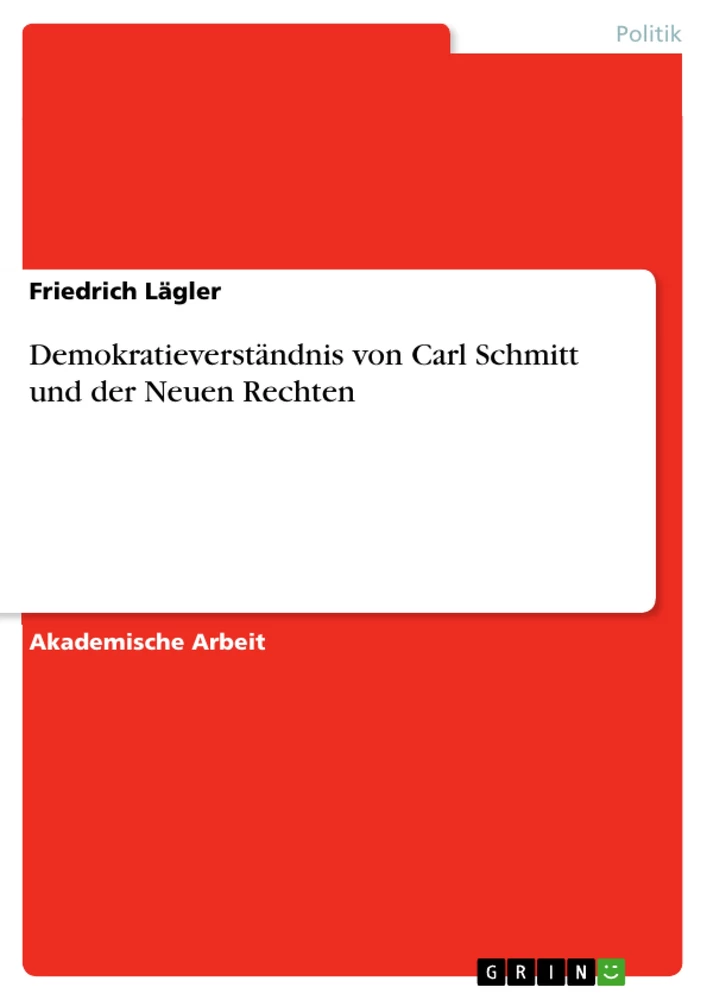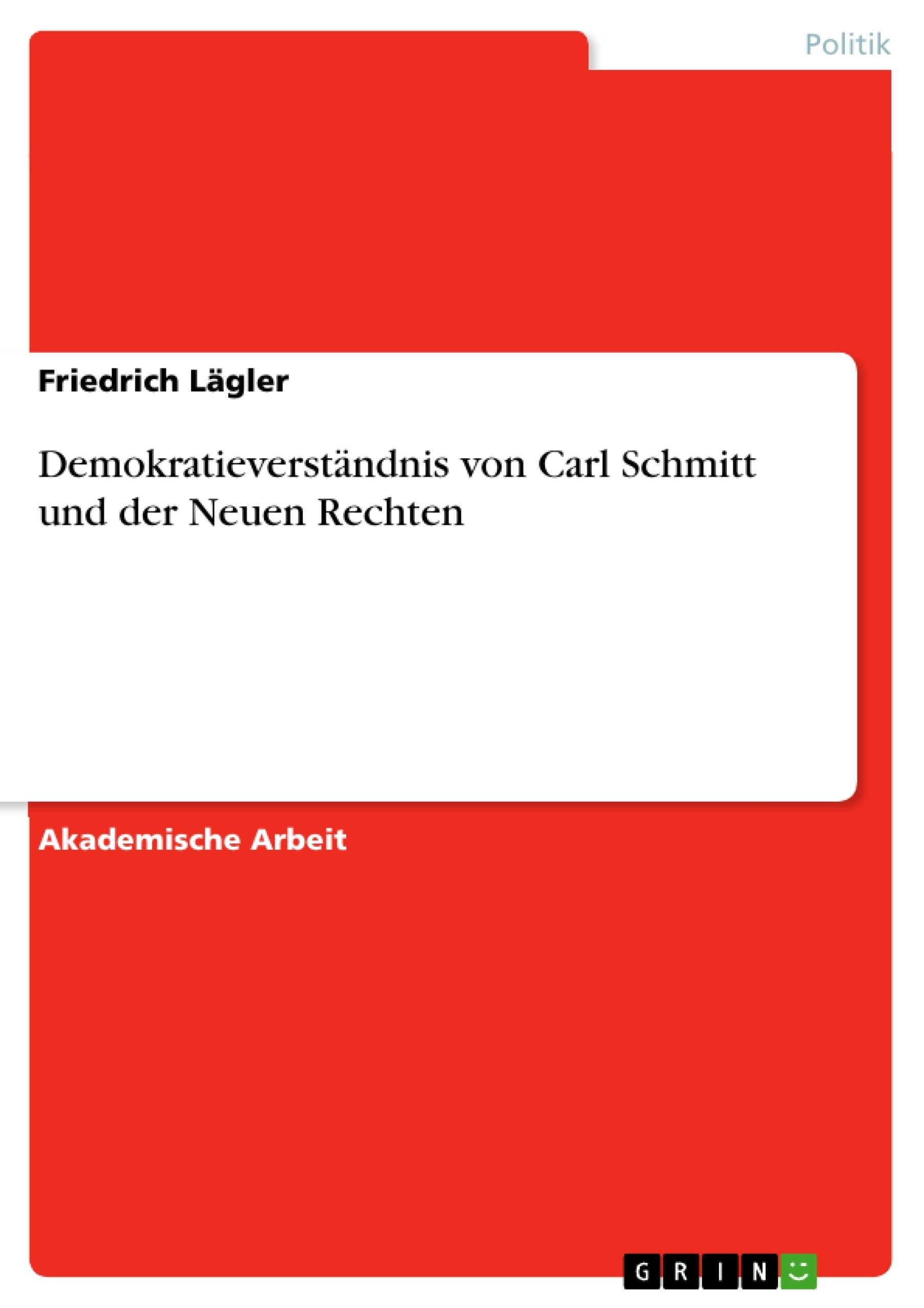Das Ziel dieser Arbeit ist es, die ideenhistorischen Verbindungen zwischen der Neuen Rechten und dem "Kronjuristen der Nazis" aufzudecken. Die Hypothese ist, dass die Neuen Rechten Schmitts Gedanken in einem neuen Gewand verkaufen. Schmitts Ideen verstoßen nach heutiger Betrachtung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland. Die Frage ist, in wie weit die Neuen Rechten Schmitts verfassungsfeindliche und rassistische Ideen aufnehmen und somit zu einer echten Gefahr für die moderne Demokratie werden.
Die vorliegende Untersuchung wird mit Hilfe der Entwicklungspfade zu einem Grundbegriff von Demokratie von Eike-Christian Hornig ausgearbeitet. Hornigs Entwicklungspfade sollen allerdings lediglich als Arbeitsgrundlage dienen und nur in formaler Hinsicht für die Untersuchung der Demokratieverständnisse fruchtbar gemacht werden. Die drei Elemente - partizipativ, konstitutionell, repräsentativ – sind keine Bewertungsskalen, sondern sollen die Untersuchung strukturieren. Aufbauend auf Hornigs Demokratieelemente fokussiert sich die Arbeit zunächst auf Schmitts Politik- und Demokratieverständnis. Schmitts Ausführungen zur Demokratie hängen stark mit seiner politischen Einstellung zusammen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Thematische Hinführung
- 2. Theoretische Grundlage von Demokratie anhand von Hornigs Grundbegriff Demokratie
- 3. Carl Schmitt und die Demokratie
- 3.1. Schmitts Politikverständnis
- 3.2. Schmitts Demokratieverständnis
- 3.3. Schmitt zu Parlamentarismus
- 3.4. Exkurs: Schmitt zu Liberalismus
- 4. Die Neuen Rechten und die Demokratie
- 4.1. Exkurs: Ethnopluralismus
- 4.2. Demokratieverständnis der Neuen Rechte
- 5. Carl Schmitt und die Neuen Rechten
- 6. Schlussfolgerung
- 7. Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die ideengeschichtlichen Verbindungen zwischen dem Demokratieverständnis von Carl Schmitt und den Neuen Rechten. Ziel ist es aufzuzeigen, inwiefern die Neuen Rechten Schmitts Ideen in einem neuen Gewand präsentieren und ob diese eine Gefahr für die moderne Demokratie darstellen. Die Arbeit analysiert Schmitts Schriften und Publikationen der Neuen Rechten, um diese Hypothese zu überprüfen.
- Schmitts Politik- und Demokratieverständnis
- Das Demokratieverständnis der Neuen Rechten
- Ideengeschichtliche Verbindungen zwischen Schmitt und den Neuen Rechten
- Die Relevanz von Schmitts Denken für die aktuelle politische Landschaft
- Die potenzielle Gefährdung der Demokratie durch die Neuen Rechten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Thematische Hinführung: Dieses einleitende Kapitel beleuchtet den scheinbaren Widerspruch zwischen dem Bekenntnis der Neuen Rechten zur Demokratie und deren tatsächlichen Zielen. Es wird auf die strategische Nutzung des demokratischen Systems durch Rechtspopulisten und Rechtsextremisten hingewiesen, um dieses letztendlich zu beseitigen. Der Aufstieg der AfD wird als Beispiel genannt, und die Notwendigkeit, das Demokratieverständnis von Volksvertretern zu untersuchen, wird betont. Schließlich wird Carl Schmitt als einflussreicher Staatstheoretiker vorgestellt, dessen ideengeschichtlicher Einfluss auf die Neuen Rechten im Mittelpunkt der Arbeit steht. Der Begriff "Demokratie" wird kritisch hinterfragt, und die Notwendigkeit einer präzisen Definition wird hervorgehoben, wobei verschiedene Aspekte wie Volksherrschaft, Rechtsstaatlichkeit und Repräsentation diskutiert werden.
2. Theoretische Grundlage von Demokratie anhand von Hornigs Grundbegriff Demokratie: Dieses Kapitel etabliert die theoretische Grundlage der Arbeit mit Hilfe des Demokratiebegriffs von Eike-Christian Hornig. Hornigs drei Entwicklungspfade – partizipativ, konstitutionell und repräsentativ – dienen als analytisches Raster, um verschiedene Demokratieverständnisse zu untersuchen. Obwohl sie nicht als Bewertungskriterien verwendet werden, strukturieren sie die Analyse der Demokratieverständnisse von Schmitt und den Neuen Rechten. Das Kapitel betont den Bedeutungswandel des Demokratiebegriffs von der Antike bis zur Gegenwart und die Notwendigkeit einer praxistauglichen Definition.
3. Carl Schmitt und die Demokratie: Dieser Abschnitt widmet sich eingehend Carl Schmitts Verständnis von Politik und Demokratie. Seine Schriften werden analysiert, wobei die enge Verknüpfung seiner Demokratievorstellungen mit seinen politischen Einstellungen herausgestellt wird. Die Schwierigkeiten, Schmitts Ansichten klar in Hornigs drei Entwicklungspfade einzuordnen, werden deutlich gemacht. Die Kapitel 3.1-3.4 behandeln verschiedene Facetten seines Denkens, einschließlich seiner Ansichten zu Parlamentarismus und Liberalismus.
4. Die Neuen Rechten und die Demokratie: In diesem Kapitel werden die Neuen Rechten vorgestellt, wobei auf die einflussreichen Akteure und Medienhäuser hingewiesen wird. Die Analyse basiert auf der Auswertung von Publikationen aus der intellektuellen Szene der Neuen Rechten. Besonderes Augenmerk liegt auf deren Verständnis von Demokratie und den potentiellen Einflüssen von Schmitts Denken auf ihre Ideologie. Der Exkurs zu Ethnopluralismus im Unterkapitel 4.1 beleuchtet einen wichtigen Aspekt ihrer politischen Positionierung.
5. Carl Schmitt und die Neuen Rechten: Dieses Kapitel synthetisiert die vorherigen Analysen und untersucht die ideengeschichtlichen Verbindungen zwischen Schmitt und den Neuen Rechten. Es wird untersucht, inwieweit die Neuen Rechten Schmitts Ideen adaptieren und in ein neues Gewand kleiden. Der Fokus liegt auf der Frage, ob diese Adaption eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung darstellt.
Schlüsselwörter
Demokratie, Carl Schmitt, Neue Rechte, Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, Volksherrschaft, Parlamentarismus, Identitäres Demokratieverständnis, Staatstheorie, freiheitlich-demokratische Grundordnung, Ethnopluralismus, Konstitutionalismus, Partizipation, Repräsentation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Carl Schmitt und die Neuen Rechten
Was ist das Thema der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die ideengeschichtlichen Verbindungen zwischen dem Demokratieverständnis von Carl Schmitt und den Neuen Rechten. Sie analysiert, inwiefern die Neuen Rechten Schmitts Ideen adaptieren und ob dies eine Gefahr für die moderne Demokratie darstellt.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit analysiert Schriften von Carl Schmitt und Publikationen der Neuen Rechten, um die Hypothese einer ideengeschichtlichen Verbindung zu überprüfen. Ein genaueres Quellenverzeichnis findet sich im siebten Kapitel der Arbeit.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, aufzuzeigen, wie die Neuen Rechten Schmitts Ideen möglicherweise in einem neuen Gewand präsentieren und ob diese eine Bedrohung für die moderne Demokratie darstellen. Sie untersucht Schmitts Politik- und Demokratieverständnis, das Demokratieverständnis der Neuen Rechten und die ideengeschichtlichen Verbindungen zwischen beiden.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: 1. Thematische Hinführung, 2. Theoretische Grundlage von Demokratie anhand von Hornigs Grundbegriff, 3. Carl Schmitt und die Demokratie, 4. Die Neuen Rechten und die Demokratie, 5. Carl Schmitt und die Neuen Rechten, 6. Schlussfolgerung und 7. Quellenverzeichnis. Kapitel 3 und 4 sind weiter untergliedert.
Wie wird der Demokratiebegriff in der Arbeit definiert?
Die Arbeit verwendet Hornigs drei Entwicklungspfade des Demokratiebegriffs (partizipativ, konstitutionell, repräsentativ) als analytisches Raster. Der Begriff „Demokratie“ wird kritisch hinterfragt und verschiedene Aspekte wie Volksherrschaft, Rechtsstaatlichkeit und Repräsentation werden diskutiert. Die Notwendigkeit einer präzisen Definition wird hervorgehoben.
Welche Rolle spielt Carl Schmitt in der Arbeit?
Carl Schmitt wird als einflussreicher Staatstheoretiker vorgestellt, dessen ideengeschichtlicher Einfluss auf die Neuen Rechten im Mittelpunkt der Arbeit steht. Die Arbeit analysiert Schmitts Politik- und Demokratieverständnis eingehend und untersucht, wie seine Ideen von den Neuen Rechten möglicherweise rezipiert und adaptiert werden.
Was ist die Bedeutung des Kapitels über die Neuen Rechten?
Dieses Kapitel präsentiert die Neuen Rechten, ihre einflussreichen Akteure und Medien, sowie deren Demokratieverständnis. Es analysiert Publikationen aus der intellektuellen Szene der Neuen Rechten und untersucht den möglichen Einfluss von Schmitts Denken auf ihre Ideologie. Ein Exkurs beleuchtet den Ethnopluralismus als wichtigen Aspekt ihrer politischen Positionierung.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
(Der Inhalt der Schlussfolgerung wird in der Zusammenfassung der Kapitel nicht explizit genannt und muss aus der vollständigen Seminararbeit entnommen werden.)
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Demokratie, Carl Schmitt, Neue Rechte, Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, Volksherrschaft, Parlamentarismus, Identitäres Demokratieverständnis, Staatstheorie, freiheitlich-demokratische Grundordnung, Ethnopluralismus, Konstitutionalismus, Partizipation, Repräsentation.
- Citar trabajo
- Friedrich Lägler (Autor), 2018, Demokratieverständnis von Carl Schmitt und der Neuen Rechten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/535068