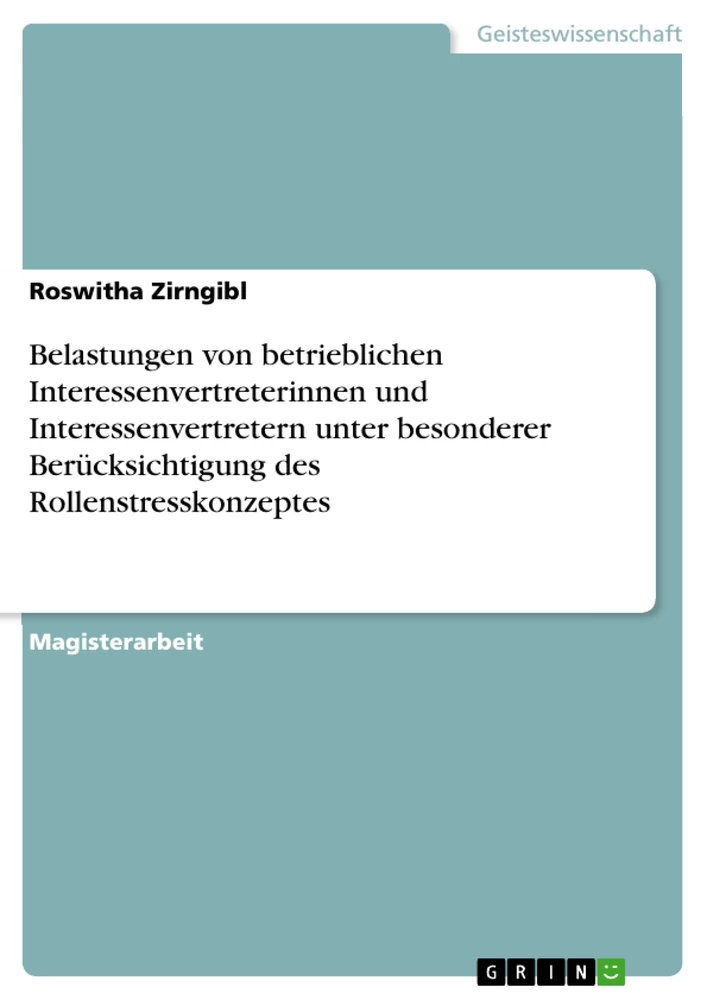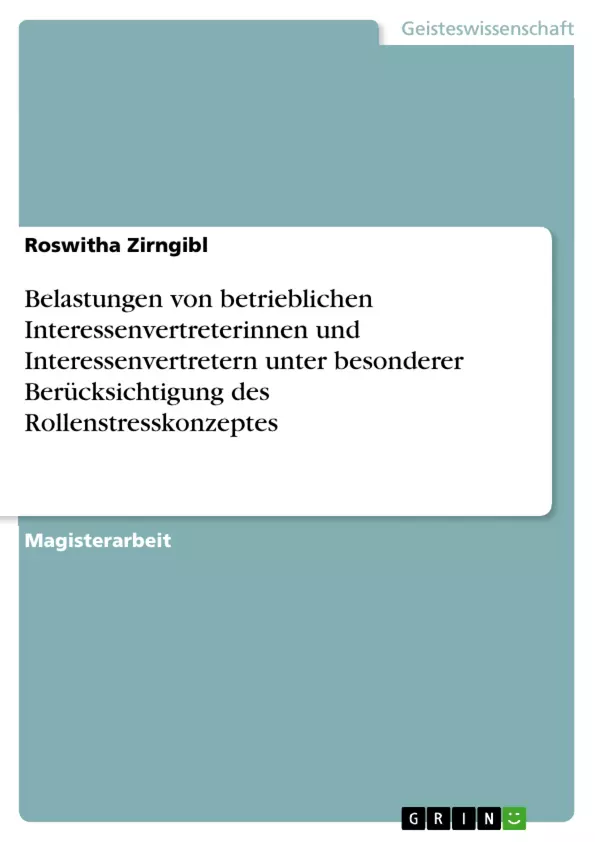Die Interessenvertretung auf betrieblicher Ebene begründet sich in der Bundesrepublik Deutschland auf der materiellen Rechtsgrundlage des Betriebsverfassungsgesetzes. Darin wird die Betriebsratsarbeit als Interessenvertretung bzw. als betriebliche Mitbestimmung verstanden, ein Muster, das auf das Betriebsrätegesetz von 1920 zurückgreift und sich von ihrer institutionellen Form von den Ausprägungen anderer europäischer Industrienationen - so vor allem England mit seinem „collective bargaining“, die den Gewerkschaften bzw. Unions in den Betrieben eine stärkere Handlungsmacht zubilligt (Kotthoff, 1981), unterscheidet. Als 1952 die erste Fassung des Betriebsverfassungsgesetzes rechtskräftig wurde, blieb der Protest der Gewerkschaften nicht aus, welche sich nicht zuletzt durch die Erfahrung der Zerschlagung der Gewerkschaften während der NS-Diktatur eine Stärkung ihrer Position in einer neu geordneten Wirtschaft nach 1945 erhofften (Schneider, 2000). Betriebsratstätigkeit heute ist de jure gewerkschaftsunabhängig und basiert auf den sozialpartnerschaftlichen Idealen der Zusammenarbeit zwischen den zu vertretenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, sowie der Arbeitgeberseite andererseits. Der Betriebsrat wird per legem in eine umfassende Friedenspflicht eingebunden und zur vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber verpflichtet, während die Grundelemente der unternehmerischen Freiheit in Form von wirtschaftlicher Entscheidungsfreiheit und Führung erhalten bleiben (Schneider, 2000). Das Betriebsverfassungsgesetz wurde nach 1952 noch zweimal novelliert. Mit der letzten Reformierung im Jahre 2001 waren von gewerkschaftlicher Seite große Hoffnungen geknüpft in Form einer erweiterten Mitbestimmungsmöglichkeit und einer rechtlichen Anpassung an die veränderten wirtschaftlichen und organisatorischen Strukturen von heute (Heilmann, 2001). Ob und inwieweit dies gelungen ist, wird auch in juristischen Kreisen konträr diskutiert (vgl. Richardi, 2001).
Inhaltsverzeichnis
- A. Einführung in das Thema
- 1. Einleitung
- 2. Rahmenbedingungen der Arbeit von betrieblichen Interessenvertreterinnen und Interessenvertretern
- 2.1. Die Organisation des Betriebsrates
- 2.2. Die Aufgaben der betrieblichen Interessenverterinnen und Interessenvertreter
- 2.2.1. Beteiligung in sozialen Angelegenheiten
- 2.2.2. Beteiligung in personellen Angelegenheiten
- 2.2.3. Beteiligung in wirtschaftlichen Angelegenheiten
- 2.2.4. Betriebliche Interessenvertretung vor neuen Aufgaben
- 2.3. Betriebliche Interessenvertretung als Forschungsobjekt
- 2.4. Diskutierte spezifische Belastungen von betrieblichen Interessenvertreterinnen und Interessenvertretern
- 2.5. Anmerkungen zur Rollenkonzeption
- 2.6. Zielsetzung der empirischen Untersuchung im Rahmen der Magisterarbeit
- B. Theoretischer Hintergrund/Modelle
- 3. Begriffsdefinitionen: Belastung, Beanspruchung, Stress
- 3.1. Stresstheoretische Konzepte
- 3.1.1. Reaktionszentrierte Stresstheorien
- 3.1.2. Reizzentrierte Stresstheorien
- 3.1.3. Transaktionale Stresstheorien
- 3.1.4. Stress als Umwelt- bzw. Personenvariable
- 3.2. P-E-Fit
- 3.2.1. Das Konzept des Rollenstress nach Kahn et al. (1964)
- 3.2.1.1. Rollenkonflikte
- 3.2.1.1.1. Intra-Sender-Konflikt
- 3.2.1.1.2. Inter-Sender-Konflikt
- 3.2.1.1.3. Inter-Rollen-Konflikt
- 3.2.1.1.4. Person-Rollen-Konflikt
- 3.2.1.2. Rollenbezogene Überforderung
- 3.2.1.3. Rollenambiguität
- 3.2.1.4. Rollenbezogene Verantwortung
- 3.2.1.5. Grenzrollen
- 3.2.1.1. Rollenkonflikte
- 3.2.2. Erweiterung und Ergänzung der Rollenepisode durch Neuberger (1995)
- 3.2.3. Empirische Absicherung des Rollenstressmodells nach Kahn et al. (1964)
- 3.2.4. Weitere empirische Untersuchungen
- 3.2.5. Das Rollenstressmodell im Verhältnis zu anderen Stresstheorien
- 3.2.1. Das Konzept des Rollenstress nach Kahn et al. (1964)
- 3.1. Stresstheoretische Konzepte
- 3. Begriffsdefinitionen: Belastung, Beanspruchung, Stress
- C. Methoden
- 4. Zielsetzung der Untersuchung
- 4.1. Untersuchungsdesign
- 4.2. Ausgangsbedingungen
- 4.3. Untersuchungsfeld
- 5. Untersuchungsinstrument
- 5.1. Methodische Überlegungen
- 5.2. Entwicklung eines Interviewleitfadens
- 6. Inhaltsanalyse
- 6.1. Zusammenstellung eines Kategoriensystems
- 6.2. Formulierung von Definitionen, Ankerbeispielen und Kodierregeln
- D. Ergebnisse der Untersuchung
- 7. IntraSK
- 7.1. IntraSK nicht-freigestellter Betriebsrätinnen und Betriebsräte
- 7.1.1. IntraSK in Bezug auf die Geschäftsleitung
- 7.1.2. IntraSK in Bezug auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- 7.1.3. IntraSK in Bezug auf das Betriebsratsgremium
- 7.1.4. IntraSK in Bezug auf die Gewerkschaft
- 7.1.5. IntraSK in Bezug auf den Vertrauenskörper
- 7.2. IntraSK freigestellter Betriebsrätinnen und Betriebsräte
- 7.2.1. IntraSK in Bezug auf die Geschäftsleitung
- 7.2.2. Intra SK in Bezug auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- 7.2.3. Intra SK in Bezug auf das Betriebsratsgremium
- 7.2.4. Intra SK in Bezug auf die Gewerkschaft
- 7.2.5. Intra SK in Bezug auf den Vertrauenskörper
- 7.3. Zwischenbilanz: Unterschiede zwischen beiden Untersuchungsgruppen im Hinblick auf den IntraSK
- 7.1. IntraSK nicht-freigestellter Betriebsrätinnen und Betriebsräte
- 8. Inter SK
- 8.1. InterSK nicht-freigestellter Betriebsrätinnen und Betriebsräte
- 8.2. InterSK freigestellter Betriebsrätinnen und Betriebsräte
- 8.3. Zwischenbilanz: Unterschiede zwischen beiden Untersuchungsgruppen im Hinblick auf den InterSK
- 9. InterRK
- 9.1. InterRK nicht-freigestellter Betriebsrätinnen und Betriebsräte
- 9.2. InterRK freigestellter Betriebsrätinnen und Betriebsräte
- 9.3. Zwischenbilanz: Unterschiede zwischen beiden Untersuchungsgruppen im Hinblick auf den InterRK
- 10. Rollenambiguität
- 10.1. Rollenambiguität (A ←)
- 10.1.1. Rollenambiguität (A ←) nicht-freigestellter Betriebsrätinnen und Betriebsräte
- 10.1.2. Rollenambiguität (A ←) freigestellter Betriebsrätinnen und Betriebsräte
- 10.2. Rollenambiguität (A →)
- 10.2.1. Rollenambiguität (A →) nicht-freigestellter Betriebsrätinnen und Betriebsräte
- 10.2.2. Rollenambiguität (A →) freigestellter Betriebsrätinnen und Betriebsräte
- 10.3. Zwischenbilanz: Unterschiede zwischen den Untersuchungsgruppen im Hinblick auf Rollenambiguitäten
- 10.1. Rollenambiguität (A ←)
- 11. Rollenüberlastung
- 11.1. Qualitative Rollenüberlastung
- 11.1.1. Qualitative Rollenüberlastung nicht-freigestellter Betriebsrätinnen und Betriebsräte
- 11.1.2. Qualitative Rollenüberlastung freigestellter Betriebsrätinnen und Betriebsräte
- 11.2. Quantitative Rollenüberlastung
- 11.2.1. Quantitative Rollenüberlastung nicht-freigestellter Betriebsrätinnen und Betriebsräte
- 11.2.2. Quantitative Rollenüberlastung freigestellter Betriebsrätinnen und Betriebsräte
- 11.3. Zwischenbilanz: Vergleich der qualitativen bzw. quantitativen Rollenüberlastung zwischen beiden Untersuchungsgruppen
- 11.1. Qualitative Rollenüberlastung
- 12. Rollenverantwortung
- 12.1. Rollenverantwortung (1)
- 12.1.1. Rollenverantwortung (1) nicht-freigestellter Betriebsrätinnen und Betriebsräte
- 12.1.2. Rollenverantwortung (1) freigestellter Betriebsrätinnen und Betriebsräte
- 12.2. Rollenverantwortung (2)
- 12.2.1. Rollenverantwortung (2) nicht-freigestellter Betriebsrätinnen und Betriebsräte
- 12.2.2. Rollenverantwortung (2) freigestellter Betriebsrätinnen und Betriebsräte
- 12.3. Zwischenbilanz: Vergleich der Rollenverantwortung (1) und (2) zwischen beide Untersuchungsgruppen
- 12.1. Rollenverantwortung (1)
- 13. Person-Rollen-Konflikte (PRK)
- 13.1. Person-Rollen-Konflikte (1)
- 13.1.1. PRK (1) nicht-freigestellter Betriebsrätinnen und Betriebsräte
- 13.1.2. PRK (1) freigestellter Betriebsrätinnen und Betriebsräte
- 13.2. Person-Rollen-Konflikte (2)
- 13.2.1. PRK (2) nicht-freigestellter Betriebsrätinnen und Betriebsräte
- 13.2.2. PRK (2) freigestellter Betriebsrätinnen und Betriebsräte
- 13.3. Zwischenbilanz: Vergleich Person-Rollen-Konflikte (1) und (2) zwischen beiden Untersuchungsgruppen
- 13.1. Person-Rollen-Konflikte (1)
- 14. Scharnierposition
- 14.1. Scharnierposition nicht-freigestellter Betriebsrätinnen und Betriebsräte
- 14.2. Scharnierposition freigestellter Betriebsrätinnen und Betriebsräte
- 14.3. Zwischenbilanz: Vergleich der Scharnierposition zwischen beiden Untersuchungsgruppen
- 15. Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse
- 7. IntraSK
- Die spezifischen Belastungen und Herausforderungen von Betriebsräten
- Die Relevanz des Rollenstressmodells für die Analyse von Belastungen in der Betriebsratsarbeit
- Der Einfluss von Rollenkonflikten, Rollenüberlastung und Rollenambiguität auf das Wohlbefinden und die Arbeitsfähigkeit von Betriebsräten
- Die Unterschiede in den Belastungen zwischen freigestellten und nicht-freigestellten Betriebsräten
- Die Bedeutung der Scharnierposition für die Bewältigung von Belastungen in der Betriebsratsarbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Belastungen von betrieblichen Interessenvertreterinnen und Interessenvertretern unter besonderer Berücksichtigung des Rollenstresskonzeptes. Die Arbeit zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis der spezifischen Herausforderungen zu gewinnen, denen Betriebsräte in ihrer Tätigkeit gegenüberstehen und wie diese durch das Rollenstressmodell erklärt werden können.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema, in der die Rahmenbedingungen der Arbeit von betrieblichen Interessenvertreterinnen und Interessenvertretern, die Aufgaben des Betriebsrates und die Bedeutung der betrieblichen Interessenvertretung als Forschungsobjekt erläutert werden. Kapitel 3 beleuchtet den theoretischen Hintergrund, wobei das Konzept des Rollenstress im Detail dargestellt und mit anderen Stresstheorien in Beziehung gesetzt wird.
Im Methodenteil werden die Zielsetzung der Untersuchung, das Untersuchungsdesign, das Untersuchungsfeld und das Instrumentarium beschrieben. Im Ergebnis-Kapitel werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchung präsentiert, die sich auf Intra-Sender-Konflikte, Inter-Sender-Konflikte, Rollenambiguität, Rollenüberlastung, Rollenverantwortung, Person-Rollen-Konflikte und die Scharnierposition konzentrieren. Die Ergebnisse werden in Bezug auf die Unterschiede zwischen freigestellten und nicht-freigestellten Betriebsräten analysiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind: Betriebsrat, Interessenvertretung, Rollenstress, Rollenkonflikt, Rollenüberlastung, Rollenambiguität, Person-Rollen-Konflikt, Scharnierposition, Belastung, Beanspruchung, Stress.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Belastungen sind Betriebsräte ausgesetzt?
Betriebsräte erleben oft Rollenkonflikte, Zeitdruck (quantitative Überlastung) und die schwierige Scharnierposition zwischen Belegschaft und Geschäftsführung.
Was besagt das Rollenstressmodell nach Kahn?
Das Modell beschreibt Stress als Folge von Rollenkonflikten, Rollenambiguität (Unklarheit) und Rollenüberlastung innerhalb einer Organisation.
Was ist ein "Inter-Sender-Konflikt"?
Dies tritt auf, wenn verschiedene Gruppen (z. B. Mitarbeiter und Arbeitgeber) widersprüchliche Erwartungen an die Rolle des Betriebsrats stellen.
Unterscheiden sich die Belastungen bei freigestellten Betriebsräten?
Ja, freigestellte Betriebsräte haben andere Belastungsprofile (z. B. Fokus auf Gremienarbeit) als nicht-freigestellte, die zusätzlich ihre reguläre Arbeit bewältigen müssen.
Welche rechtliche Basis hat die Betriebsratsarbeit in Deutschland?
Die wesentliche Rechtsgrundlage ist das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG), das die Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretern regelt.
- Quote paper
- M.A. Roswitha Zirngibl (Author), 2005, Belastungen von betrieblichen Interessenvertreterinnen und Interessenvertretern unter besonderer Berücksichtigung des Rollenstresskonzeptes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/53516