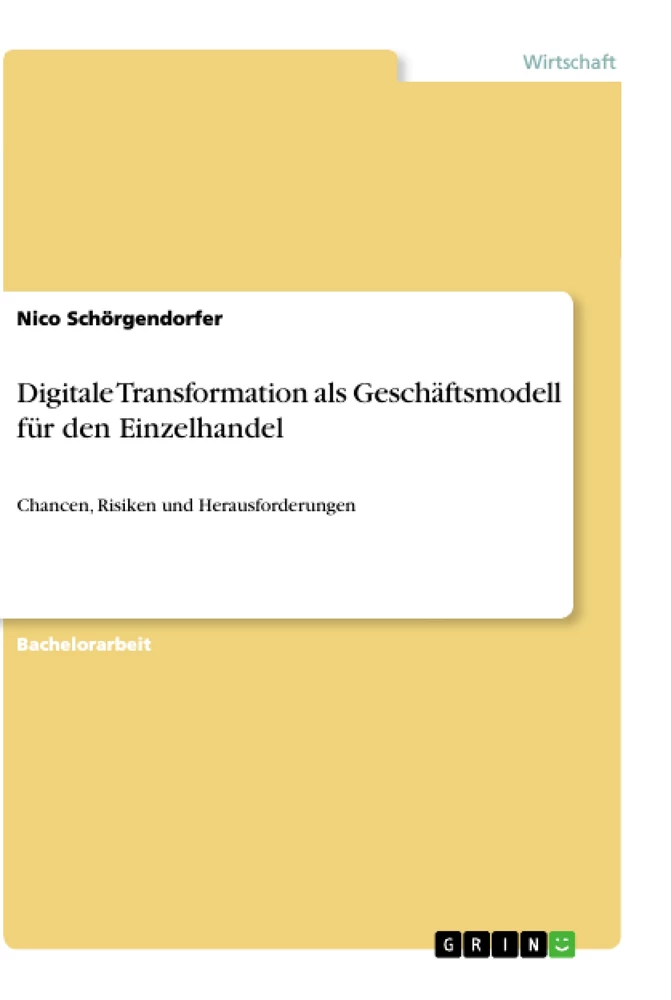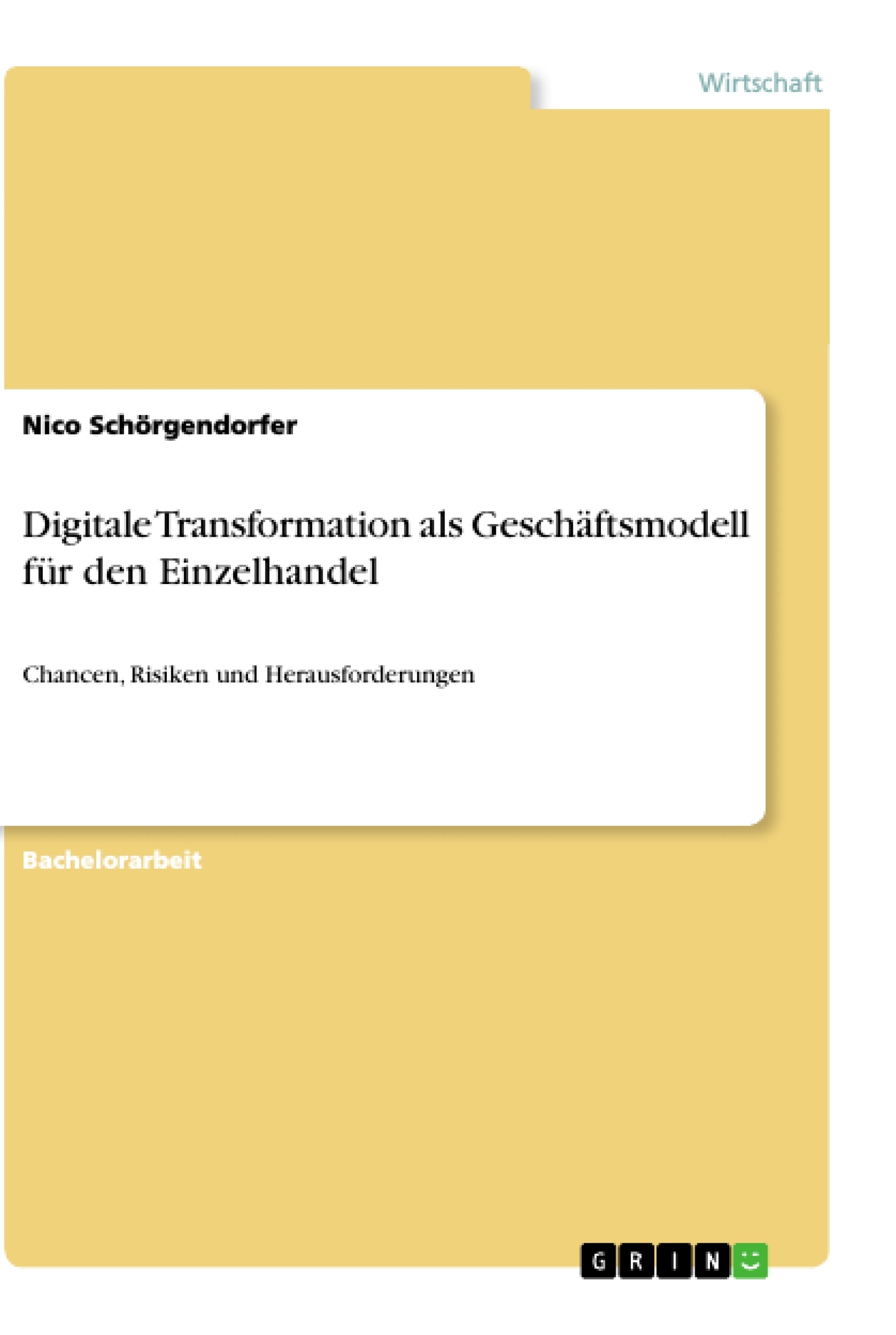Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, die gegenwärtigen Chancen, Risiken und Herausforderungen des Handels zu identifizieren und die theoretischen Grundlagen der Digitalen Transformation von Geschäftsmodellen für den stationären Handel zu vermitteln. Um den nötigen Handlungsspielraum für individuelle Umsetzungen zu erhalten werden aufgrund der vielen unterschiedlichen Geschäftsmodelle keine konkreten Handlungsempfehlungen ausgearbeitet.
Die laufende Veränderung der Handelslandschaft hat in einer gesamtheitlichen Betrachtung enorme Auswirkungen auf jeden Einzelnen und somit eine entsprechend hohe Relevanz für die Allgemeinheit. Das Interesse sich mit diesem Thema intensiver auseinander zu setzen, ist für jeden Konsumenten gegeben.
In einem Umfeld steigender Erwartungen an moderne Handelsformate und der fortschreitenden Digitalisierung unserer Gesellschaft, sieht sich im speziellen der stationäre Handel mit sinkenden Umsätzen konfrontiert. Betrachtet man in diesem Kontext die Wachstumskurve des Online-Handels, lässt sich aber auch hier bereits eine leichte Abflachung identifizieren. Wie sich die weiteren Entwicklungen in Bezug auf einzelne Branchen und die Geschwindigkeit verhalten werden und wie der Einzelhandel darauf reagieren soll, lässt sich nur schwer prognostizieren. Aktuelle Trends und Meldungen gehen von einer weiteren Vermischung des Offline- und Online-Handels und einer zunehmenden Konsolidierung des Handelsmarktes aus.
Die vorliegende Arbeit basiert auf einer systematischen Literaturrecherche und der daran anschließenden Analyse und bearbeitet in den folgenden Kapiteln neben den Chancen, Risiken und Herausforderungen, mögliche Ansätze einer digitalen Transformation von Geschäftsmodellen für den Einzelhandel. Aufgrund des nötigen Handlungsspielraums für die Adaption individueller Geschäftsmodelle wurde keine konkrete Handlungsempfehlung abgeleitet.
Als konkretes Ergebnis dieser Arbeit lässt sich festhalten, dass die Notwendigkeit einer digitalen Transformation in einem starken Zusammenhang mit der jeweiligen Branche steht und eine Handlungsentscheidung nur in diesem Kontext und unter Berücksichtigung der formulierten Unternehmensstrategie getroffen werden sollte. Die dargestellten Chancen und Risiken können nur als Anstoß für weitere Überlegungen gesehen werden.
Inhaltsverzeichnis
- DANKSAGUNG
- INHALTSVERZEICHNIS
- ABBILDUNGSVERZEICHNIS
- TABELLENVERZEICHNIS
- ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS / GLOSSAR
- KURZFASSUNG
- EXECUTIVE SUMMARY
- 1 EINLEITUNG
- 1.1 PROBLEMSTELLUNG
- 1.2 ZIELSETZUNG
- 1.3 AUFBAU UND STRUKTUR
- 1.4 METHODIK
- 2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN
- 2.1 BETRIEBSFORMEN DES HANDELS
- 2.2 GESCHÄFTSMODELLE
- 2.3 DIGITALE TRANSFORMATION
- 2.4 ZUSAMMENFASSUNG
- 3 DER STATUS QUO DES HANDELS
- 3.1 STANDORTBESTIMMUNG
- 3.2 EINFLUSSFAKTOREN
- 3.3 ZUSAMMENFASSUNG
- 4 CHANCEN, RISIKEN UND HERAUSFORDERUNGEN
- 4.1 CHANCEN FÜR DEN HANDEL
- 4.2 RISIKEN FÜR DEN HANDEL
- 4.3 HERAUSFORDERUNGEN FÜR DEN HANDEL
- 4.4 ZUSAMMENFASSUNG
- 5 DIGITALE TRANSFORMATION IM STATIONÄREN HANDEL
- 5.1 ELEMENTE DIGITALER GESCHÄFTSMODELLE
- 5.2 EXEMPLARISCHE ROADMAP
- 5.3 ZUSAMMENFASSUNG
- 6 FAZIT UND AUSBLICK
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der digitalen Transformation im Einzelhandel und analysiert die Chancen, Risiken und Herausforderungen, die sich für den stationären Handel aus dieser Entwicklung ergeben. Ziel der Arbeit ist es, ein umfassendes Verständnis für die Digitalisierung des Handels zu schaffen und Handlungsempfehlungen für die erfolgreiche Anpassung an die neuen Gegebenheiten zu liefern.
- Entwicklungen im Online-Handel und deren Auswirkungen auf den stationären Handel
- Digitale Geschäftsmodelle und ihre Implementierung im stationären Handel
- Chancen und Risiken der digitalen Transformation für den Einzelhandel
- Herausforderungen, die sich für den stationären Handel durch die Digitalisierung stellen
- Strategien und Handlungsempfehlungen für den erfolgreichen Umgang mit der digitalen Transformation
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die Problematik der digitalen Transformation im Einzelhandel und die Zielsetzung der Arbeit dargestellt. Das zweite Kapitel befasst sich mit den theoretischen Grundlagen des Handels, einschließlich der Betriebstypen, Geschäftsmodelle und der digitalen Transformation. Das dritte Kapitel analysiert den Status quo des Handels und beleuchtet die Standortbestimmung und die Einflussfaktoren, die die Entwicklung des Handels prägen. Das vierte Kapitel widmet sich den Chancen, Risiken und Herausforderungen, die sich aus der digitalen Transformation für den Handel ergeben.
Schlüsselwörter
Digitale Transformation, Einzelhandel, Online-Handel, Stationärer Handel, Geschäftsmodelle, Chancen, Risiken, Herausforderungen, Digitalisierung, E-Commerce, Multi-Channel-Handel, Omnichannel-Strategie
Häufig gestellte Fragen
Was sind die größten Herausforderungen für den stationären Einzelhandel?
Der stationäre Handel kämpft mit sinkenden Umsätzen durch den Online-Handel und steigenden Erwartungen der Konsumenten an moderne Formate.
Welche Chancen bietet die digitale Transformation dem Handel?
Die Digitalisierung ermöglicht neue Geschäftsmodelle, eine stärkere Vermischung von Offline- und Online-Kanälen (Omnichannel) und eine bessere Kundenansprache.
Gibt es eine allgemeine Strategie für die digitale Umstellung?
Nein, die Arbeit betont, dass die Notwendigkeit und Art der Transformation stark von der jeweiligen Branche und der individuellen Unternehmensstrategie abhängen.
Was versteht man unter Omnichannel- oder Multi-Channel-Strategien?
Es handelt sich um die Integration verschiedener Vertriebskanäle (Ladenlokal, Onlineshop, Mobile), um dem Kunden ein nahtloses Einkaufserlebnis zu bieten.
Wie ist der aktuelle Status quo des Online-Handels?
Obwohl der Online-Handel weiter wächst, lässt sich in einigen Bereichen bereits eine leichte Abflachung der Wachstumskurve identifizieren.
- Quote paper
- Nico Schörgendorfer (Author), 2017, Digitale Transformation als Geschäftsmodell für den Einzelhandel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/535197