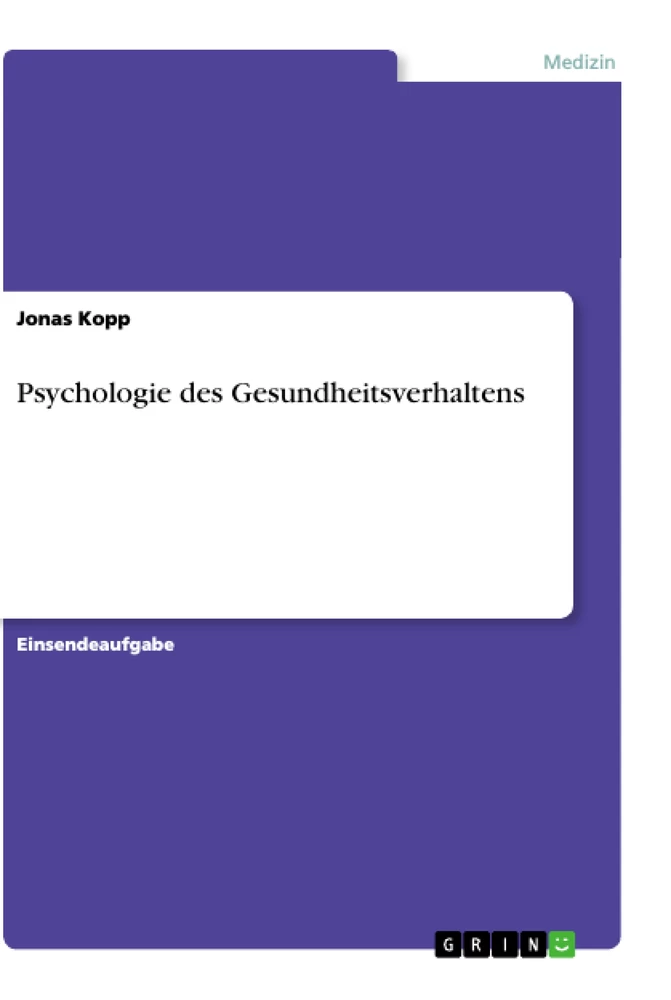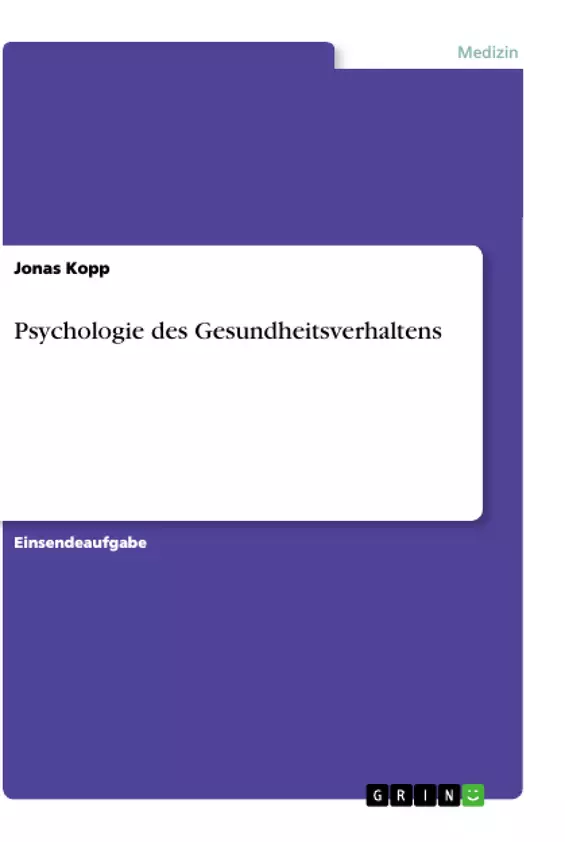In der vorliegenden Arbeit wird zunächst der Begriff der Selbstwirksamkeitserwartung definiert, bevor auf Basis theoretischer Grundlagen zur körperlichen Aktivität ein beispielhaftes, gesundheitspsychologisches Beratungsgespräch dargestellt wird. Das Beratungsgespräch soll dem fiktiven Klienten dabei helfen, durch körperliche Aktivität seine Rückenschmerzen zu bekämpfen.
Inhaltsverzeichnis
1 SELBSTWIRKSAMKEITSERWARTUNG
1.1 Definition
1.2 Messung zur sportlichen Aktivitat
1.3 Kritischer Vergleich zweier Studien
2 LITERATURRECHERCHE KORPERLICHE AKTIVITAT
2.1 Definition Korperliche Aktivitat
2.2 Theoretische Grundlagen
2.3 Entstehung
2.4 Uberblick uber aktuelle Daten und Zahlen
2.5 Konsequenzen fur eine gesundheitsorientierte Beratung
3 BERATUNGSGESPRACH
3.1 Veranderung korperlichen Inaktivitat
3.2 Gesundheitspsychologische Beratung
3.3 Gesprach
4 LITERATURVERZEICHNIS
5 ABBILDUNGSVERZEICHNIS
1 Selbstwirksamkeitserwartung
1.1 Definition
Nach Bandura (1977) ist die Selbstwirksamkeitserwartung oder auch Kompetenzerwar- tung eine eigene Fahigkeit, die man brauch um bestimmte Handlungen zu organisieren und auszufuhren um Ziele zu erreichen. Die Kompetenzerwartung nach Bong & Skaal- vik (2003) ist so definiert, dass es eine wahrgenommen Kompetenz ist. Diese bezieht sich auf kognitive und handlungsbezogene Fertigkeiten, die wichtig fur eine Handlung sind.
1.2 Messung zur sportlichen Aktivitat
In dem folgenden Diagramm sind Ergebnisse eines Versuches zur Selbstwirksamkeit dargestellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab1: Versuch zur Selbstwirksamkeit in Bezug auf sportliche Aktivitat
Als erstes wurden Personen im Alter von 18-30 Jahren befragt. Der Versuch lehnt sich an die SSA-Skala-Selbstwirksamkeit zu sportliche Aktivitaten an. Diese wurde von Fuchs & Schwarzer (1994; S.146) modifiziert. Das Testresultat lautet, dass Person 1 und Person 4 dieselben Testergebnisse besitzen und dem zufolge eine hohe Selbstwirk- samkeit besitzen. Das bedeutet, je hoher die Ergebnisse sind desto hoher ist die Selbst- wirksamkeit auf den Aspekt zur sportlichen Aktivitat. Person 3 besitzt das niedrigste 3/17
Testergebnis und somit auch die kleinste Selbstwirksamkeit, bezogen auf sportliche Aktivitaten. Person 2 und 5 besitzen eine normale Selbstwirksamkeit, beide liegen etwa bei der Halfte, der zu erreichenden Punktzahl, d.h. sie besitzen eine relative Konsequenz zur sportlichen Aktivitaten. Planen diese Personen Sport zu machen, es kommt jedoch eine andere Aktivitat dazwischen, wird der Plan des Sport treiben schnell verworfen.
1.3 Kritischer Vergleich zweier Studien
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Beide Studien ergeben einen eindeutigen Beweis, dass durch Rehabilitation die Selbst- wirksamkeit erhoht werden kann. Das Untersuchungsdesign der ersten Studie ist hoher angesetzt und somit ersichtlicher. Mehrere Patienten wurden in die Beobachtungsstudie einbezogen, dabei wurde inaktiv in die Rehabilitation eingegriffen. Bei der Studie von Schneider & Rief bezog man weniger Personen in die Feldstudie ein, hierbei gab es einen aktiven Eingriff in die Rehabilitation. Durch das eindeutige Beschreiben der Zie- le, vor Beginn der Reha, ist definitiv zu sagen, dass das Wohlbefinden und der Geistes- zustand der Patienten sich stark verbesserten. Dies ist vor allem in der Studie von Dohnke gut erkennbar. In der zweiten Studie wird eine andere Form der Reha und Me- thodik betrachtet und durchgefuhrt. Hier wird durch das Besprechen der erlebten schmerzbedingten und allgemeinpsychischen Beeintrachtigungen die Selbstwirksam- keitserwartung erhoht und die allgemeine Psyche ebenfalls dadurch gestarkt. Beide Stu- dien verfolgen dieselben Ziele, mit unterschiedlicher Methodik. Die Selbstwirksam- keitserwartung der Patienten konnte erhoht werden, obwohl zwei verschieden Bereiche der Rehabilitationen zugrunde liegen und die Stichprobe, sowie das Untersuchungsdes- ign verschieden sind.
2 Literaturrecherche Korperliche Aktivitat
2.1 Definition Korperliche Aktivitat
Korperliche Akt ivitat wird in der Regel als „jegliche Korperbewegung bezeichnet, die mit einer Muskelkontraktion verbunden ist und bei der der Energieverbrauch hoher als im Ruhezustand ist“. Diese breit gefasste Definition bezieht sich auf zahlreiche Formen korperlicher Aktivitaten, sei es korperliche Betatigung in der Freizeit (einschlieBlich der meisten Sportarten und Tanzen), berufliche korperli- che Aktivitat, Bewegung im hauslichen Umfeld oder im Bereich des Verkehrs. (EU-Arbeitsgruppe ,,Sport & Gesundheit“ 2008).
In Englisch sprechenden Landern wird die korperliche Aktivitat auch als “physical acti- vity“ bezeichnet. Die Definition des Begriffs lautet: ,,Physical activity comprisies anybody movement produced by the skeletal muscles that results in a substantial increas over the resting energy expenditure.“ (Bouchard & Shephard,1994).
Laut Nasser werden drei Dimensionen herangezogen um die korperliche Aktivitat zu beschreiben: Dauer (in Minuten und Sekunden), Frequenz (Haufigkeit pro Woche) und Intensitat (Energieverbrauch in Kalorien pro Minute) (Nasser, 2001, S.19-20).
In der epidemiologischen Forschung wird der Begriff korperliche Aktivitat viel disku- tiert. Insbesondere im Rahmen von Gesundheitsforderungskonzepten ist dieser Begriff in der Literatur immer wieder auffindbar, obwohl sich dieser oft auf den spezifischen Bereich der sportlichen Aktivitat bezieht (vgl. Pahmeier, 1994; Schwarzer, 1992; zitiert nach Nasser, 2001, S. 18).
2.2 Theoretische Grundlagen
Zur korperlichen Aktivitat zahlen viele Aspekte die man als Grundlagen ansehen kann. Diese reichen von allgemeinen motorischen Aspekten bis hin zu Neuromus- kularen Funktionen und biochemischen Reaktionen. Man fand durch Fahrradgeo- meteruntersuchungen heraus, dass die Gehirndurchblutung sowie der Gehirn- stoffwechsel angeregt werden und dadurch verschiedene Stoffwechselvorgange positiv beeinflusst werden konnen (Herholz, Buskies, Rist, Pawlik, Hollman, Heiss, 1987).
Bewegung bzw. korperliche Aktivitat ist ein Wesensmerkmal des Menschen, unver- zichtbar fur die gesamte Entwicklung in alien Altersstufen. Der Mensch entwickelt sich lebenslang in der aktiven Auseinandersetzung mit seinen individuellen situativen Um- weltgegebenheiten uber Wahrnehmung und Bewegung (Baumann, 1996b; zitiert nach Nasser, 2011, S.18).
2.3 Entstehung
Korperliche Aktivitat und Bewegung spielen schon seit Jahrtausenden in allen wichti- gen Kulturen im Rahmen von Wiederherstellung, Erhaltung und Forderung der Ge- sundheit eine herausragende Rolle (Bos & Brehm, 1998; Zitiert nach Nasser, 2001, S.11).
Sport und Gesundheit ist eine Verknupfung, die bereits das klassische Altertum kennt. Aristoteles (384 bis 322 v. Chr.) wurdigte die „Gymnastik“ als allgemein korperlich wohltuend, und der romische Satiriker Juvenal (etwa 50 bis 140 n. Chr.) fand es wunschenswert, dass ein gesunder Geist in einem gesunden Korper sei. Vor 200 Jahren galt in Deutschland den Philanthropen korperliche Ertuchti- gung, Abhartung, Korperpflege und gesunde Ernahrung als voraussetzendes Verhalten fur daseinsbezogene Gluckseligkeit (Schlicht, 1995; zitiert nach Nasser, 2011, S.12).
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Selbstwirksamkeitserwartung?
Die Selbstwirksamkeitserwartung nach Bandura ist der Glaube an die eigene Fähigkeit, Handlungen so zu organisieren und auszuführen, dass bestimmte Ziele erreicht werden können.
Wie wird körperliche Aktivität definiert?
Körperliche Aktivität umfasst jede Bewegung, die durch Skelettmuskeln erzeugt wird und den Energieverbrauch über den Ruhezustand hinaus erhöht, einschließlich Sport, Arbeit und Bewegung im Haushalt.
Welche Rolle spielt die Selbstwirksamkeit beim Sport?
Eine hohe Selbstwirksamkeit führt dazu, dass Personen eher sportlich aktiv werden und Pläne auch dann weiterverfolgen, wenn Hindernisse auftreten.
Können Rehabilitationen die Selbstwirksamkeit steigern?
Ja, Studien zeigen, dass gezielte Rehabilitationsmaßnahmen und das Besprechen von Fortschritten die Überzeugung der Patienten in ihre eigenen körperlichen Fähigkeiten stärken.
Was sind die drei Dimensionen körperlicher Aktivität nach Nasser?
Körperliche Aktivität wird durch die Dauer (Minuten), die Frequenz (Häufigkeit pro Woche) und die Intensität (Energieverbrauch) beschrieben.
- Arbeit zitieren
- Jonas Kopp (Autor:in), 2018, Psychologie des Gesundheitsverhaltens, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/535301