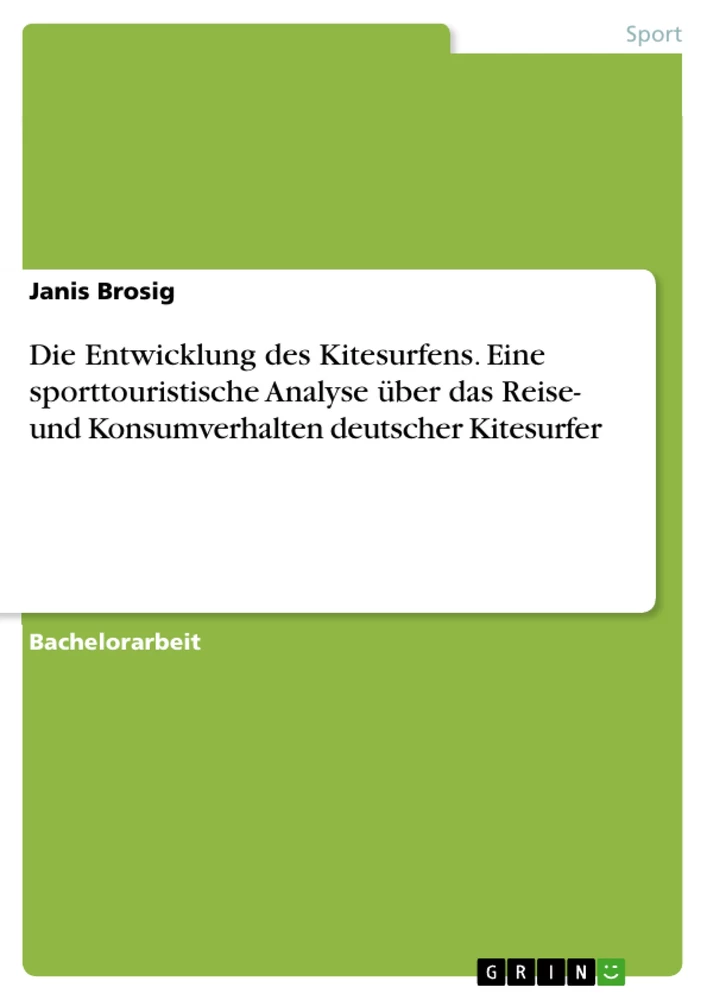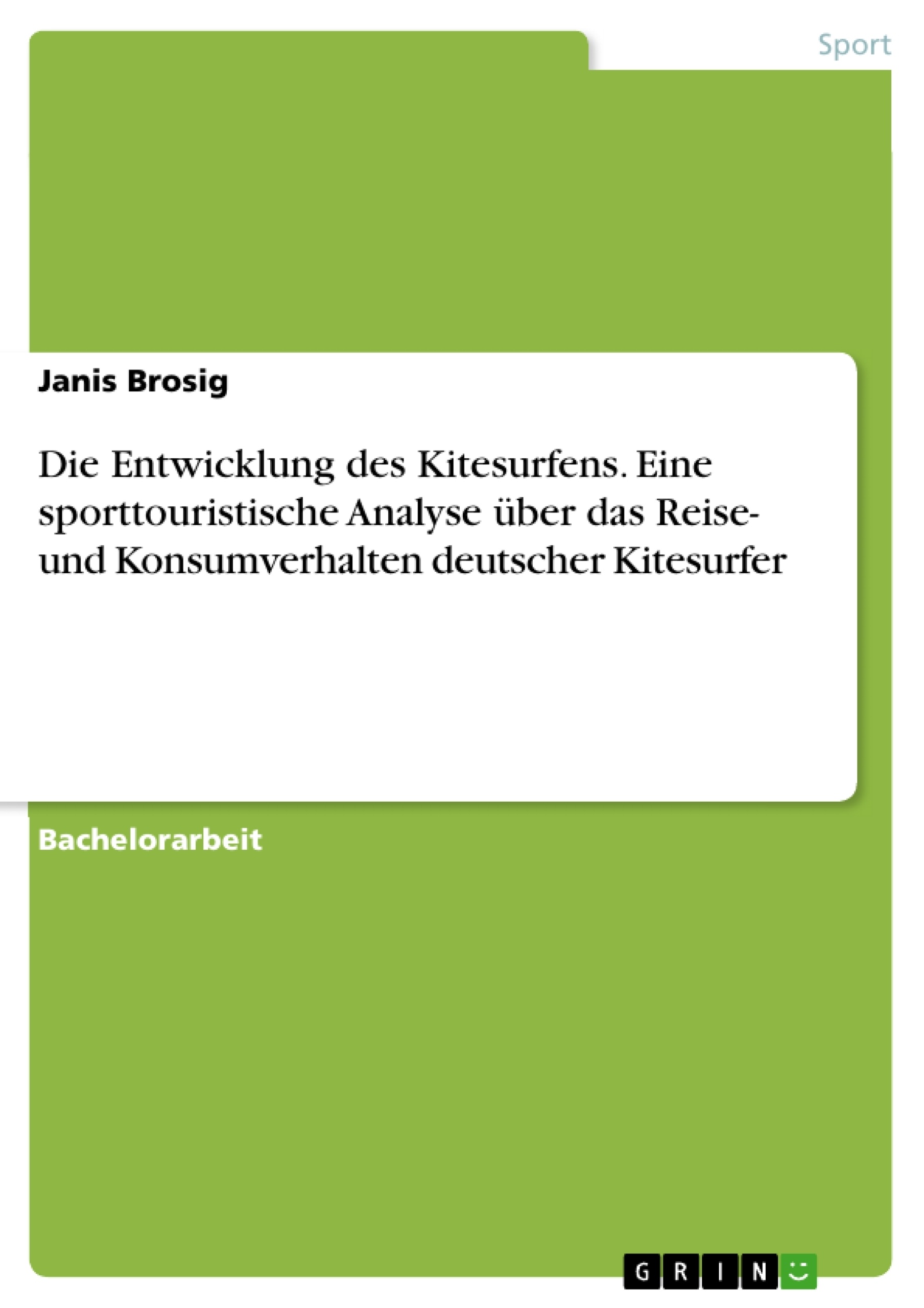Die Arbeit befasst sich mit der Entwicklung des Kitesurfens und erstellt anhand einer Online-Umfrage ein Profil deutscher Kitesurfer. Der Fokus liegt auf dem Reiseverhalten und Kaufverhalten.
Als theoretische Grundlage wird der Begriff des Sporttourismus anhand verschiedener Definitionen näher betrachtet. Darauffolgend wird auf Zahlen, Daten und Fakten im Sporttourismus eingegangen, um die Bedeutung des Sporttourismus in Deutschland darzustellen. Anschließend werden die unterschiedlichen Kitesurf-Regionen vorgestellt, um einen Bezug zum Sporttourismus zu schaffen. Weiterführend folgt der Naturschutz sowie die Entwicklung und Einordnung der Sportart Kitesurfen. Darauf folgend werden Methodik sowie Ergebnisse der durchgeführten Umfrage dargestellt.
In den letzten Jahren ist der Natursport immer beliebter geworden. Darunter ist der Trend Sport Kitesurfen. Die heutigen Sicherheitsmaßnahmen haben diesen Sport für fast alle zugänglich gemacht. Doch was macht einen deutschen Kitesurfer aus? Welche Motive hat er bei der Ausübung und wie ist sein Konsumverhalten? Die Hürden zur Ausübung des Kitesurfens sind besonders für Deutsche zum Großteil sehr hoch. Deutschland ist kein Küstenland, lediglich die Nord- und Ostsee erstrecken sich entlang der norddeutschen Grenze. Seen und Flüsse prägen das Land, sind jedoch oft ungeeignet aufgrund des fehlenden oder unbeständigen Winds. Das macht es für viele Sportler zu einer Herausforderung, das Kitesurfen regelmäßig ausüben zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Die Bedeutung des Kitesurfens in Deutschland
- Hintergründe der Studie
- Sporttourismus
- Zahlen, Daten, Fakten Weltweit und in Deutschland
- Kitesurf-Regionen
- Naturschutz
- Die Entwicklung des Kitesurfens
- Vom Extremsport zum Trendsport
- Ein Vergleich zu anderen Wassersportarten
- Begriffsbestimmungen
- Wassertourismus
- Die Sportart Kitesurfen
- Methodik
- Aufbau des Fragebogens
- Auswahl der Erhebungsmethode
- Ergebnisse
- Demografie der Teilnehmer
- Fragebogenergebnisse
- Diskussion
- Entwicklung der Sportart Kitesurfen in der Zukunft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit dem Trendsport Kitesurfen und der Entwicklung der Sportart in Deutschland. Ziel ist es, mithilfe einer Online-Umfrage ein Profil deutscher Kitesurfer zu erstellen, das sich auf Reiseverhalten und Kaufverhalten fokussiert. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen dem Sporttourismus dabei helfen, Angebote und Dienstleistungen noch gezielter auf seine Kunden auszurichten.
- Entwicklung des Kitesurfens in Deutschland
- Bedeutung des Kitesurfens als Trendsportart
- Reiseverhalten und Kaufverhalten deutscher Kitesurfer
- Potenziale des Sporttourismus im Bereich Kitesurfen
- Zusammenhang von Kitesurfen und Naturschutz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Bedeutung des Kitesurfens in Deutschland und bietet einen umfassenden Überblick über den Sporttourismus, sowie Daten und Fakten zum Kitesurfen weltweit und in Deutschland. Die Kapitel "Die Entwicklung des Kitesurfens" und "Begriffsbestimmungen" beschäftigen sich mit der Geschichte der Sportart, ihrem Wandel vom Extremsport zum Trendsport, und definieren den Begriff Wassertourismus und die Sportart Kitesurfen selbst.
Das Kapitel "Methodik" erklärt den Aufbau des Fragebogens und die gewählte Erhebungsmethode. Die Ergebnisse der Umfrage werden anschließend in "Ergebnisse" präsentiert und beinhalten demografische Daten der Teilnehmer sowie Ergebnisse aus dem Fragebogen selbst. Die "Diskussion" analysiert die Ergebnisse und betrachtet die zukünftige Entwicklung des Kitesurfens.
Schlüsselwörter
Kitesurfen, Trendsport, Sporttourismus, Reiseverhalten, Kaufverhalten, Wassersport, Naturschutz, Online-Umfrage, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieser Analyse über Kitesurfer?
Ziel ist die Erstellung eines Profils deutscher Kitesurfer hinsichtlich ihres Reise- und Konsumverhaltens, um touristische Angebote besser anzupassen.
Welche Herausforderungen haben Kitesurfer in Deutschland?
Deutschland ist kein klassisches Küstenland; konstante Windbedingungen finden sich meist nur an Nord- und Ostsee, was viele Sportler zum Reisen zwingt.
Wie hat sich Kitesurfen als Sportart entwickelt?
Kitesurfen hat sich von einem gefährlichen Extremsport zu einem zugänglichen Trendsport entwickelt, vor allem durch verbesserte Sicherheitsmaßnahmen.
Welche Rolle spielt der Naturschutz beim Kitesurfen?
Da Kitesurfen ein Natursport ist, gibt es oft Konflikte oder notwendige Regelungen zum Schutz von Küstenökosystemen und Vögeln.
Wie wurde die Datenerhebung durchgeführt?
Die Daten wurden mithilfe einer Online-Umfrage erhoben, die demografische Merkmale sowie Motive und Kaufverhalten abfragte.
- Quote paper
- Janis Brosig (Author), 2020, Die Entwicklung des Kitesurfens. Eine sporttouristische Analyse über das Reise- und Konsumverhalten deutscher Kitesurfer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/535306