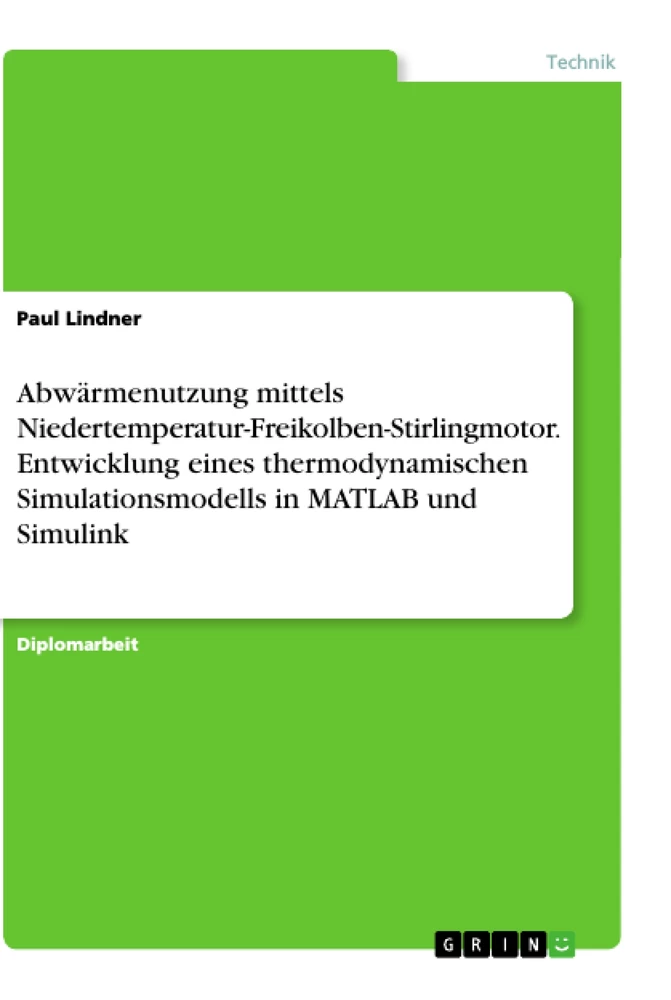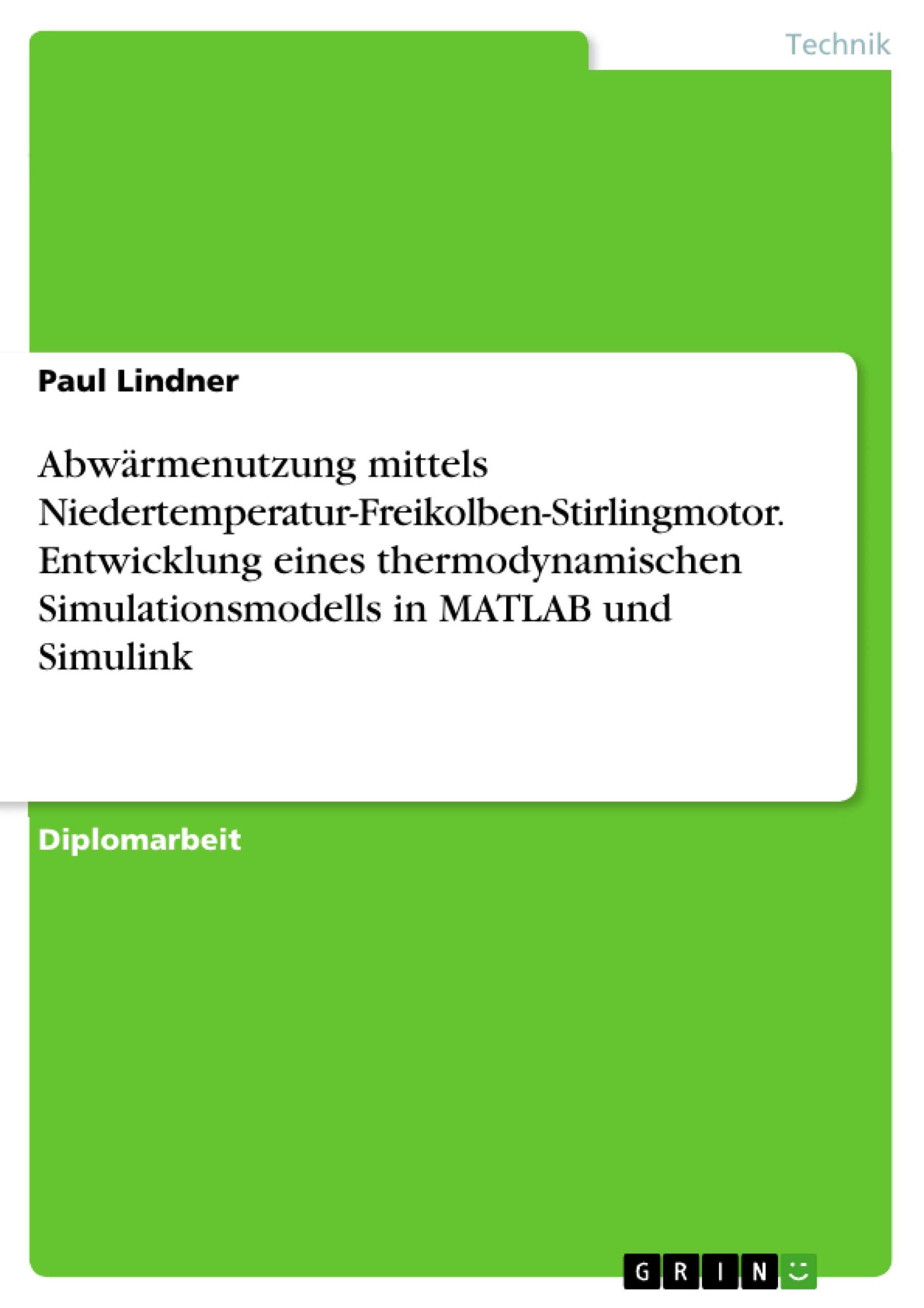Die Entwicklung ressourcenschonender Technologien ist seit geraumer Zeit Gegenstand wissenschaftlicher und ökonomischer Diskussionen. Davon motiviert, möchte diese Arbeit einen Beitrag leisten, wie bislang nicht wirtschaftlich nutzbare Energiequellen erschlossen werden können. Ein bedeutender Teil der weltweit erzeugten Elektroenergie wird in Wärmekraftwerken mittels thermodynamischer Kreisprozesse gewonnen. Dank der großen Temperaturdifferenzen werden entsprechend hohe Wirkungsgrade erreicht.
Die Nutzung von Wärme und Abwärme mit einer geringen Temperaturdifferenz ist hingegen mit einer Vielzahl von technischen und vor allem wirtschaftlichen Hemmnissen verbunden. Ob als ungenutzte Abwärme von Industrieanlagen oder als warmes Oberflächenwasser tropischer Meeresflächen: Thermische Potenziale mit geringen Temperaturunterschieden scheinen nahezu unbegrenzt verfügbar zu sein. Bei der Nutzbarmachung dieser Ressource ist vorrangig der unwirtschaftliche Einsatz aufwändiger Technik der begrenzende Faktor. Eine zielführende Lösung der genannten Hemmnisse bietet der Stirling-Motor. Das seit fast 200 Jahren bekannte Prinzip des Heißluftmotors hat in einer Vielzahl technischer Anwendungen seine Leitungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Die Möglichkeit der Wärmezufuhr von außen und die damit verbundene Nutzungsmöglichkeit beliebiger Wärmequellen und nicht zuletzt auch die Vielfalt möglicher Maschinenkonfigurationen machen den Stirling-Motor interessant für das bisher wenig erschlossene Gebiet der Umwandlung von Niedertemperatur-Wärme in mechanische Arbeit.
In diesem Zusammenhang ist es notwendig, verschiedene Bauweisen und Motorkonfigurationen im Kontext des geringen Temperaturpotentials zu betrachten. Mit dem geringen Wirkungsgrad der einzelnen Maschine auf der einen und der riesigen Verfügbarkeit von Niedertemperaturwärme auf der anderen Seite ergeben sich ungewöhnliche Anforderungen an Wirtschaftlichkeit. Der Einsatz alternativer Materialien und Fertigungsverfahren ist ebenso Gegenstand der Arbeit wie die Modellierung des Stirling-Motors im Allgemeinen und die Simulation einer geeigneten Maschinenkonfiguration mit dem erstellten Simulationsmodell 2. und 3. Ordnung im Speziellen.
Diese Arbeit ist im Sinne eines Beitrages zur ressourcenschonenden Nutzung vorhandener Energiequellen zu verstehen. Es werden, untermauert von Simulationsergebnissen, die Möglichkeiten und Grenzen des Stirling-Motors auf dem Gebiet der Abwärmenutzung umrissen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Zielstellung der Arbeit
- 3 Grundlagen
- 3.1 Energiebilanz
- 3.2 Zustandsgleichung und Zustandsänderung
- 3.2.1 Zustandsgleichungen
- 3.2.2 Zustandsänderungen idealer Gase
- 3.3 Das p,v- und T,s- Diagramm
- 3.4 Wärmeleitung
- 3.5 Wärmeübergang
- 3.6 Strömungsmechanik
- 3.6.1 Laminare Strömung
- 3.6.2 Turbulente Strömung
- 4 Der Stirlingmotor
- 4.1 Der ideale Stirling-Prozess
- 4.1.1 Beschreibung des Kreisprozesses
- 4.2 Arten von Stirling-Motoren
- 4.3 Einsatzgebiete von Stirling-Motoren
- 4.3.1 Nutzung des Stirlingmotors in der Kraft-Wärme-Kopplung
- 4.3.2 Anwendungsbeispiele von Freikolben-Stirling-Motoren
- 4.3.3 Doppelt wirkende Stirling-Motoren
- 4.3.4 Solarer Niedertemperatur-Stirlingmotor
- 4.4 Simulationstechniken
- 4.4.1 Einteilung der Berechnungsverfahren
- 4.4.2 Simulation mit MATLAB/Simulink
- 4.5 Neue Konzepte und Innovationsideen
- 4.5.1 Nutzungsrandbedingungen der Konzeptidee
- 4.5.2 Innovationen
- 4.1 Der ideale Stirling-Prozess
- 5 Simulationsmodell Stirlingmotor
- 5.1 Die elementare Rohrzelle
- 5.1.1 Bestimmung des Massestromes
- 5.1.2 Bestimmung der Arbeitsgastemperatur
- 5.1.3 Wärmeübergang vom Fluid zur Wandung
- 5.1.4 Simulationsmodell
- 5.2 Wärmeleitungselemente
- 5.2.1 Eindimensionale Wärmeleitung
- 5.2.2 Zweidimensionale Wärmeleitung
- 5.3 Der Wärmeübertrager
- 5.3.1 Aufbau
- 5.3.2 Modulares Modellkonzept
- 5.4 Der Regenerator
- 5.4.1 Der ideale und der reale Regenerator
- 5.4.2 Berechnung des Widerstandsbeiwertes im Regenerator
- 5.4.3 Berechnung der Matrix- und Gastemperatur der Regeneratorzelle
- 5.4.4 Auslegung und Optimierung
- 5.5 Volumenelemente und Kolben
- 5.5.1 Zylinderelement mit Kolben
- 5.5.2 Zylinder mit Doppelkolben: Beta-Konfiguration
- 5.5.3 Zylinder mit Dreifachkolben: Alpha-Konfiguration
- 5.5.4 Abschlusselemente
- 5.6 Elemente zur Übertragung von Kräften
- 5.6.1 Feder-Dämpfer-Element
- 5.6.2 Magnetische Koppelglieder
- 5.7 Der Lineargenerator
- 5.8 Das Arbeitsgas
- 5.9 Simulative Berücksichtigung veränderlicher Stoffwerte
- 5.1 Die elementare Rohrzelle
- 6 Auswertung
- 6.1 Simulationsergebnisse
- 6.2 Vierzylinder-Stirling-Freikolbenmotor Alpha-Konfiguration
- 6.2.1 Aufbau und Simulationsmodell
- 6.2.2 Simulationsergebnisse
- 6.3 Einzylinder-Stirling-Freikolbenmotor Beta-Konfiguration
- 6.3.1 Aufbau und Simulationsmodell
- 6.3.2 Simulationsergebnisse Motor 3 (AT=50 K)
- 6.3.3 Simulationsergebnisse Motor 4 (AT=200 K)
- 6.4 Der Stirling-Motor im Kontext zur Abwärmenutzung
- 6.4.1 Abwärmenutzung im stationären Bereich
- 6.4.2 Abwärmenutzung im Kraftfahrzeug
- 6.4.3 Möglichkeiten und Grenzen der Abwärmenutzung mit Freikolben-Stirling-Motoren
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Nutzung von Abwärme mittels Niedertemperatur-Freikolben-Stirlingmotoren. Ziel ist die Entwicklung und Simulation eines solchen Motors. Die Arbeit konzentriert sich auf die Modellierung und die Auswertung der Simulationsergebnisse.
- Modellierung des Stirling-Prozesses
- Simulation eines Niedertemperatur-Freikolben-Stirlingmotors
- Auswertung der Simulationsergebnisse verschiedener Konfigurationen
- Bewertung des Potenzials zur Abwärmenutzung
- Analyse von Möglichkeiten und Grenzen der Technologie
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Abwärmenutzung mittels Niedertemperatur-Freikolben-Stirlingmotoren ein und skizziert den Aufbau der Arbeit.
2 Zielstellung der Arbeit: Dieses Kapitel definiert die konkreten Ziele der Diplomarbeit, die Entwicklung eines Simulationsmodells für einen Niedertemperatur-Freikolben-Stirlingmotor und die Analyse des Potenzials zur Abwärmenutzung.
3 Grundlagen: Dieses Kapitel erläutert die notwendigen thermodynamischen und strömungsmechanischen Grundlagen, die für das Verständnis des Stirling-Prozesses und der Modellbildung essentiell sind. Es werden Zustandsgleichungen, Zustandsänderungen, Wärmeleitung, Wärmeübergang und Strömungsmechanik behandelt, um ein solides Fundament für die spätere Modellierung zu schaffen.
4 Der Stirlingmotor: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit dem Stirlingmotor. Es beschreibt den idealen Stirling-Prozess, verschiedene Motortypen und deren Einsatzgebiete, insbesondere im Kontext der Kraft-Wärme-Kopplung und der Abwärmenutzung. Es werden auch innovative Konzepte und Ideen im Bereich der Stirlingmotoren vorgestellt und diskutiert. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der Funktionsweise und des Potenzials dieser Technologie.
5 Simulationsmodell Stirlingmotor: Dieses Kapitel beschreibt detailliert das entwickelte Simulationsmodell des Stirlingmotors. Es werden die einzelnen Komponenten des Modells, wie die Rohrzelle, Wärmeleitungselemente, der Wärmeübertrager, der Regenerator, Volumenelemente, Kolben, Elemente zur Kraftübertragung und der Lineargenerator, erläutert und mathematisch modelliert. Die Wahl der Modellierungsansätze und die Vereinfachungen werden begründet. Es wird ein modularer Aufbau des Modells angestrebt, um eine flexible Anpassung an verschiedene Konfigurationen zu ermöglichen.
Schlüsselwörter
Niedertemperatur-Freikolben-Stirlingmotor, Abwärmenutzung, Simulation, MATLAB/Simulink, Thermodynamik, Strömungsmechanik, Energieeffizienz, Kraft-Wärme-Kopplung, Modellbildung.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Simulation eines Niedertemperatur-Freikolben-Stirlingmotors zur Abwärmenutzung
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Entwicklung und Simulation eines Niedertemperatur-Freikolben-Stirlingmotors zur Nutzung von Abwärme. Der Fokus liegt auf der Modellierung des Motors und der Auswertung der Simulationsergebnisse.
Welche Ziele werden in der Arbeit verfolgt?
Die zentralen Ziele sind die Entwicklung eines Simulationsmodells für einen Niedertemperatur-Freikolben-Stirlingmotor, die Simulation verschiedener Motor-Konfigurationen und die Analyse des Potenzials zur Abwärmenutzung. Es soll das Potenzial und die Grenzen dieser Technologie bewertet werden.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Modellierung des Stirling-Prozesses, die Simulation eines Niedertemperatur-Freikolben-Stirlingmotors, die Auswertung der Simulationsergebnisse verschiedener Konfigurationen (Alpha und Beta), die Bewertung des Potenzials zur Abwärmenutzung und die Analyse der Möglichkeiten und Grenzen dieser Technologie.
Welche Grundlagen werden im Detail erläutert?
Die Arbeit erläutert die notwendigen thermodynamischen und strömungsmechanischen Grundlagen. Dies umfasst Zustandsgleichungen, Zustandsänderungen idealer Gase, Wärmeleitung, Wärmeübergang und Strömungsmechanik (laminar und turbulent). Diese Grundlagen bilden die Basis für das Verständnis des Stirling-Prozesses und der Modellbildung.
Wie wird der Stirlingmotor in der Arbeit behandelt?
Der Stirlingmotor wird umfassend behandelt, inklusive des idealen Stirling-Prozesses, verschiedener Motortypen und deren Einsatzgebiete (Kraft-Wärme-Kopplung, Abwärmenutzung). Innovative Konzepte und Ideen im Bereich der Stirlingmotoren werden vorgestellt und diskutiert.
Wie ist das Simulationsmodell aufgebaut?
Das Simulationsmodell ist modular aufgebaut und besteht aus verschiedenen Komponenten: Rohrzelle, Wärmeleitungselemente, Wärmeübertrager, Regenerator, Volumenelemente, Kolben, Elemente zur Kraftübertragung und Lineargenerator. Jedes Element wird detailliert modelliert und die Modellierungsansätze werden begründet. Die Simulation wurde mit MATLAB/Simulink durchgeführt.
Welche Simulationsergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert Simulationsergebnisse für einen Vierzylinder-Stirling-Freikolbenmotor in Alpha-Konfiguration und einen Einzylinder-Stirling-Freikolbenmotor in Beta-Konfiguration (mit unterschiedlichen Temperaturunterschieden). Die Ergebnisse werden ausführlich analysiert und interpretiert.
Wie wird die Abwärmenutzung im Kontext des Stirlingmotors betrachtet?
Die Arbeit untersucht die Nutzung von Abwärme mittels Stirlingmotoren im stationären Bereich und im Kraftfahrzeug. Es werden die Möglichkeiten und Grenzen der Abwärmenutzung mit Freikolben-Stirling-Motoren analysiert.
Welche Software wurde für die Simulation verwendet?
Die Simulationen wurden mit MATLAB/Simulink durchgeführt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Niedertemperatur-Freikolben-Stirlingmotor, Abwärmenutzung, Simulation, MATLAB/Simulink, Thermodynamik, Strömungsmechanik, Energieeffizienz, Kraft-Wärme-Kopplung, Modellbildung.
- Arbeit zitieren
- Paul Lindner (Autor:in), 2011, Abwärmenutzung mittels Niedertemperatur-Freikolben-Stirlingmotor. Entwicklung eines thermodynamischen Simulationsmodells in MATLAB und Simulink, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/535405