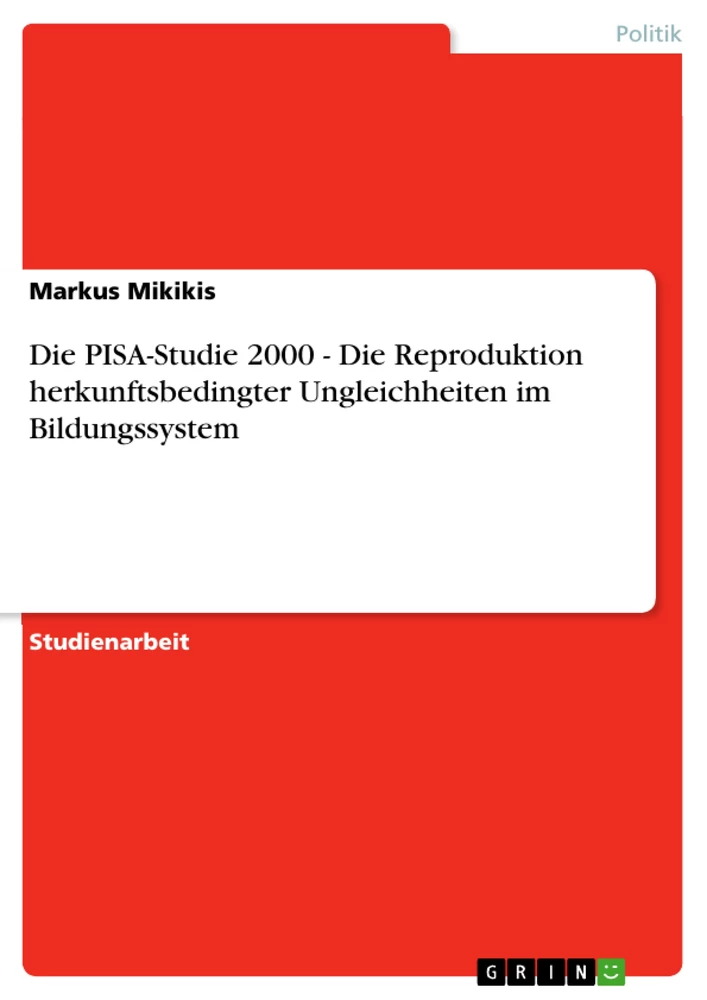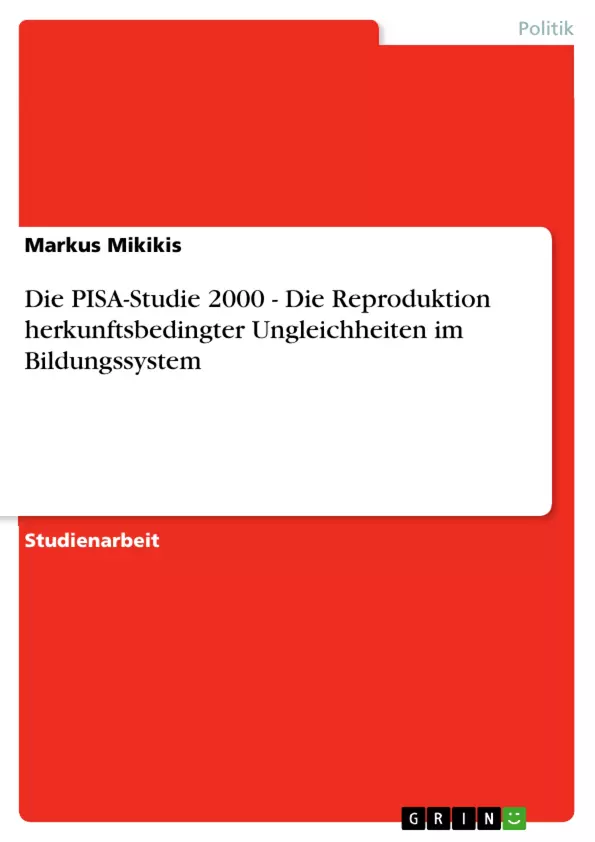Die Ergebnisse der internationalen PISA-Studie 2000 führten erwartungsgemäß zu einer wortreichen Debatte um schulpädagogische und bildungspolitische Zielsetzungen. Zahlreiche Faktoren wurden als Ursachen für das schlechte Abschneiden der deutschen Schüler und die erheblichen Beteiligungs- und Leistungsunterschiede zwischen sozialen Schichten diskutiert. Dennoch gibt es nach wie vor kaum gesicherte Erkenntnisse über die Ursachen von Bildungsungleichheiten.
Dennoch möchte ich in diesem Aufsatz - soweit es der momentane Forschungsstand zulässt - die grundlegenden Ursachen für die Entstehung herkunftsbedingter Ungleichheiten im deutschen Bildungssystem erläutern. In diesem Zusammenhang werde ich mich auf die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen familiären Lebensverhältnissen und der Bildungsbeteiligung bzw. des Kompetenzerwerbs konzentrieren und damit einen wesentlichen Teil der PISA-Studie darstellen. Dabei interessiert mich, ob in Deutschland ein deterministisches Verhältnis zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg besteht, und welche Maßnahmen zu einer Verringerung der Ungleichheiten im Bildungssystem führen könnten.
Eine Rückschau auf das Bildungssystem der 50er Jahre und die in dieser Zeit einsetzende Bildungsexpansion halte ich für ein umfassendes Verständnis dieser Thematik für notwendig. Daher beginnt dieser Aufsatz mit einer Darstellung der wesentlichen Ursachen und Wirkungen der Bildungsexpansion und dem damit einhergehenden Wandel von Bildungs- und Beteiligungschancen. Hiervon ausgehend werde ich skizzieren was genau im Rahmen der PISA-Studie untersucht wurde und wie die dafür herangezogenen Daten gesammelt wurden. Dabei stehen zunächst die angewandten Messverfahren und grundlegende Indikatoren für relevante Randbedingungen im Vordergrund. Größere Aufmerksamkeit werde ich jedoch den Ergebnissen der einzelnen Untersuchungsbereiche zukommen lassen.
Aufgrund der Heterogenität der gesammelten Daten scheint es sinnvoll den Einfluss von Zuwanderungsmerkmalen auf die Bildungsbeteiligung und den Kompetenzerwerb getrennt von der sozialen Herkunft zu betrachten.
Abschließend werde ich ausgehend von den Ergebnissen der PISA-Studie die wesentlichen Ursachen für die Reproduktion herkunftsbedingter Ungleichheiten im Bildungssystem beleuchten und miteinander in Beziehung setzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Bildungsexpansion
- Ursachen der Bildungsexpansion
- Die Bildungsexpansion und ihre Folgen
- Die PISA-Studie 2000
- Vorgehensweise und Begriffserklärung
- Indikatoren der sozialen Herkunft
- Sozialstrukturelle Merkmale der Familien
- Soziale Herkunft und Bildungsbeteiligung
- Soziale Herkunft und erworbene Kompetenzen
- Grundlegende Ergebnisse der Studie
- Internationaler Vergleich des Zusammenhangs zwischen sozialer Herkunft und Kompetenzerwerb
- Jugendliche mit Migrationshintergrund
- Bildungsbeteiligung der Jugendlichen aus Migrationsfamilien
- Untersuchung des Zusammenhangs von Migration und Kompetenzerwerb
- Die Reproduktion herkunftsbedingter Ungleichheiten im Bildungssystem
- Ursachen für die Reproduktion herkunftsbedingter Ungleichheiten in der Bildungsbeteiligung und im Bildungserfolg
- Lebensweltliche und institutionalisierte Bildungsprozesse im Vergleich
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Aufsatz befasst sich mit den Ursachen herkunftsbedingter Ungleichheiten im deutschen Bildungssystem, wobei der Fokus auf der PISA-Studie 2000 liegt. Die Arbeit analysiert den Zusammenhang zwischen familiären Lebensverhältnissen und der Bildungsbeteiligung bzw. dem Kompetenzerwerb und untersucht, ob ein deterministisches Verhältnis zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg besteht. Ziel ist es, grundlegende Ursachen für die Entstehung von Ungleichheiten aufzudecken und Maßnahmen zur Verringerung dieser Ungleichheiten im Bildungssystem zu erörtern. Die Bildungsexpansion und ihre Auswirkungen auf die Bildungslandschaft sowie die spezifischen Herausforderungen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund im Bildungssystem werden ebenfalls beleuchtet.
- Die Entstehung herkunftsbedingter Ungleichheiten im Bildungssystem
- Der Einfluss familiärer Lebensverhältnisse auf die Bildungsbeteiligung und den Kompetenzerwerb
- Die Rolle der Bildungsexpansion in der Reproduktion von Ungleichheiten
- Die PISA-Studie 2000 als Indikator für Bildungsungleichheiten
- Die besonderen Herausforderungen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund im Bildungssystem
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Debatte um Bildungsungleichheiten, die durch die PISA-Studie 2000 ausgelöst wurde. Das Kapitel skizziert die Forschungsfrage und die Vorgehensweise des Aufsatzes. Im zweiten Kapitel wird die Bildungsexpansion als ein wesentlicher Faktor im Bildungssystem beleuchtet. Die Ursachen und Auswirkungen der Bildungsexpansion auf die Bildungschancen und die Gesellschaftsstruktur werden erörtert. Das dritte Kapitel befasst sich mit der PISA-Studie 2000. Die Vorgehensweise, die angewandten Messverfahren und die Indikatoren für die soziale Herkunft werden detailliert dargestellt. Die Ergebnisse der Studie, die den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungsbeteiligung bzw. Kompetenzerwerb beleuchten, werden analysiert. Im vierten Kapitel wird der Einfluss von Migrationshintergrund auf die Bildungsbeteiligung und den Kompetenzerwerb gesondert betrachtet.
Schlüsselwörter
Bildungsexpansion, Bildungsungleichheit, PISA-Studie 2000, Soziale Herkunft, Bildungsbeteiligung, Kompetenzerwerb, Migrationshintergrund, Reproduktion von Ungleichheiten, Lebenswelt, Institutionelle Bildungsprozesse
Häufig gestellte Fragen
Welchen Haupterkenntnis lieferte die PISA-Studie 2000 für Deutschland?
Die Studie zeigte einen sehr starken Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft der Eltern und dem Bildungserfolg bzw. Kompetenzerwerb der Kinder in Deutschland auf.
Was bedeutet „Reproduktion herkunftsbedingter Ungleichheiten“?
Damit ist gemeint, dass das Bildungssystem bestehende soziale Unterschiede eher verfestigt oder weitergibt, anstatt sie durch Chancengleichheit auszugleichen.
Welchen Einfluss hat ein Migrationshintergrund laut PISA?
Jugendliche aus Migrationsfamilien wiesen im Durchschnitt geringere Kompetenzen auf, was oft mit sozialen Faktoren und sprachlichen Barrieren innerhalb des Bildungssystems verknüpft ist.
Was war die Bildungsexpansion der 50er Jahre?
Es war eine Phase, in der immer mehr Menschen höhere Bildungsabschlüsse anstrebten, was jedoch nicht zwangsläufig zum Abbau der relativen Ungleichheit zwischen den Schichten führte.
Welche Indikatoren messen die soziale Herkunft?
Häufig genutzte Indikatoren sind der Bildungsstand der Eltern, deren beruflicher Status sowie die im Haushalt verfügbaren kulturellen Ressourcen (z.B. Anzahl der Bücher).
- Arbeit zitieren
- Markus Mikikis (Autor:in), 2005, Die PISA-Studie 2000 - Die Reproduktion herkunftsbedingter Ungleichheiten im Bildungssystem, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/53551