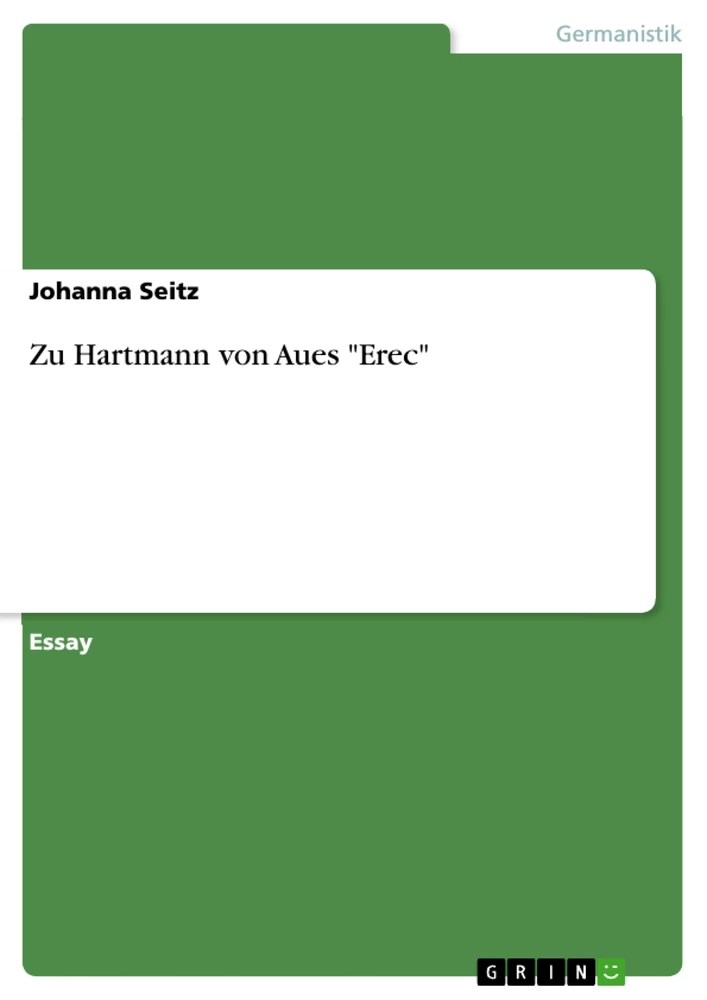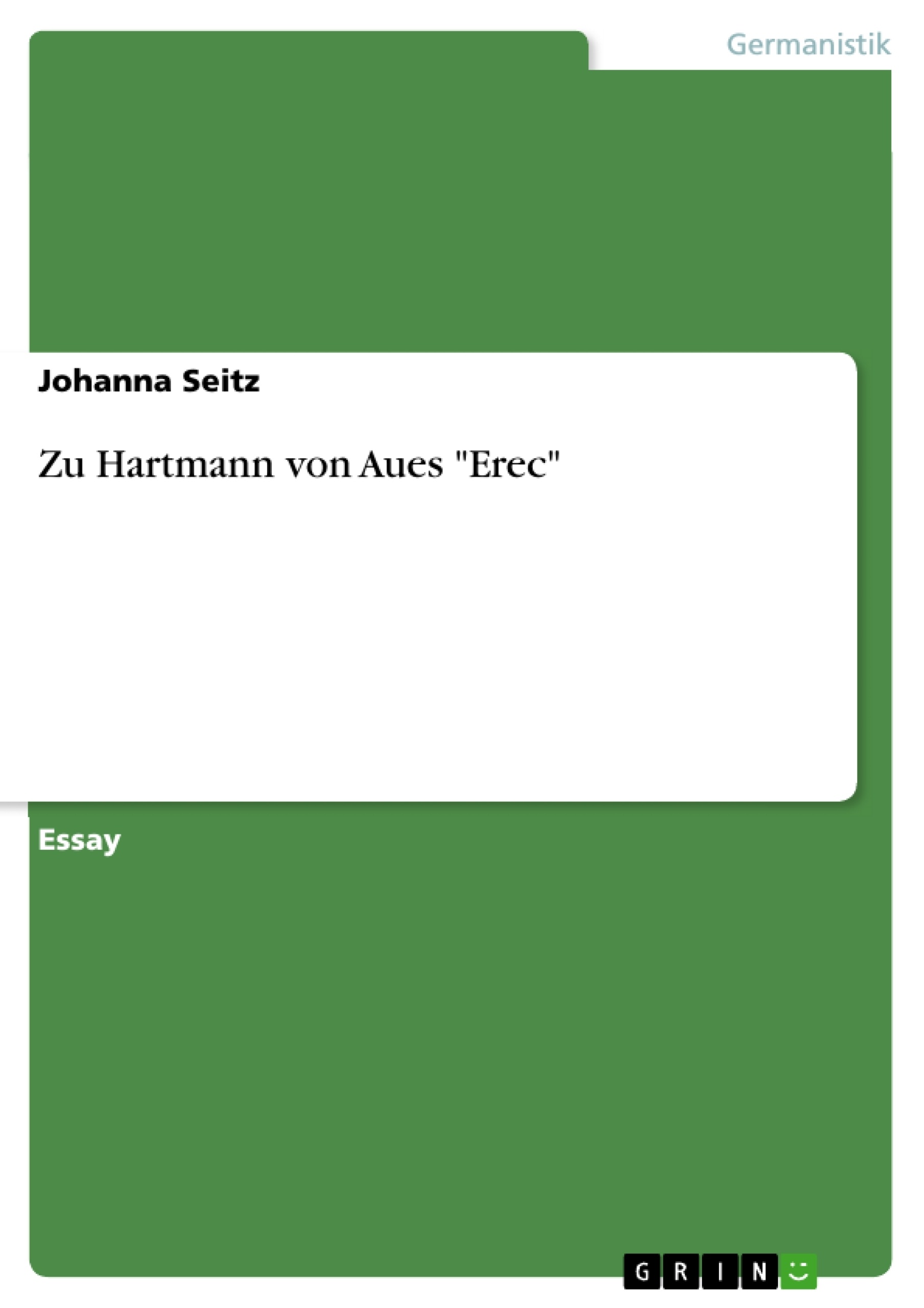Hartmann von Aue gilt im 12. Jahrhundert in den deutschen Landen als eine der erfolgreichsten Dichterpersönlichkeiten indem er einen neuen literarischen Stil sowie auch eine Vorstellung des Rittertums und der allgemeinen Hofkultur prägt. In seinem ‚Erec‘ nimmt er die zeitgenössische theologische Diskussion auf und impliziert die Stellung der Grundsatzfragen der Beziehung zu Gott. Dabei bietet er auch Lösungswege an die Synthese von Gott und Welt optimal zu verwirklichen (Wolf 2007). Charakteristisch für sein Schaffen ist die Verzahnung „seiner höfischen Welt mit der klerikal-lateinischen Gelehrtenkultur“ (Wolf 2007). In seinen Werken transferiert er die aus Frankreich stammenden geistlichen Sphären (u.a. contempus mundi) sowie auch die Welterlösung der heimischen Höfe (Wolf 2007). Erec als sein epochaler, erster deutscher Artusroman ist leider sehr dünn überliefert. Man spricht von einem „Wolfenbüttler“ (Mitte 13. Jahrhundert) und einem „Zwettler Erec“ (um 1250). In ersterem ist von Chretien sogar als Verfasser die Rede, doch beide haben nur wenige Übereinstimmung mit er Ambraser Fassung nach 1504 (Wolf 2007). Wie in Wolfram von Eschenbachs ‚Parzival‘ erkenntlich. wurde Hartmanns Erec damals als höfisches Standardwerk vorausgesetzt, wobei die These besteht, dass „die Entmachtung der Welfen und die bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen“, die Verbreitung des Romans behindert haben könnten (Wolf 2007).
Im Folgenden soll folgende Aussage belegt und diskutiert werden: „Erec ist nicht nur ein ritterlicher Held, er ist und wird zum Ende hin immer mehr eine Art Heilsbringer, auf dem Gottes Gnade ruht.“ Weiterführend sollen Fragen zur anstehenden Diskussion in den Raum gestellt werden, die im Zuge dieser Arbeit entstanden sind.
Inhaltsverzeichnis
-
-
- Die êre und das Rittertum
- Die Minneidylle und die Schuld
- Die dritte Erkenntnis
-
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die heilsgeschichtliche Struktur von Hartmanns Erec zu beleuchten und zu belegen, dass der Protagonist nicht nur ein Ritterlicher Held, sondern auch ein Heilsbringer ist, auf dem Gottes Gnade ruht.
- Die heilsgeschichtliche Struktur des Erec
- Die Entwicklung des Protagonisten Erec zum Heilsbringer
- Die Rolle der Minne und der Schuld im Werk
- Die Bedeutung der biblischen Traditionen für Hartmanns Erec
- Die Aktualität des Werkes in der heutigen Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Das Werk beginnt am Artushof und folgt dem Protagonisten Erec, der nach seiner Hochzeit mit Enite und einem erfolgreichen Turnier seine êre verliert, als er durch einen Zwerg erniedrigt wird. Erec begeht Rache und versucht, seine êre wiederzuerlangen, scheitert jedoch zunächst. Die zweite Katastrophe ereignet sich, als Erec und Enite die Zeit in der Kemenate,verligen'. Dieses Verhalten führt zum Selbstausschluss von der Gesellschaft und stellt Erec vor die Herausforderung, sich als Ritter zu beweisen.
Auf seinem Weg der Wiedererlangung seiner êre und Ansehen durchläuft Erec verschiedene Prüfungen. Er wird von Enite bei mehreren Rettungsaktionen unterstützt, jedoch bestraft er sie für ihr Eingreifen und ihre Warnungen. Erec erfährt die Bedeutung von Gnade und Barmherzigkeit und erkennt, dass sein Weg zur Erkenntnis von Gott führen soll. Im Kampf mit Mabonagin zeigt sich Erecs Entwicklung zum Heilsbringer. Er verschont seinen Gegner und überzeugt ihn vom rechten Weg, was ihm das Epitheton "erec der wunderaere" einbringt.
Schlüsselwörter
Hartmanns Erec, heilsgeschichtliche Struktur, Rittertum, êre, Minne, Schuld, Gott, Heilsbringer, biblische Traditionen, Artusroman, Typologie, Doppeldeutigkeit, Salomône, wîsheit, "verligen", Erkenntnis, Messe, Engel, Himmelreich, Aktualität, Literaturgeschichte, Mittelalter, exegetische Interpretation.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird Erec in dieser Arbeit als "Heilsbringer" bezeichnet?
Die Arbeit diskutiert die These, dass Erec sich im Verlauf des Romans von einem rein ritterlichen Helden zu einer Figur entwickelt, auf der Gottes Gnade ruht und die durch Barmherzigkeit (z.B. gegenüber Mabonagin) heilsbringend wirkt.
Was bedeutet der Begriff "verligen" im Kontext von Erec?
"Verligen" bezeichnet das Vernachlässigen ritterlicher Pflichten zugunsten des privaten Ehelebens (Minne), was bei Erec zum Verlust seiner Ehre (êre) und zum Selbstausschluss aus der höfischen Gesellschaft führt.
Welche Rolle spielt Hartmann von Aue für das Rittertum?
Hartmann von Aue prägte im 12. Jahrhundert einen neuen literarischen Stil und verband die höfische Welt mit klerikal-gelehrten Inhalten, wodurch er das Ideal des christlichen Ritters maßgeblich beeinflusste.
Was ist das Besondere an der Überlieferung des "Erec"?
Der Roman ist nur lückenhaft überliefert, unter anderem im "Wolfenbüttler" und "Zwettler Erec", wobei die Ambraser Fassung von 1504 eine wichtige, aber späte Quelle darstellt.
Wie hängen Ehre (êre) und göttliche Gnade im Werk zusammen?
Erecs Weg zur Wiedererlangung seiner ritterlichen Ehre wird als heilsgeschichtlicher Prozess dargestellt, bei dem ritterliche Bewährung und die Hinwendung zu Gott untrennbar miteinander verzahnt sind.
- Quote paper
- Johanna Seitz (Author), 2019, Zu Hartmann von Aues "Erec", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/535551