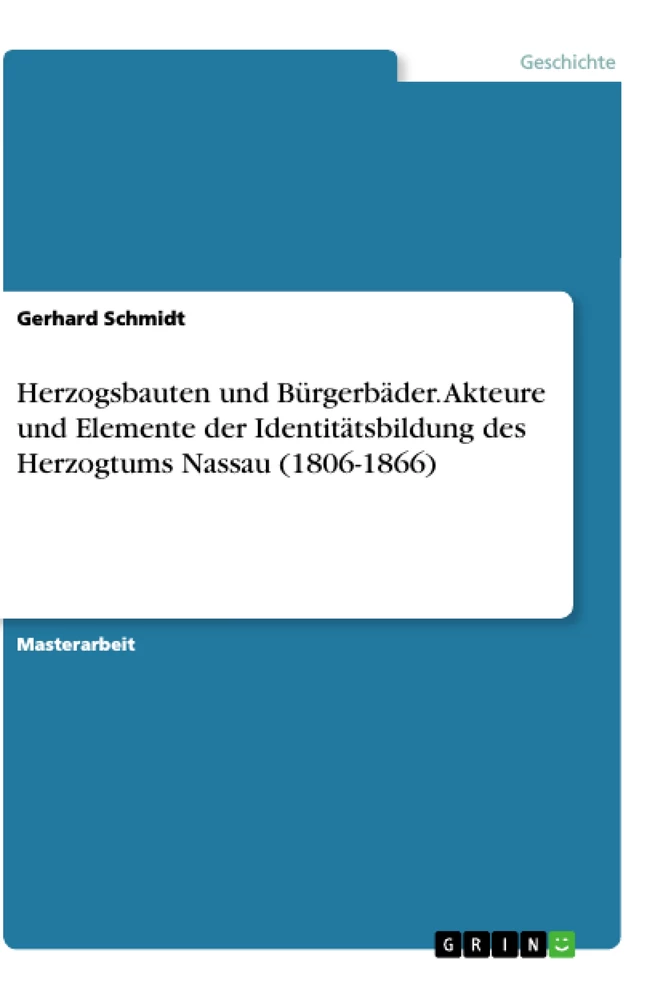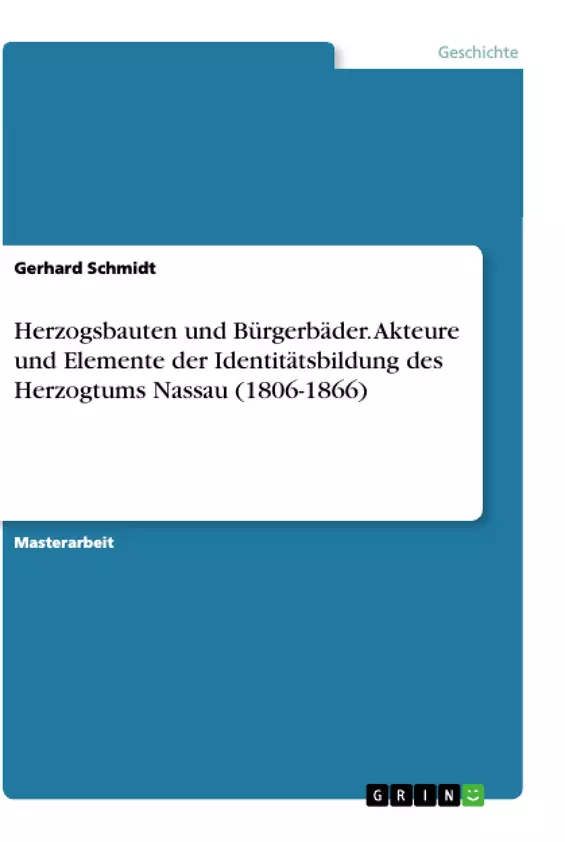Wie viele andere deutsche Staaten des Rheinbundes (ab 1806) und des Deutschen Bundes (ab 1815) standen Herzöge und Regierungen des Herzogtums Nassau, eines kleineren der neu entstandenen deutschen Staaten, vor der Aufgabe, aus konfessionell, historisch und rechtlich völlig unterschiedlichen kleinen Territorien einen nach innen gefestigten und nach außen behauptbaren Einheitsstaat zu formen. Die Arbeit geht der Frage nach, welche Strategien, Interessen und Faktoren diese staatliche "Selbstfindung" beeinflussten und welche Rolle das zunehmend selbstbewusste nassauische Bürgertum mit eigenen Vorstellungen und Zielen in Bezug auf die Identität des Herzogtums Nassau spielte.
Untersuchungsobjekt dieser Arbeit ist das in Folge des Reichsdeputationshauptschlusses (1803), durch Zugewinn weiterer Territorien als Rheinbundstaat (1806) sowie durch die Beschlüsse des Wiener Kongresses (1815) aus zahlreichen kleineren territorialen Einheiten entstandene Herzogtum Nassau, welches von 1806 bis 1866 bestand. Ähnlich wie das zeitgleich stark angewachsene Preußen und das spätere Deutsche Reich standen die in Nassau regierenden Herzöge bzw. die von ihnen eingesetzten Regierungen vor der Aufgabe, aus nach Konfession, Geschichte und Selbstbewusstsein sehr heterogenen Bestandteilen einen in seinem Inneren funktionsfähigen und von außen anerkannten Staat zu formen. Zum einen sollten aus Untertanen von in allen Lebensbereichen unterschiedlichen früheren Landesherrschaften sich auch als solche begreifende „Nassauer“ werden, zum anderen sollte das Land ein nach außen erkennbares eigenständiges Profil erhalten.
Hierzu ergriffen die herzoglichen Regierungen zahlreiche auf die Vereinheitlichung in Rechtsprechung, Militär, Finanzen, Verwaltung, Verkehr, Bildungswesen etc. zielende Maßnahmen. Parallel bemühten sich die regierenden Herzöge, ihrem Land ein nach innen wie außen unverwechselbares und im Vergleich mit anderen deutschen Staaten präsentables Gesicht zu erschaffen. Nach der nassauischen Verfassung von 1814 bedurften viele dieser Maßnahmen und vor allem die Bewilligung der notwendigen Finanzmittel der Zustimmung der beiden Kammern des Landtages. Die erste Kammer, die „Herrenbank“, war Vertretern des Herzogshauses und des nassauischen Adels vorbehalten. Die zweite Kammer repräsentierte nur einen prozentual kleinen Teil der nassauischen Untertanen, sie vertrat ihre Rechte aber mit wachsendem Selbstbewusstsein und oft in Opposition zu den herzoglichen Vorstellungen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Ziel und Methodik der Arbeit...
- 2. Das Herzogtum Nassau.
- 2.1. Lage und Größe......
- 2.2. Wirtschaft und Sozialstruktur......
- 2.3. Geschichtliche Entwicklung.........
- 3. Untersuchungsgrundlage: „Kollektive Identität“ nach W. Bergem.…………………………..\n
- 4. Untersuchung zur nassauischen Identitätsfindung und -stiftung
- 4.1. Bäderwesen, Baupolitik und Tourismus..\n
- 4.2. Geschichts- und Erinnerungspolitik ......
- 5. Gruppenspezifische Auswertung der Untersuchung .\n
- 5.1. Herzogliche und regierungsseitige Identitätsstiftung ..
- 5.2. Bürgerlich-liberale Identitätsansätze.\n
- 5.3.,,Nassauische Identität“ der einfachen Landbevölkerung?.\n
- 6. Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse ...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Identitätsbildung des Herzogtums Nassau im 19. Jahrhundert und beleuchtet dabei, wie unterschiedliche Akteure eine kollektive Identität für diesen deutschen Mittelstaat zu etablieren versuchten. Dabei geht es nicht um „nation building“ im engeren Sinne, sondern um die Entwicklung einer spezifischen nassauischen Identität innerhalb des deutschen Kontextes. Die Arbeit untersucht insbesondere die Strategien der herzoglichen Regierungen und des bürgerlichen Lagers sowie deren Auswirkungen auf die Selbstwahrnehmung der Bevölkerung.
- Identitätsbildung in einem deutschen Einzelstaat
- Rolle von Akteuren wie Herzögen, Regierungen und Bürgertum
- Politische, wirtschaftliche und kulturelle Strategien zur Identitätsfindung
- Beeinflussung der Selbstwahrnehmung der Bevölkerung
- Vergleichende Analyse von Identitätsvorstellungen unterschiedlicher Gruppen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung definiert Ziel und Methodik der Arbeit. Kapitel 2 präsentiert das Herzogtum Nassau in seiner geographischen, sozialen und wirtschaftlichen Situation sowie seiner historischen Entwicklung unter den drei Herzögen Friedrich August, Wilhelm und Adolph. Kapitel 3 erläutert den Begriff der „Kollektiven Identität“ nach Wolfgang Bergem und legt die Fragestellungen für die anschließende Untersuchung fest. Kapitel 4 analysiert die nassauische Identitätsbildung anhand von Tourismus, Baupolitik und Geschichtspolitik. Kapitel 5 untersucht die Identitätsvorstellungen des Herzoglichen Hauses, der bürgerlichen Opposition und der einfachen Landbevölkerung. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse schließt die Arbeit ab.
Schlüsselwörter
Nassau, Identität, Identitätsbildung, deutscher Mittelstaat, Herzogtum, 19. Jahrhundert, Kollektive Identität, Akteure, Politische Strategien, Wirtschaft, Baupolitik, Tourismus, Geschichtspolitik, Bürgertum, Landbevölkerung.
Häufig gestellte Fragen
Wie entstand das Herzogtum Nassau historisch?
Nassau entstand zwischen 1803 und 1815 durch den Reichsdeputationshauptschluss und den Wiener Kongress aus zahlreichen kleinen, heterogenen Territorien.
Welche Strategien nutzte die Regierung zur Identitätsstiftung?
Die herzogliche Regierung setzte auf Baupolitik, die Förderung des Bäderwesens (Tourismus) sowie auf eine gezielte Geschichts- und Erinnerungspolitik.
Welche Rolle spielte das Bürgertum bei der nassauischen Identitätsfindung?
Das bürgerlich-liberale Lager entwickelte oft eigene, teils oppositionelle Identitätsansätze, die auf politische Mitbestimmung und eine Abgrenzung von der herzoglichen Herrschaft zielten.
Was ist unter „Bürgerbädern“ und „Herzogsbauten“ zu verstehen?
Diese Begriffe symbolisieren die unterschiedlichen Akteure: Die Herzöge prägten das Land durch repräsentative Bauten, während das Bürgertum das Kur- und Badewesen als gesellschaftlichen Raum nutzte.
Fühlte sich die einfache Landbevölkerung als „Nassauer“?
Die Arbeit untersucht kritisch, inwieweit die staatlich verordnete Identität die ländliche Bevölkerung tatsächlich erreichte oder ob lokale Identitäten dominierten.
- Quote paper
- Gerhard Schmidt (Author), 2019, Herzogsbauten und Bürgerbäder. Akteure und Elemente der Identitätsbildung des Herzogtums Nassau (1806-1866), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/535884