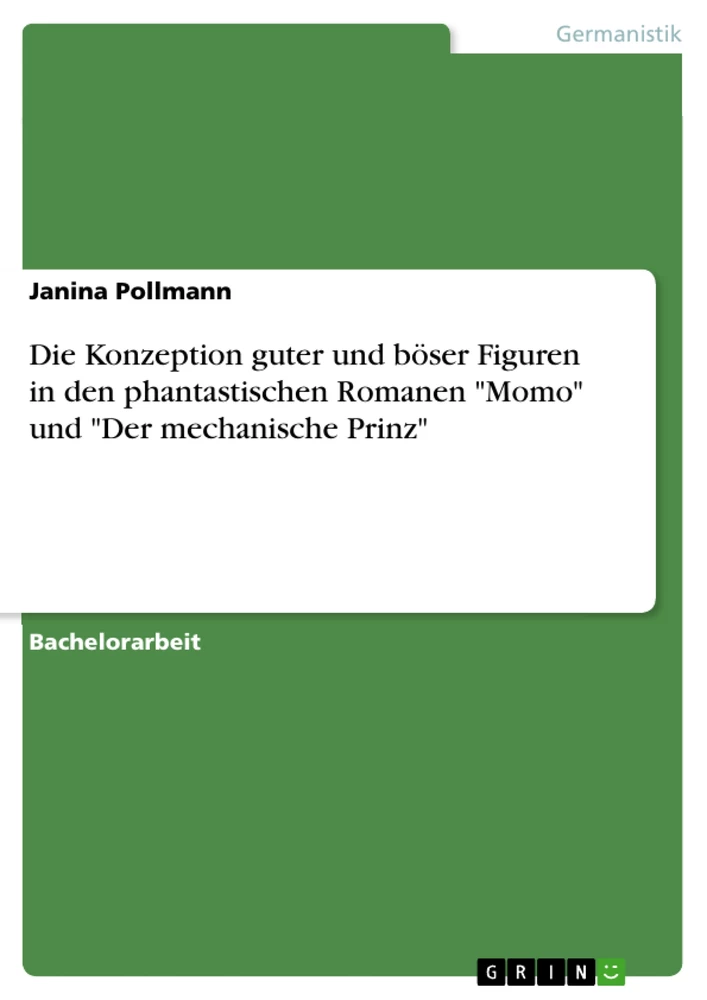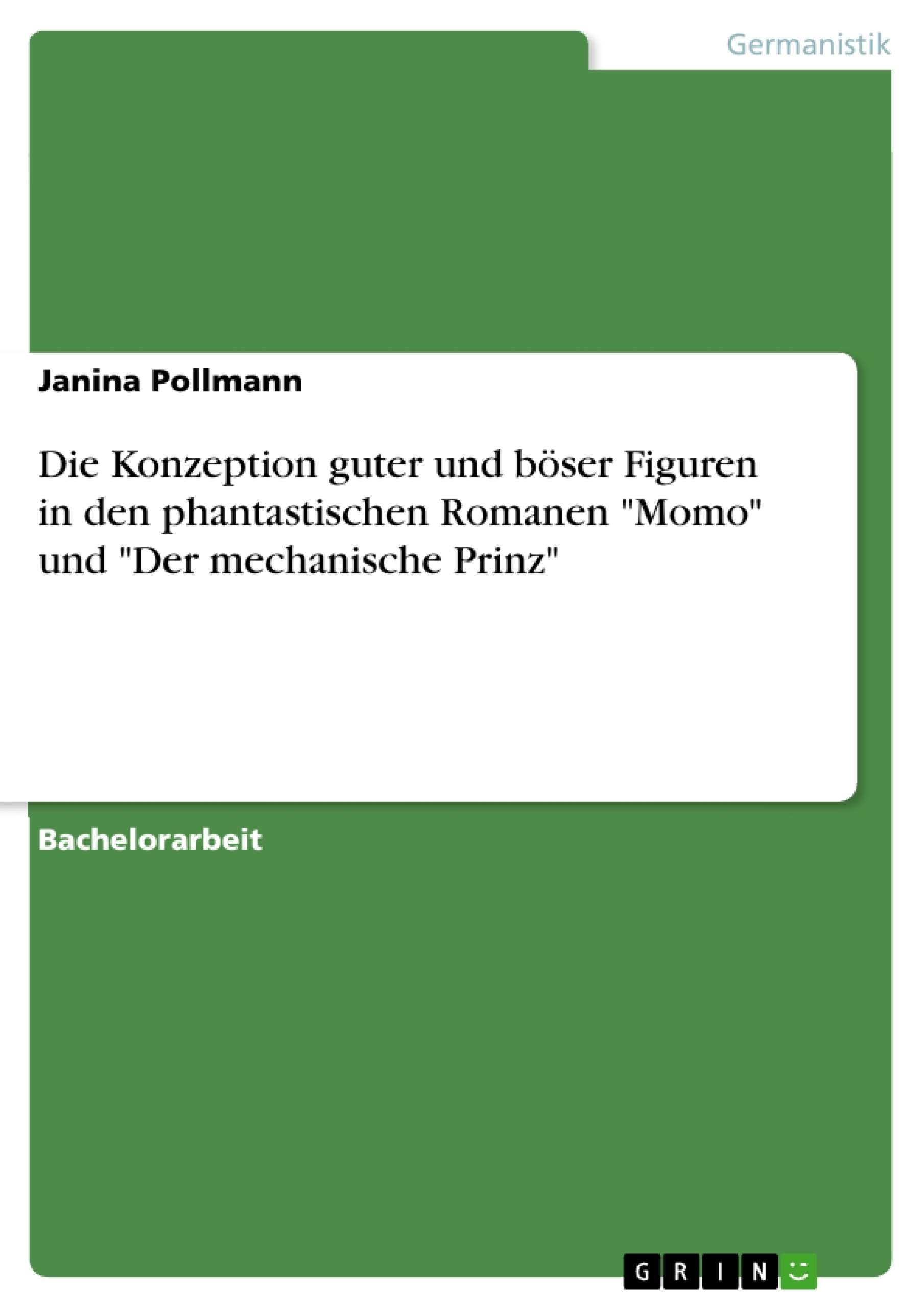Rotkäppchen und der Wolf, Krabat und der Müller, sogar Kasper und das Krokodil: Hinweg über verschiedenste Kulturen, Epochen und Genres gibt es das Motiv des Guten gegen das Böse. Ziel dieser Arbeit soll es sein, zu schauen, ob wirklich alle Figuren so konzipiert sind, dass sie sich problemlos einer Kategorie zuordnen lassen, oder ob es vielleicht doch Figuren gibt, welche sich zwischen den beiden Extremen des Guten und des Bösen bewegen. Dies wird abschließend in einem Fazit dargestellt.
Bereits gegen Ende des vierten Lebensjahres entwickelt sich bei Kindern eine Vorläuferform des Gewissens: Ein Gefühl für Gut und Böse. Somit gelingt es diesen schnell zu differenzieren, bei welchen Figuren es sich um die "Guten" und bei welchen um die "Bösen" handelt. Dies gilt insbesondere für den Raum der Literatur. Hier begegnen ihnen schon früh allerlei böse Wölfe und gute Prinzen. In der Regel erzieht uns dies zu Sympathisanten des Protagonisten, bei welchem häufig bereits zu Beginn deutlich wird, dass es sich um eine Figur handelt, welche sich einer Bedrohung durch das Böse stellen muss. Ein schönes Beispiel hierfür ist Joanne K. Rowlings "Harry Potter": Der gute Zauberer gegen den bösen Magier Voldemort. Doch kann man wirklich behaupten, dass die Figur des Harry Potter ein durch und durch guter Charakter ist? Was ist demnach beispielsweise mit seinem unbändigen Hass auf Bellatrix Lestrange und seinem Wunsch, sie zu töten, nachdem diese seinen Onkel Sirius Black ermordet hat?
Es scheint also klar zu sein, dass eine bloße Kategorisierung nach Gut und Böse nicht so einfach ist, wie es zunächst den Anschein hat. Diese Arbeit wird sich näher mit den Figurenkonzeptionen in zwei ausgewählten Romanen der phantastischen Kinder- und Jugendliteratur befassen, um diesem Problem auf den Grund zu gehen. Hierbei wird das Augenmerk zunächst auf Michael Endes "Momo", einem Roman der 1970er Jahre, liegen, um sich danach dem "Mechanischen Prinzen" von Andreas Steinhövel, aus dem Jahr 2002, zuzuwenden. Diese beiden Romane sind bewusst gewählt, um schließlich zu schauen, ob auch der Entstehungszeitraum möglicherweise Auswirkungen auf die Konzeption der Figuren hat.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Analyse der Figuren in Michael Endes „Momo“
- 2.1 Die Protagonistin „Momo“
- 2.1.1 Die „Glücksbringerin“
- 2.1.2 Das „Gute“ in Momo
- 2.1.3 Zur Konzeption der Figur
- 2.2 Momos Freunde
- 2.2.1 Beppo Straßenkehrer
- 2.2.1.1 Das „Gute“ in Beppo
- 2.2.1.2 Verführung durch die grauen Herren
- 2.2.2 Gigi Fremdenführer
- 2.2.2.1 Das „Gute“ in Gigi
- 2.2.2.2 Verführung durch die grauen Herren
- 2.2.3 Zur Konzeption der Figuren
- 2.2.1 Beppo Straßenkehrer
- 2.3 Die grauen Herren
- 2.3.1 Äußere Merkmale des Bösen
- 2.3.2 Kälte und Tod
- 2.3.3 Parasitismus
- 2.3.4 Kriminelle Machenschaften
- 2.3.5 Zur Konzeption der Figuren
- 2.1 Die Protagonistin „Momo“
- 3. Analyse der Figuren in Andreas Steinhövels „Der mechanische Prinz“
- 3.1 Der Protagonist Max
- 3.1.1 Auslöser des „Bösen“ in Max
- 3.1.2 Das „Gute“ in Max
- 3.1.3 Das „Böse“ in Max
- 3.1.4 Max moralischer Werdegang: Im Reich des mechanischen Prinzen
- 3.1.5 Zur Konzeption der Figur
- 3.2 Die Kontrastfigur Jan
- 3.2.1 Das „Gute“ in Jan
- 3.2.2 Das „Böse“ in Jan
- 3.2.3 Zur Konzeption der Figur
- 3.3 Max und Jan als Einheit
- 3.4 Die Prüfungsinstanz: Der mechanische Prinz
- 3.4.1 Das „Böse“ im Prinzen
- 3.4.2 Das „Gute“ im Prinzen
- 3.4.3 Zur Konzeption der Figur
- 3.5 Die Erzähl-/Reflexionsinstanz: Der Kinderbuchautor
- 3.5.1 Das „Böse“ im Autor
- 3.5.2 Das „Gute“ im Autor
- 3.5.3 Zur Konzeption der Figur
- 3.1 Der Protagonist Max
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Konzeption guter und böser Figuren in Michael Endes „Momo“ und Andreas Steinhövels „Der mechanische Prinz“. Ziel ist es zu analysieren, ob die Figuren eindeutig den Kategorien „gut“ oder „böse“ zugeordnet werden können oder ob sich einige zwischen diesen Extremen bewegen. Der Einfluss des Entstehungszeitraums auf die Figurenkonzeption wird ebenfalls betrachtet.
- Analyse der Figurenkonzeption in phantastischer Kinder- und Jugendliteratur
- Untersuchung der Ambivalenz von Gut und Böse in literarischen Figuren
- Vergleich der Figurenkonzeptionen in zwei Romanen unterschiedlicher Epochen
- Beurteilung der eindeutigen Zuordnung von Figuren zu Gut und Böse
- Einfluss des Entstehungszeitraums auf die Darstellung von Gut und Böse
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Ambivalenz von Gut und Böse in der phantastischen Literatur ein und stellt die Forschungsfrage nach der eindeutigen Zuordnung von Figuren zu diesen Kategorien. Sie begründet die Auswahl der beiden Romane „Momo“ und „Der mechanische Prinz“ und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit. Die Einleitung betont die Komplexität der Thematik und den Wunsch, über eine einfache Dichotomie von Gut und Böse hinauszugehen.
2. Analyse der Figuren in Michael Endes „Momo“: Dieses Kapitel analysiert die Figuren in Michael Endes „Momo“, um deren Konzeption im Hinblick auf Gut und Böse zu untersuchen. Es werden die Protagonistin Momo, ihre Freunde und die antagonistischen „grauen Herren“ detailliert betrachtet, wobei deren Handlungen, Motive und Wirkung auf die Umwelt im Kontext von Gut und Böse eingeordnet werden. Die Analyse zielt darauf ab, die Komplexität der Figuren darzustellen und deren Ambivalenz aufzuzeigen, falls vorhanden.
3. Analyse der Figuren in Andreas Steinhövels „Der mechanische Prinz“: Analog zum vorherigen Kapitel werden hier die Figuren in Steinhövels „Der mechanische Prinz“ analysiert. Der Fokus liegt auf dem Protagonisten Max, der Kontrastfigur Jan und dem „mechanischen Prinzen“ als Prüfungsinstanz. Die Analyse beleuchtet die moralische Entwicklung der Figuren und deren Handlungen im Kontext der Geschichte, um deren Konzeption hinsichtlich Gut und Böse zu ergründen. Der Kinderbuchautor als Erzählinstanz wird ebenfalls mit einbezogen.
Schlüsselwörter
Figurenkonzeption, phantastische Kinder- und Jugendliteratur, Gut und Böse, Ambivalenz, Moral, Michael Ende, Momo, Andreas Steinhövel, Der mechanische Prinz, Charakteranalyse, Erzählperspektive.
Häufig gestellte Fragen zu der Bachelorarbeit: Figurenkonzeption in „Momo“ und „Der mechanische Prinz“
Was ist das Thema der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit analysiert die Konzeption von guten und bösen Figuren in Michael Endes „Momo“ und Andreas Steinhövels „Der mechanischen Prinz“. Im Fokus steht die Frage, ob die Figuren eindeutig als „gut“ oder „böse“ kategorisiert werden können oder ob sie zwischen diesen Extremen angesiedelt sind. Der Einfluss des Entstehungszeitpunkts der Romane auf die Figurenkonzeption wird ebenfalls untersucht.
Welche Romane werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Figuren in Michael Endes „Momo“ und Andreas Steinhövels „Der mechanische Prinz“. Diese beiden Romane wurden ausgewählt, um einen Vergleich der Figurenkonzeptionen in unterschiedlichen Epochen der Kinder- und Jugendliteratur zu ermöglichen.
Welche Figuren werden im Detail untersucht?
In „Momo“ werden Momo, ihre Freunde (Beppo und Gigi) und die grauen Herren analysiert. In „Der mechanische Prinz“ stehen Max, Jan, der mechanische Prinz und der Kinderbuchautor (als Erzählinstanz) im Mittelpunkt der Untersuchung.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Lassen sich die Figuren in „Momo“ und „Der mechanische Prinz“ eindeutig den Kategorien „gut“ oder „böse“ zuordnen, oder zeigen sie eine Ambivalenz? Die Arbeit untersucht, ob eine einfache Dichotomie von Gut und Böse ausreicht, um die Komplexität der Figuren zu erfassen.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine detaillierte Figurencharakterisierung und -analyse. Die Handlungen, Motive und die Wirkung der Figuren auf ihre Umwelt werden im Kontext von Gut und Böse eingeordnet. Dabei wird auch der Einfluss des Entstehungszeitraums der Romane berücksichtigt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, zwei Kapitel zur Figuren-analyse von „Momo“ und „Der mechanische Prinz“, ein Fazit und ein Inhaltsverzeichnis mit detaillierter Gliederung. Zusätzlich enthält die Arbeit eine Zusammenfassung der Kapitel, die Zielsetzung und die verwendeten Schlüsselwörter.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Figurenkonzeption, phantastische Kinder- und Jugendliteratur, Gut und Böse, Ambivalenz, Moral, Michael Ende, Momo, Andreas Steinhövel, Der mechanische Prinz, Charakteranalyse, Erzählperspektive.
Welches Ziel verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Komplexität der Figurenkonzeption in phantastischer Kinder- und Jugendliteratur zu untersuchen und die Ambivalenz von Gut und Böse in literarischen Figuren aufzuzeigen. Ein weiterer Aspekt ist der Vergleich der Figurenkonzeption in zwei Romanen unterschiedlicher Epochen.
- Quote paper
- Janina Pollmann (Author), 2018, Die Konzeption guter und böser Figuren in den phantastischen Romanen "Momo" und "Der mechanische Prinz", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/535934