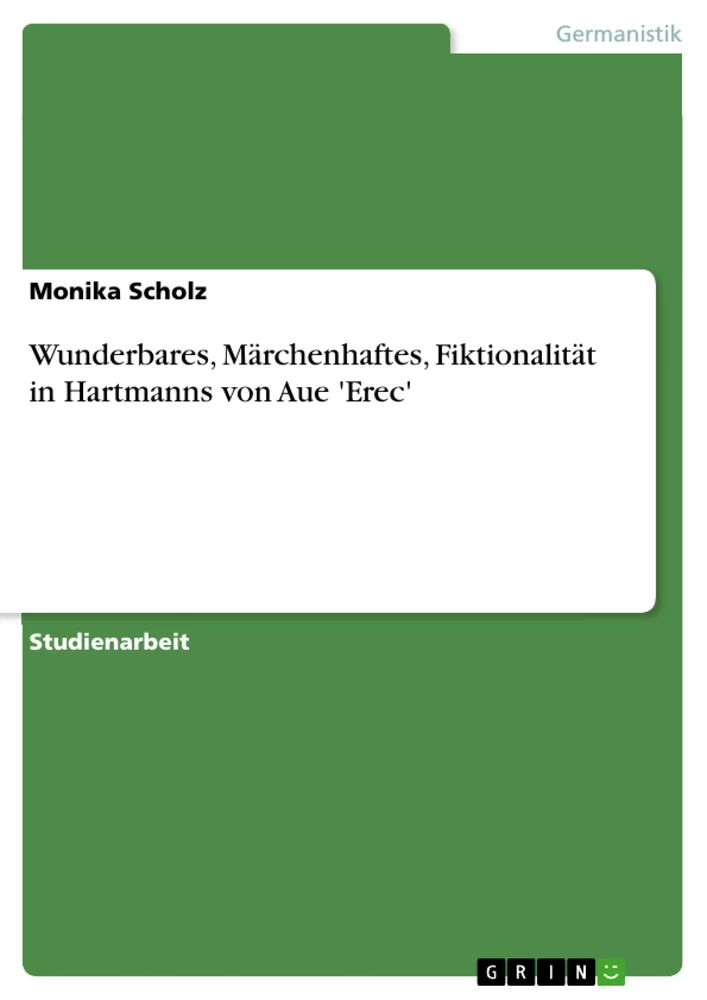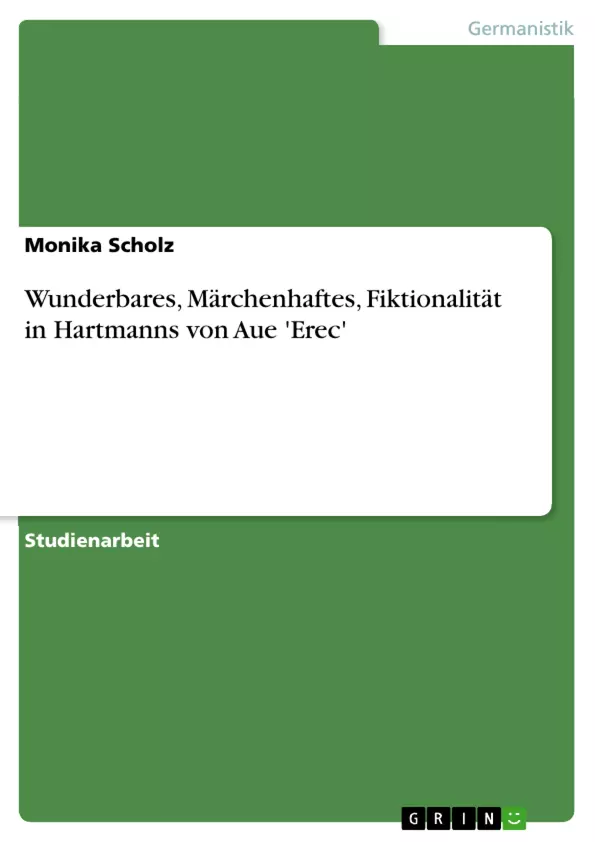Hartmanns von Aue Werk Erec (entstanden zwischen 1180 und 1190) gilt als der erste deutsche Roman überhaupt, mit dem außerdem die Tradition der Artusromane in Deutschland einsetzt. Hartmanns Roman liegt das französische Werk Erec et Enide von Chrétien de Troyes zugrunde, welches als „erster europäischer vulgärsprachlicher Roman des Mittelalters, den man als fiktiv bezeichnen darf“ (Walter Haug) gefeiert wird.
Vorliegende Arbeit setzt sich mit den Anzeichen für Fiktionalität in Hartmanns Erec auseinander. An zahlreichen Textstellen soll gezeigt werden, wie Fiktion im Text vermittelt wird. Es wird auch auf immer wieder auftauchende wunderbare und märchenhafte Züge verwiesen, die ebenfalls belegen können, dass es sich um einen fiktiven Text handelt.
Im Schlussteil wird geklärt, ob die von Grünkorn aufgestellten Fiktionskriterien auch auf Hartmanns Erec zutreffen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- Einführung in die grundlegende Thematik der vorliegenden Arbeit
- II. Hauptteil
- 1. Fiktionalität – eine Begriffsbestimmung
- 2. Exkurs: Die literaturtheoretischen Hintergründe
- 3. Konkrete Beispiele für die Vermittlung von Fiktion im Text
- 3.1 Die Beschreibung von Enites Pferd (V. 7265 – 7766): Fiktiver Hörer-Erzähler-Dialog
- 3.2 Weitere ausgewählte Stellen im Text, in denen der Erzähler mit dem Hörer kommuniziert
- 4. Der Prolog
- 5. Wunderbares
- 5.1 Ein Beispiel für wunderbares Erzählen: die Zauberin Fâmurgân
- 5.2 weitere wunderbare Dinge
- 6. Märchenhaftes
- III. Schluss
- Zusammenfassung aller bisherigen Erkenntnisse und Bilanz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Frage, ob Hartmanns von Aue Erec, der als erster deutscher Roman gilt, als fiktionaler Roman bezeichnet werden kann. Sie beschäftigt sich mit dem Begriff der Fiktionalität und beleuchtet, inwiefern dieser in Hartmanns Werk erfüllt wird.
- Der Begriff der Fiktionalität und seine Kriterien
- Die literaturtheoretischen Hintergründe der Fiktionalität in der Antike und dem Frühmittelalter
- Die Analyse von Textstellen in Hartmanns Erec, die auf Fiktionalitätssignale hindeuten
- Die Rolle von Wunderbarem und Märchenhaftem im Werk
- Die Relevanz von Hartmanns Werk im Kontext der Entwicklung des Romans im Mittelalter
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt den Kontext von Hartmanns Erec in der Entwicklung des Romans dar. Der Hauptteil beginnt mit einer Definition des Begriffs „Fiktionalität“ und beleuchtet die Kriterien, die zur Bestimmung von Fiktionalität in Texten heranzuziehen sind. Ein Exkurs widmet sich den literaturtheoretischen Hintergründen des Themas in der Antike und dem Frühmittelalter. Anschließend werden konkrete Textstellen in Hartmanns Erec analysiert, die die Anwendung von Fiktionalitätskriterien belegen. Der Abschnitt über Wunderbares und Märchenhaftes untersucht die Rolle dieser Elemente im Text.
Schlüsselwörter
Fiktionalität, Roman, Mittelalter, Hartmann von Aue, Erec, Chrétien de Troyes, Enide, Wunderbares, Märchenhaftes, Literaturtheorie, Antike, Frühmittelalter, Grünkorn, Haug, Ridder.
Häufig gestellte Fragen
Warum gilt Hartmanns „Erec“ als Meilenstein der deutschen Literatur?
Er gilt als der erste deutsche Roman überhaupt und begründet die Tradition der Artusromane im deutschsprachigen Raum.
Welche Signale für Fiktionalität finden sich im Text?
Anzeichen sind unter anderem fiktive Hörer-Erzähler-Dialoge, wie bei der Beschreibung von Enites Pferd, sowie die bewusste Kommunikation des Erzählers mit dem Publikum.
Was unterscheidet den „Erec“ von historischen Berichten?
Die Arbeit zeigt auf, dass wunderbare und märchenhafte Züge (z. B. die Zauberin Fâmurgân) belegen, dass es sich um einen fiktiven, künstlerisch gestalteten Text handelt.
Welche Rolle spielt die französische Vorlage?
Hartmanns Werk basiert auf „Erec et Enide“ von Chrétien de Troyes, dem ersten europäischen vulgärsprachlichen Roman des Mittelalters.
Wie wird das Wunderbare im Roman eingesetzt?
Wunderbare Elemente dienen als literarische Mittel, um die fiktive Welt des Artushofes zu charakterisieren und von der Alltagswelt abzuheben.
- Quote paper
- Monika Scholz (Author), 2006, Wunderbares, Märchenhaftes, Fiktionalität in Hartmanns von Aue 'Erec', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/53600