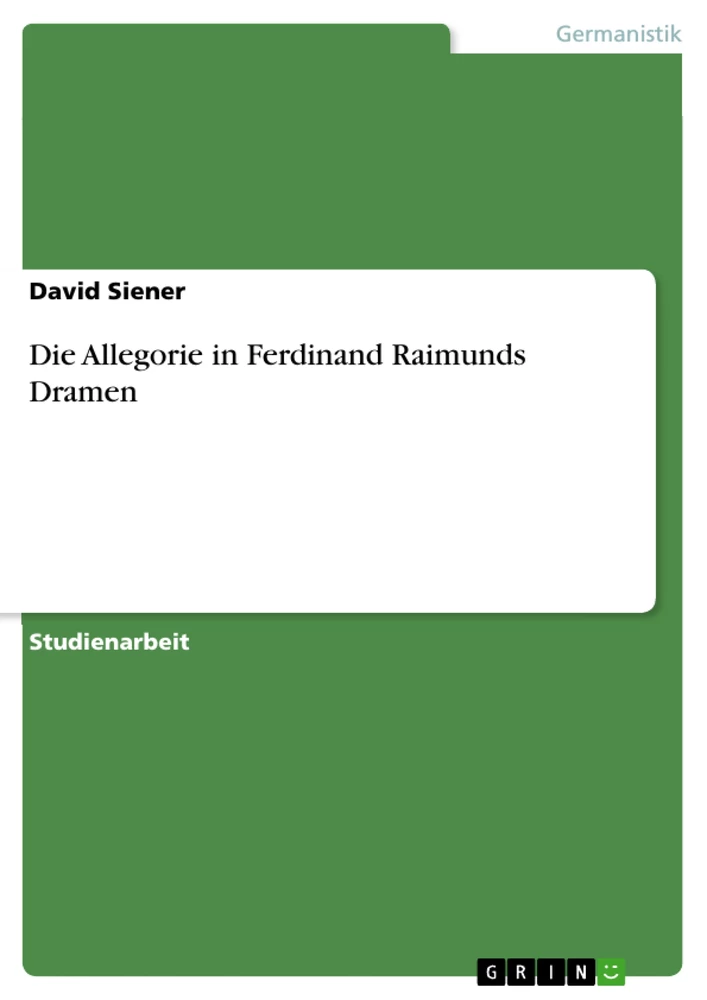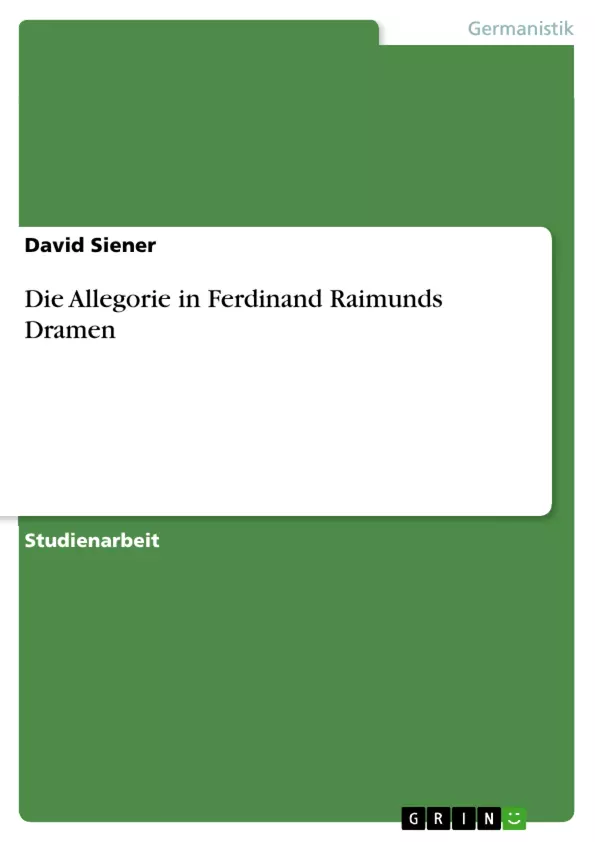Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Verwendung der Allegorie in den Dramen Ferdinand Raimunds. Dabei gilt es zunächst einmal, den oft gebrauchten, jedoch auch oft wenig überdachten Begriff ‚Allegorie’ für diese Arbeit im Vorfeld zu klären. Es darf hier aber keine Definition mit Anspruch auf Allgemeingültigkeit erwartet werden, da die Klärung des Terminus ‚Allegorie’ nur in dem Ausmaß zur Geltung kommen soll, in welchem es für die weitere Beschäftigung mit dem eigentlichen Thema dieser Arbeit sinnvoll ist. Des Weiteren wird der Schwerpunkt bei der Beschäftigung mit der Allegorie auf der näheren Betrachtung der allegorischen Personifikation liegen, denn gerade dieses Phänomen ist es, welches dem Leser und Zuschauer der Raimundschen Dramen begegnet. In diesem Zusammenhang soll auch die Verwendung der Allegorie zur Zeit des literarischen Barock, hauptsächlich in den so genannten Jesuitendramen, ein Teil der Arbeit sein. Ferdinand Raimund wurde und wird nur zu gern im Lichte dieser barocken Tradition gesehen und daher darf eine Darstellung der Kontinuitätskonstruktion, die einige Forscher daraus ableiten, nicht ausgespart bleiben. Nicht zuletzt wird dadurch, ohne im Besonderen darauf eingehen zu müssen, auch einiges über die Rezeptionsgeschichte der Dramen Raimunds klar.
Der Ablauf der Arbeit wird somit folgender sein: ein erster Teil bemüht sich, wie oben beschrieben, um die Klärung des Terminus ‚Allegorie’. Es folgt ein historischer Abriss über das barocke Jesuitendrama und dessen Allegorienverwendung. Dieser Abschnitt wird sich auch genauer mit der Funktion der Allegorie beschäftigen, die diesen Stücken zu Eigen ist. Im Hauptteil der Arbeit wird dann die Verwendung der Allegorie in den Raimundschen Dramen im Zentrum stehen. Wie bereits erwähnt, soll hierbei auch die Traditionslinie aufgezeigt werden, die zwischen der Epoche des literarischen Barock und Ferdinand Raimund in der Forschung immer wieder eine Rolle spielt. Eine Beschäftigung mit allen Dramen würde den inhaltlichen Rahmen dieser Arbeit sprengen, weswegen das Hauptaugenmerk dem StückDas Mädchen aus der Feenwelt oder Der Bauer als Millionärgewidmet werden soll. Andere Texte werden nur partiell betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Allegorie
- Begriffs(er)klärung
- Die allegorische Personifikation
- Das barocke Jesuitendrama
- Entstehung und Entwicklung
- Verwendung und Funktion der Allegorie
- Die Allegorie in Raimunds Dramen
- Kontinuitätskonstruktion oder: Ferdinand Raimund, ein barocker Dichter(?)
- Verwendung und Funktion der Allegorie in Raimunds „Das Mädchen aus der Feenwelt oder Der Bauer als Millionär”
- Aussicht auf einige andere Dramen Raimunds
- „Der Alpenkönig und der Menschenfeind”
- ,,Die gefesselte Phantasie”
- Schlusswort
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Verwendung der Allegorie in den Dramen Ferdinand Raimunds. Sie untersucht den Begriff der Allegorie und seine Bedeutung im Kontext der Dramen, insbesondere die Rolle der allegorischen Personifikation. Zudem werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Raimunds Dramen und dem barocken Jesuitendrama, das ebenfalls stark von der Allegorie geprägt ist, beleuchtet.
- Klärung des Begriffs „Allegorie”
- Analyse der allegorischen Personifikation in Raimunds Dramen
- Vergleich der Allegorieverwendung in Raimunds Dramen und dem barocken Jesuitendrama
- Untersuchung der Traditionslinie zwischen dem Barock und Raimund
- Rezeptionsgeschichte der Dramen Raimunds
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Allegorie in den Dramen Ferdinand Raimunds ein und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Sie beschreibt den Aufbau der Arbeit und die verschiedenen Themenbereiche, die behandelt werden.
Das Kapitel „Die Allegorie“ definiert den Begriff der Allegorie und erläutert ihre Bedeutung im Kontext der Dramen. Es wird die doppelte Bedeutung der Allegorie – die wörtliche und die allegorische – hervorgehoben und die Funktion der allegorischen Personifikation erläutert.
Das Kapitel „Das barocke Jesuitendrama“ betrachtet die Entstehung und Entwicklung des Jesuitendramas und untersucht die Verwendung der Allegorie in diesem Genre. Es wird die Funktion der Allegorie in diesen Stücken analysiert und auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu Raimunds Dramen hingewiesen.
Das Kapitel „Die Allegorie in Raimunds Dramen“ konzentriert sich auf die Verwendung der Allegorie in den Dramen Raimunds. Es untersucht die Kontinuitätskonstruktion, die von einigen Forschern zwischen dem Barock und Raimund gezogen wird, und analysiert die Rolle der Allegorie im Stück „Das Mädchen aus der Feenwelt oder Der Bauer als Millionär“. Das Kapitel beleuchtet auch die Verwendung der Allegorie in anderen Dramen Raimunds, wie „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ und „Die gefesselte Phantasie“.
Schlüsselwörter
Allegorie, Ferdinand Raimund, Barock, Jesuitendrama, Dramen, Personifikation, Metapher, Symbol, Tradition, Rezeption, „Das Mädchen aus der Feenwelt oder Der Bauer als Millionär“, „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“, „Die gefesselte Phantasie”.
- Quote paper
- David Siener (Author), 2006, Die Allegorie in Ferdinand Raimunds Dramen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/53632