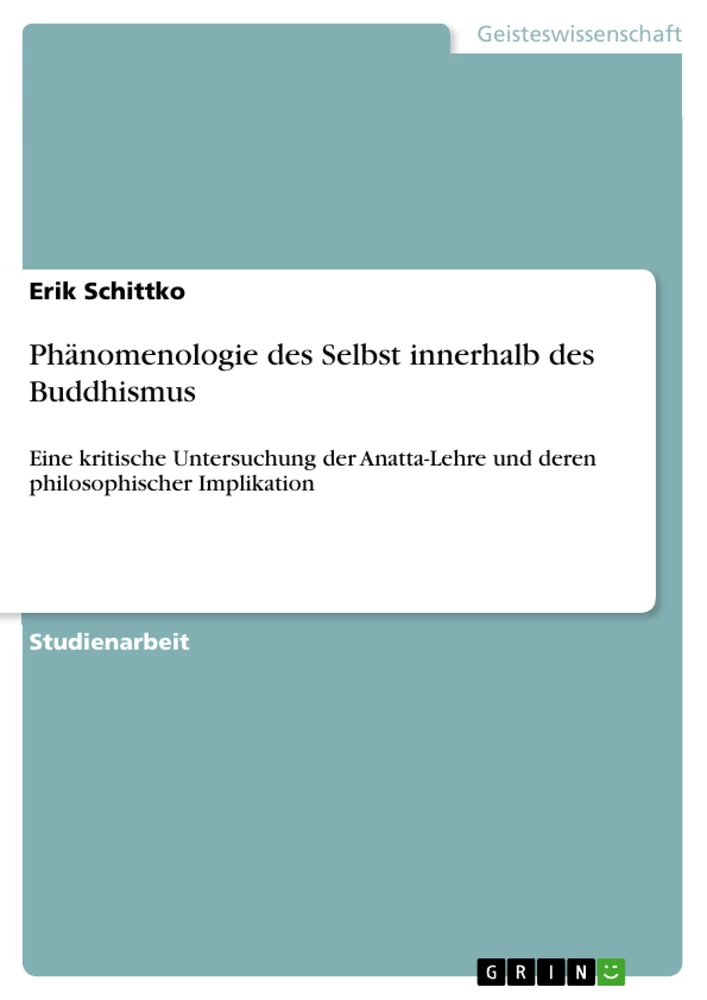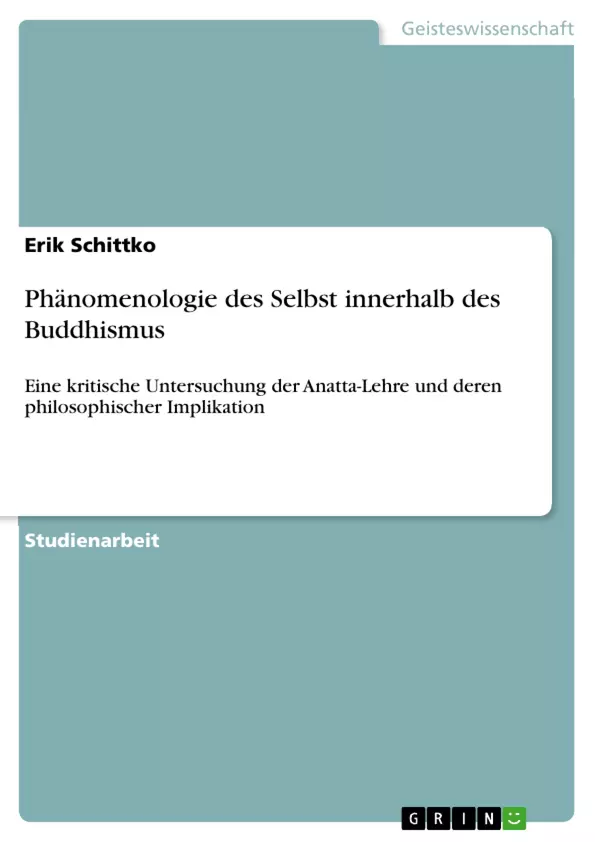Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, zu klären, in welcher Art und Weise innerhalb der buddhistischen Schulen die Negierung des Egos begründet wird. In diesem Kontext erfolgt die Auseinandersetzung mit dem Gleichnis des Wagens, welches die attributive Zusammensetzung von Objekten auf die Individuationsbeschaffenheit von Subjekten überträgt. Darüber hinaus werden hinsichtlich ethischer Konsequenzen der Anatta-Lehre Parallelen zu Philosophen des deutschen Idealismus aufgezeigt. Hierbei steht vor allem die kritische Frage im Fokus, ob die Entsagung der individuellen Wesenhaftigkeit einer Person, totalitäre Kollektivierungsprozesse in verschiedenen buddhistischen Ländern begünstigen konnte.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Nicht-Ich-Lehre im Kontext der Daseinsfaktoren und des Leidens
- 3 Das Gleichnis des Wagens als Partikularisierung der Persönlichkeit
- 4 Altruismus als ethische Konsequenz der Selbstlosigkeit
- 5 Negation des Egos als Basis kollektivistisch-egalitärer Ideologie
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die buddhistische Anatta-Lehre, die die Nicht-Existenz eines festen Selbst postuliert. Sie analysiert, wie diese Lehre die Persönlichkeit des Menschen definiert und wie sie sich von westlichen Selbstverständnissen unterscheidet. Des Weiteren werden die ethischen Konsequenzen der Anatta-Lehre und ihre möglichen Auswirkungen auf gesellschaftliche Strukturen beleuchtet.
- Die Anatta-Lehre und ihre Kritik an der westlichen Selbstverständnisses
- Die fünf Daseinsfaktoren und ihre Rolle in der buddhistischen Anthropologie
- Das Gleichnis des Wagens als Metapher für die zusammengesetzte Natur der Persönlichkeit
- Die ethischen Konsequenzen der Selbstlosigkeit im Buddhismus
- Mögliche Auswirkungen der Anatta-Lehre auf gesellschaftliche Strukturen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und erläutert die Bedeutung der Selbsterkenntnis in verschiedenen Kulturen. Sie führt in die buddhistische Anatta-Lehre ein und zeigt deren Kontrast zum westlichen Selbstverständnis.
- Kapitel 2: Die Nicht-Ich-Lehre im Kontext der Daseinsfaktoren und des Leidens
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der buddhistischen Lehre vom "Nicht-Ich" (Anatta) und erklärt die fünf Daseinsfaktoren, die die menschliche Persönlichkeit bilden. Es zeigt auf, wie die Vergänglichkeit dieser Faktoren zu Leiden führt und die Illusion eines festen Selbst erzeugt.
- Kapitel 3: Das Gleichnis des Wagens als Partikularisierung der Persönlichkeit
Der Fokus dieses Kapitels liegt auf dem Gleichnis des Wagens, das als Metapher für die zusammengesetzte Natur der Persönlichkeit verwendet wird. Das Gleichnis verdeutlicht, dass das Individuum kein unabhängiges Selbst besitzt, sondern aus verschiedenen, miteinander verbundenen Faktoren besteht.
- Kapitel 4: Altruismus als ethische Konsequenz der Selbstlosigkeit
Dieses Kapitel analysiert die ethischen Implikationen der Anatta-Lehre. Es zeigt auf, wie die Erkenntnis der Selbstlosigkeit zu einem Leben im Dienste anderer führen kann und Parallelen zu philosophischen Konzepten des deutschen Idealismus aufzeigt.
Schlüsselwörter
Anatta, Selbstlosigkeit, Daseinsfaktoren, Skandhas, Leiden, Gleichnis des Wagens, Altruismus, kollektivistische Ideologie, buddhistische Philosophie, westliche Selbstverständnisse.
- Citar trabajo
- Erik Schittko (Autor), 2019, Phänomenologie des Selbst innerhalb des Buddhismus, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/536340