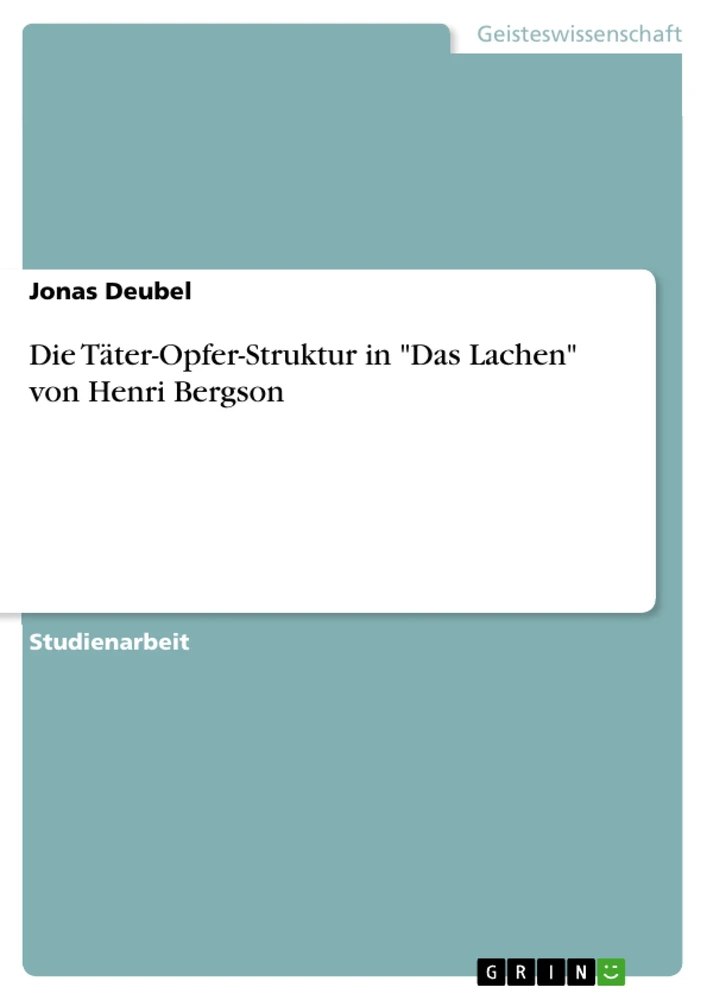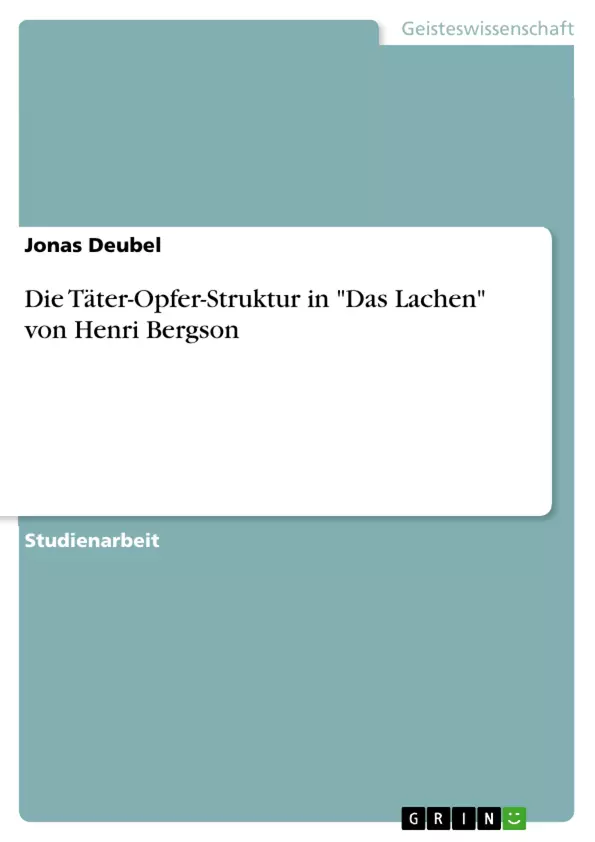In der Komik scheint es nach Bergson also immer einen Täter zu geben, der lacht, und ein Opfer, über das gelacht wird. Dass Bergson diese Sichtweise, diese Täter-Opfer-Struktur der Komik, in allen möglichen Arten der Komik zu finden glaubt, will ich in der vorliegenden Arbeit überprüfen und diskutieren.
Hierzu möchte ich zunächst den Umfang feststellen, in welchem dieses Prinzip Bergsons gesamtes Verständnis von Komik prägt, sowie alternative Betrachtungsmöglichkeiten heranziehen, um zu sehen ob Bergsons Hervorhebung des Opfers in der Komik, auch in Bezug auf die von ihm formulierten Beispiele, unbedingt ist. In einem weiteren Schritt will ich Bergsons Täter-Opfer-Struktur der Komik kritisch betrachten. Dabei soll es vor allem um die These gehen, ob und inwiefern der Intellekt der Individuen in Bergsons Begriff des Komischen beschränkt wird.
Man kann die Komik, die Bergson beschreibt, grob in zwei verschiedene Arten unterteilen: in die Situationskomik einerseits, in der ganze Situationen komisch erscheinen, und in die Charakterkomik andererseits, in der bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Charakterzüge komisch wirken. Diese Einteilung will ich übernehmen, um möglichst nahe an einem Begriff zu arbeiten, den Bergson meint, wenn er vom Komischen spricht.
Und auch wie Bergson will ich mich in erster Linie an der Komödie orientieren, das heißt an Darstellungen, die komisch wirken sollen. Jedoch möchte ich ebenso nachprüfen, ob sich nicht auch außerhalb der Komödie etwas finden lässt, das in diesem Kontext relevant ist: im alltäglichen Leben, in einem Spiel oder auch in der sozialen Wirklichkeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung in die Komik bei Bergson
- Situationskomik
- Einsichtigkeit und Steigerungsfähigkeit
- Täter-Opfer-Struktur in der Situationskomik
- Kritik der Täter-Opfer-Struktur in der Situationskomik
- Situationskomik im Würfelspiel
- Charakterkomik
- Die "mechanische Steifheit" des Zerstreuten und des Ordentlichen
- Täter-Opfer-Struktur und Karikatur
- Die soziale Funktion der Komik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Henri Bergsons Theorie der Komik im Hinblick auf die Täter-Opfer-Struktur, die er als zentral für das Verständnis des Lächerlichen ansieht. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob diese Struktur tatsächlich alle Arten der Komik durchzieht und ob sie allein ausreicht, um die komische Wirkung zu erklären.
- Analyse der Täter-Opfer-Struktur in Bergsons Komiktheorie
- Untersuchung der Rolle des Intellekts im komischen Geschehen
- Beurteilung der Relevanz der Täter-Opfer-Struktur in unterschiedlichen Formen der Komik (Situationskomik, Charakterkomik)
- Kritische Betrachtung des Begriffs des "Natürlichen" in Bergsons Theorie
- Exploration der sozialen Funktion der Komik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentralen Fragen der Arbeit vor und erläutert Bergsons grundlegende Auffassung von Komik. Kapitel 2 erörtert Bergsons These, dass das Lachen eine Form der sozialen Züchtigung darstellt, bei der es immer einen Täter und ein Opfer gibt. In Kapitel 3 wird die Täter-Opfer-Struktur in der Situationskomik näher beleuchtet, wobei verschiedene Beispiele analysiert werden. Kapitel 4 fokussiert auf die Charakterkomik und untersucht die Rolle der "mechanischen Steifheit" und der Karikatur.
Schlüsselwörter
Henri Bergson, Komik, Täter-Opfer-Struktur, Situationskomik, Charakterkomik, Intellekt, "mechanische Steifheit", soziale Funktion, Lachen, Demütigung, soziale Züchtigung.
- Citar trabajo
- Jonas Deubel (Autor), 2018, Die Täter-Opfer-Struktur in "Das Lachen" von Henri Bergson, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/536379