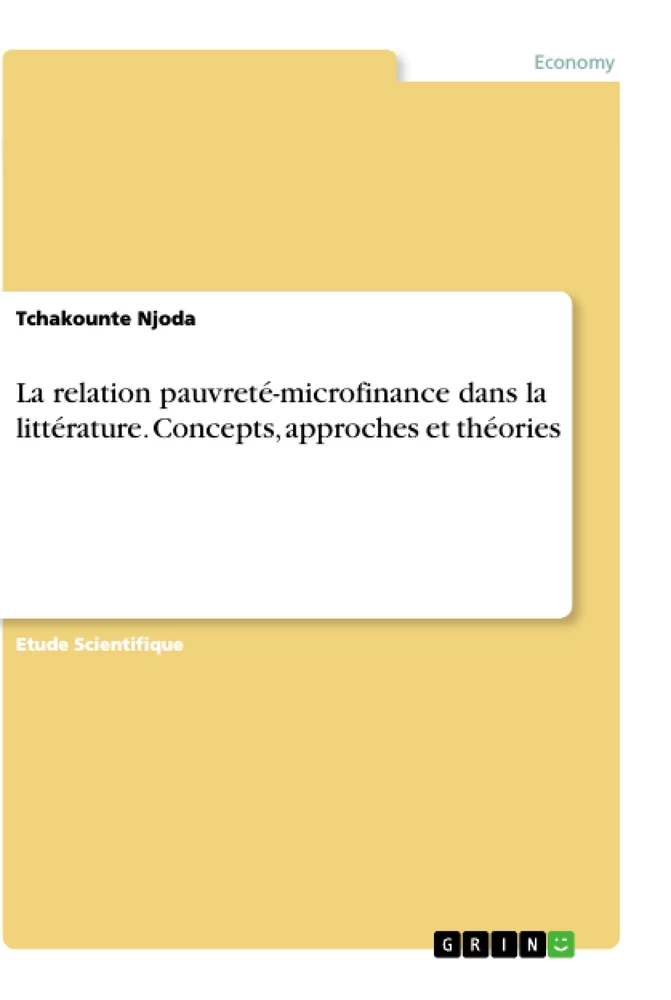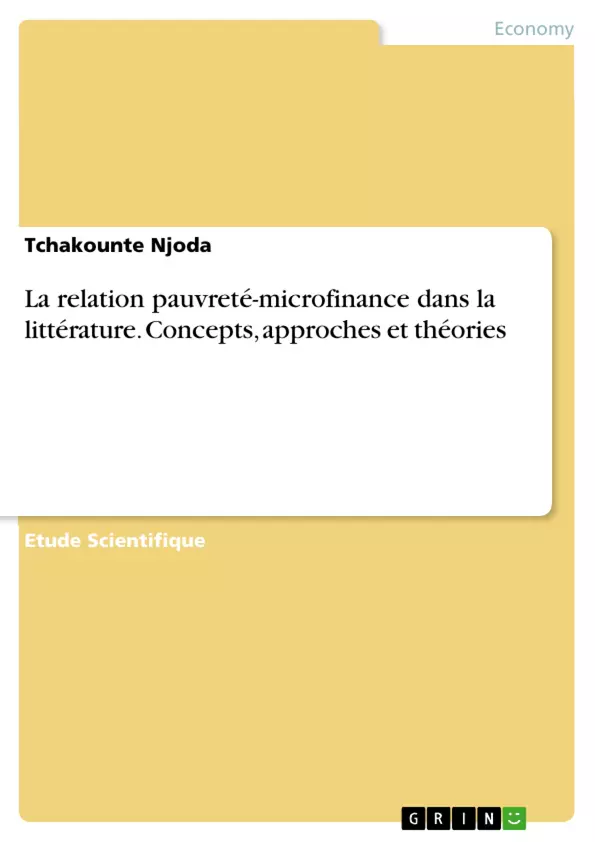La microfinance a gagné en importance en tant qu'option économique, politique et sociale pour la lutte contre la pauvreté. Bien que la mise en place des institutions de microfinance ait une longue histoire, leur attrait croissant est généralement associé à l'attention accordée à la "Grameen Bank" au Bangladesh, qui a été la première microfinance à accorder des prêts collectifs aux femmes pauvres. À la suite du "succès" de Grameen Bank et de la promotion des institutions dites "clonées" de par le monde, le plaidoyer pour la microfinance s'est concentré principalement sur le microcrédit. En conséquence, un plus grand ancrage de la microfinance dans la société en tant qu'épargne, assurance et autres formes d'intermédiation financière a reçu beaucoup moins d'attention. On pensait que le microcrédit représentait un moyen très fiable et très rapide pour réduire la pauvreté, notamment en soutenant l'esprit d'entreprise des pauvres. Le microcrédit est alors devenu une sorte de "talon d’Achille" du secteur de la microfinance, de plus en plus identifié comme sa "raison d’être" et la justification des investissements évalués en milliards de dollars à travers le monde.
Cet ouvrage se propose d’étudier la relation entre la pauvreté et la microfinance. L’argumentaire développé considère le lien affirmé entre ces deux grands concepts des temps moderne à partir d'une interrogation principalement théorique. L’étude remet en question l'engagement limité que la littérature sur la microfinance a eu avec les diverses théories sur la pauvreté, et tente de formuler une compréhension plus nuancée des relations entre la pauvreté et la microfinance.
La recherche entreprise soutient qu'un modèle de microfinance, fondé sur l'épargne, a la capacité de contribuer aux défis de la réduction de la pauvreté plus qu'on ne le reconnaît actuellement. Lorsqu'elles bénéficient du soutien nécessaire, les institutions financières appartenant à leurs membres, telles que les banques villageoises, offrent une solution potentielle pour relever les défis inhérents à la fourniture de services bancaires à faible coût dans les zones rurales.
Inhaltsverzeichnis
- Introduction générale
- Kapitel 1. Pauvreté : concept, historique et théorie
- 1.1. Le concept de pauvreté
- 1.2. Evolution des idées sur la pauvreté
- 1.3. Les grandes théories de la pauvreté
- Kapitel 2. L'essor de la microfinance
- 2.1. La recherche en microfinance des années 50 aux années 70
- 2.2. L'évolution de la microfinance au cours des années 80 et 90
- 2.3. La transformation de la microfinance au 21ème siècle
- Kapitel 3. Les approches dominantes en microfinance
- 3.1. L'approche du « credit first »
- 3.2. L'approche des « financial services »
- Kapitel 4. Les modèles types de microfinance
- 4.1. Les institutions de microfinance appartenant aux membres
- 4.2. Les références à la pauvreté dans la microfinance
- 4.3. Vers une théorie de la microfinance et de la pauvreté
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Beziehung zwischen Armut und Mikrofinanzierung. Das Hauptziel ist es, die in der Mikrofinanzliteratur bestehende begrenzte Auseinandersetzung mit verschiedenen Armutstheorien zu hinterfragen und ein differenzierteres Verständnis der Interaktionen zwischen Armut und Mikrofinanzierung zu entwickeln. Die Studie analysiert die historische Entwicklung der Mikrofinanzierung und verschiedene Ansätze, um deren Wirkung auf Armutsreduktion zu bewerten.
- Der Zusammenhang zwischen Armut und Mikrofinanzierung
- Die Entwicklung und verschiedene Ansätze der Mikrofinanzierung
- Die Rolle des Mikrokredits und anderer Finanzdienstleistungen
- Mitgliedschaftsbasierte Mikrofinanzinstitutionen und ihre Bedeutung
- Eine Theorie der Mikrofinanzierung im Kontext von Armut
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1. Pauvreté : concept, historique et théorie: Dieses Kapitel legt die Grundlagen der Arbeit, indem es den Begriff der Armut konzeptionell und historisch beleuchtet. Es untersucht die Entwicklung des Armutsverständnisses im Laufe der Zeit und analysiert verschiedene Theorien, die versuchen, Armut zu erklären. Der Fokus liegt auf der Evolution der Denkansätze zur Armut und der Entwicklung verschiedener theoretischer Modelle, die versuchen, die komplexen Ursachen und Auswirkungen von Armut zu erfassen. Die unterschiedlichen Perspektiven auf Armut werden im Detail dargestellt, um ein breites Verständnis des Kontexts zu schaffen, in dem Mikrofinanzierungsinitiativen operieren.
Kapitel 2. L'essor de la microfinance: Dieses Kapitel zeichnet die Geschichte der Mikrofinanzierung nach, von ihren Anfängen bis ins 21. Jahrhundert. Es analysiert die Entwicklungsphasen, von den frühen Experimenten in den 1950er und 1960er Jahren bis hin zum rasanten Wachstum und der globalen Verbreitung in den folgenden Jahrzehnten. Der Aufstieg der Grameen Bank und die damit einhergehende Fokussierung auf Mikrokredite werden detailliert beleuchtet. Das Kapitel untersucht die Veränderungen im Verständnis und der Anwendung von Mikrofinanzierung im Laufe der Zeit und ihren Einfluss auf verschiedene Entwicklungsstrategien.
Kapitel 3. Les approches dominantes en microfinance: Hier werden die vorherrschenden Ansätze in der Mikrofinanzierung vorgestellt und kritisch analysiert. Im Mittelpunkt stehen der "Credit first"-Ansatz und der Ansatz der "Financial services". Das Kapitel vergleicht und kontrastiert diese beiden Ansätze, indem es ihre Stärken und Schwächen aufzeigt und ihre unterschiedlichen Auswirkungen auf die Armutsbekämpfung diskutiert. Es wird analysiert, wie die unterschiedlichen Ansätze die Zielgruppen, die angebotenen Dienstleistungen und den Erfolg der Mikrofinanzierung beeinflussen.
Kapitel 4. Les modèles types de microfinance: In diesem Kapitel werden verschiedene Modelle der Mikrofinanzierung vorgestellt und im Detail untersucht. Der Schwerpunkt liegt auf Mitgliedschaftsbasierten Institutionen und ihrer Bedeutung im Kampf gegen die Armut. Die Diskussion umfasst die Rolle der Mikrofinanzierung bei der Armutsbekämpfung und die Entwicklung einer umfassenden Theorie, die die komplexen Beziehungen zwischen Mikrofinanzierung und Armut berücksichtigt. Es werden konkrete Beispiele und Fallstudien analysiert, um die Wirksamkeit verschiedener Modelle zu illustrieren.
Schlüsselwörter
Armut, Mikrofinanzierung, Mikrokredit, Sparen, Finanzdienstleistungen, Armutstheorien, Entwicklungspolitik, Mitgliedschaftsbasierte Institutionen, Grameen Bank.
Häufig gestellte Fragen zu: Eine umfassende Übersicht der Mikrofinanzierung und Armut
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den komplexen Zusammenhang zwischen Armut und Mikrofinanzierung. Sie analysiert die historische Entwicklung der Mikrofinanzierung, verschiedene Ansätze und deren Wirkung auf die Armutsbekämpfung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Begriff der Armut (inklusive historischer Entwicklung und verschiedener Theorien), den Aufstieg der Mikrofinanzierung (von den Anfängen bis zum 21. Jahrhundert), die dominierenden Ansätze in der Mikrofinanzierung ("Credit first" und "Financial services") und verschiedene Modelle der Mikrofinanzierung, insbesondere Mitgliedschaftsbasierte Institutionen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Entwicklung einer umfassenden Theorie der Mikrofinanzierung im Kontext von Armut.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 behandelt den Begriff und die Theorien der Armut; Kapitel 2 beschreibt die historische Entwicklung der Mikrofinanzierung; Kapitel 3 analysiert die dominierenden Ansätze in der Mikrofinanzierung; und Kapitel 4 untersucht verschiedene Modelle der Mikrofinanzierung, insbesondere Mitgliedschaftsbasierte Institutionen, und arbeitet an einer umfassenden Theorie.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Hauptzielsetzung ist es, die begrenzte Auseinandersetzung mit verschiedenen Armutstheorien in der Mikrofinanzliteratur zu hinterfragen und ein differenzierteres Verständnis der Interaktionen zwischen Armut und Mikrofinanzierung zu entwickeln. Es geht darum, die Wirkung von Mikrofinanzierung auf Armutsreduktion zu bewerten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Armut, Mikrofinanzierung, Mikrokredit, Sparen, Finanzdienstleistungen, Armutstheorien, Entwicklungspolitik, Mitgliedschaftsbasierte Institutionen, Grameen Bank.
Wie wird die historische Entwicklung der Mikrofinanzierung dargestellt?
Kapitel 2 zeichnet die Geschichte der Mikrofinanzierung nach, von den frühen Experimenten in den 1950er und 1960er Jahren bis zum rasanten Wachstum und der globalen Verbreitung. Der Aufstieg der Grameen Bank und die Fokussierung auf Mikrokredite werden detailliert beleuchtet.
Welche Ansätze der Mikrofinanzierung werden verglichen?
Kapitel 3 vergleicht und kontrastiert den "Credit first"-Ansatz und den Ansatz der "Financial services", indem es deren Stärken und Schwächen aufzeigt und die unterschiedlichen Auswirkungen auf die Armutsbekämpfung diskutiert.
Welche Rolle spielen Mitgliedschaftsbasierte Institutionen?
Kapitel 4 untersucht Mitgliedschaftsbasierte Mikrofinanzinstitutionen und deren Bedeutung im Kampf gegen die Armut. Es analysiert deren Wirksamkeit anhand konkreter Beispiele und Fallstudien.
Was ist das Ergebnis der Arbeit bezüglich einer Theorie der Mikrofinanzierung und Armut?
Die Arbeit zielt darauf ab, eine umfassende Theorie zu entwickeln, die die komplexen Beziehungen zwischen Mikrofinanzierung und Armut berücksichtigt. Kapitel 4 arbeitet an dieser Theorieentwicklung mit.
- Arbeit zitieren
- Tchakounte Njoda (Autor:in), 2020, La relation pauvreté-microfinance dans la littérature. Concepts, approches et théories, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/536545