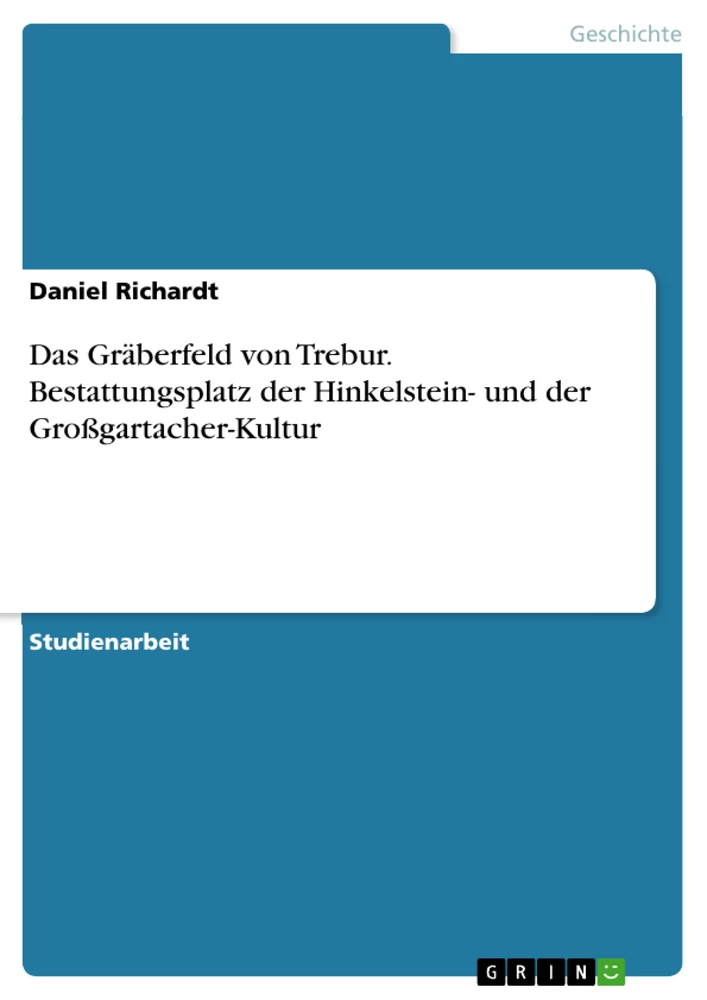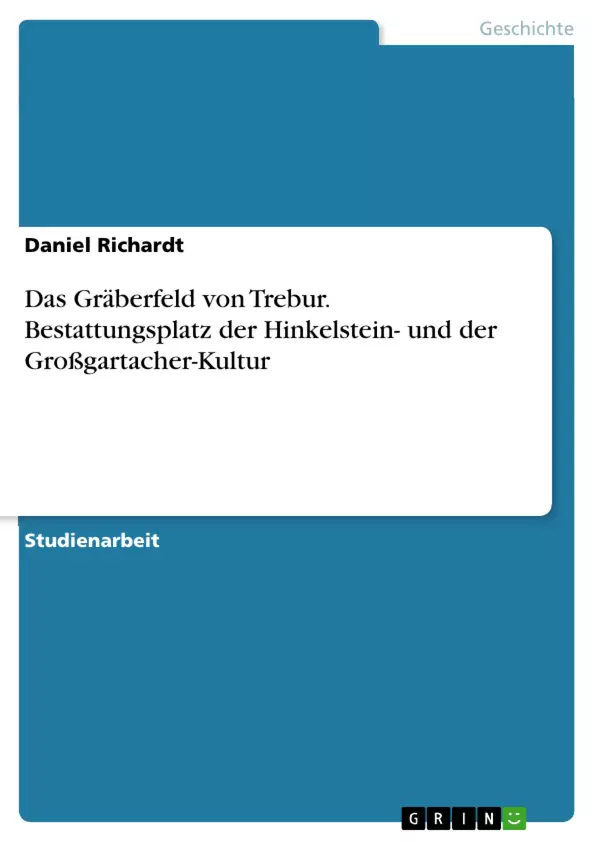In dieser Arbeit werden die Hinkelstein- und die darauffolgende Großgartacher-Kultur vor allem anhand des bikulturellen Gräberfeldes von Trebur behandelt, welches erstmals gestattet, fundierte Hypothesen über die Sozialstruktur des Mittelneolithikums zu entwickeln. Des Weiteren werden Fragen ihrer Entstehung, der Entwicklung der Keramik und ihrer Verzierung, eventuell damit zu verbindender Glaubensvorstellungen sowie der Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Kulturen beantwortet.
Mit dem Ende der Bandkeramik nach ca. 5100 v. Chr. entwickelten sich mehrere lokale Keramikstile, zu denen auch die Hinkelstein-Gruppe gehört, die sich um 5150 BC, also dem Beginn des Mittelneolithikums herausbildete. Der Begriff Hinkelstein-Gruppe wurde 1898 von Karl Koehl geprägt. Diese Bezeichnung geht auf das 1866 von Ludwig Lindenschmit entdeckte und 1867 publizierte Gräberfeld in Monsheim (Kreis Alzey-Worms) zurück, auf dem ein zwei Meter hoher Menhir stand, der im rheinhessischen Volksmund als „Hinkelstein“ betitelt wurde. Dieser Name ist die rheinhessische Sinnentstellung von „[…] Hünenstein über Hühnerstein zu Hinkelstein“. Die Großgartacher Kultur verdankt ihren Namen Alfred Schliz, der diese 1900 nach seiner wichtigsten Siedlungsgrabung in Großgartach benannte.
Die Quellensituation zur Hinkelstein-Kultur ist − abgesehen von Trebur, Gräberfeldern bei Worms (Rheindürkheim und „Rheingewann“) sowie den kleinen Grabgruppen bei Monsheim und Alzey – äußerst schlecht. Nicht besser steht es um die Großgartacher-Kultur, bei der der Dokumentationsstand der Fundstellen unzufriedenstellend ist. Auch gibt es aus dem Zeitabschnitt der Hinkelstein-Kultur bisher (2009) nur wenige evidente Siedlungsfunde, allerdings Gruben und okkasionell auch Funde aus spät- und spätestbandkeramischem Kontext. Der Hausgrundriss der Hinkelstein-Kultur ist nicht sicher bekannt, derjenige der Großgartacher-Kultur ist schiffsförmig.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Verbreitungsgebiet der Hinkelstein- und Großgartacher-Kultur
- Das Gräberfeld von Trebur
- Die Keramik Chronologie der Gefäßformen nach der Seriation HST-GG
- Die Entwicklung der Keramikverzierung
- Der Belegungsgang
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede der HST- und GG-Kultur
- Die anthropomorphe Symbolik (Grab 127)
- Versuch einer sozialen Interpretation der in Trebur bestatteten Bevölkerung
- Die Bedeutung der Hinkelstein-Kultur
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Hinkelstein- und die Großgartacher-Kultur, zwei wichtige neolithische Kulturen im westlichen Mitteleuropa. Der Fokus liegt dabei auf dem bikulturellen Gräberfeld von Trebur, welches wichtige Erkenntnisse über die Sozialstruktur des Mittelneolithikums liefert. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Entstehung, Entwicklung und Verbreitung der beiden Kulturen zu beleuchten sowie Unterschiede und Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten.
- Die Entstehung und Verbreitung der Hinkelstein- und Großgartacher-Kultur
- Die Entwicklung der Keramikformen und -verzierung in beiden Kulturen
- Die Analyse des Gräberfeldes von Trebur als Spiegel der Sozialstruktur
- Die Bedeutung der Hinkelstein-Kultur im Kontext des Mittelneolithikums
- Die Interpretation von symbolischen Artefakten, insbesondere des anthropomorphen Symbols in Grab 127
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Hinkelstein- und Großgartacher-Kultur im Kontext des Mittelneolithikums vor und erläutert die Bedeutung des Gräberfeldes von Trebur für die Forschung. Das zweite Kapitel behandelt die geographische Verbreitung beider Kulturen und beleuchtet ihre Beziehung zu anderen linienbandkeramischen Gruppen. Das dritte Kapitel konzentriert sich auf das Gräberfeld von Trebur, beschreibt die Ausgrabungen und die Funde sowie die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Bestattungspraktiken der beiden Kulturen.
Kapitel 3.1 analysiert die Keramikchronologie und die Entwicklung der Gefäßformen von der Hinkelstein- zur Großgartacher-Kultur. Das vierte Kapitel befasst sich mit der Bedeutung der Hinkelstein-Kultur im Kontext des Mittelneolithikums und der Entwicklung der mittelneolithischen Kulturensequenz Hinkelstein-Großgartach-Rössen. Das fünfte Kapitel bietet ein Fazit der Arbeit und resümiert die wichtigsten Erkenntnisse.
Schlüsselwörter
Hinkelstein-Kultur, Großgartacher-Kultur, Mittelneolithikum, Gräberfeld, Trebur, Keramikchronologie, Gefäßformen, Sozialstruktur, Bestattungspraktiken, Symbolische Artefakte, Anthropomorphe Symbolik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere am Gräberfeld von Trebur?
Das Gräberfeld von Trebur ist ein bedeutender bikultureller Bestattungsplatz der Hinkelstein- und der Großgartacher-Kultur. Es ermöglicht erstmals fundierte Hypothesen über die Sozialstruktur des Mittelneolithikums.
Wann entstand die Hinkelstein-Gruppe?
Die Hinkelstein-Gruppe bildete sich zu Beginn des Mittelneolithikums um etwa 5150 v. Chr. heraus, nachdem sich zum Ende der Bandkeramik verschiedene lokale Keramikstile entwickelten.
Woher stammt der Name „Hinkelstein-Gruppe“?
Der Begriff wurde 1898 von Karl Koehl geprägt. Er bezieht sich auf ein Gräberfeld in Monsheim, auf dem ein Menhir stand, der im Volksmund als „Hinkelstein“ bezeichnet wurde.
Welche Hausformen sind für die Großgartacher-Kultur typisch?
Während der Hausgrundriss der Hinkelstein-Kultur nicht sicher bekannt ist, zeichnet sich die Großgartacher-Kultur durch schiffsförmige Hausgrundrisse aus.
Welche Rolle spielt die Keramikchronologie in dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Entwicklung der Gefäßformen und der Keramikverzierung von der Hinkelstein- zur Großgartacher-Kultur, um chronologische Abläufe und kulturelle Unterschiede zu verdeutlichen.
Was symbolisiert das Artefakt in Grab 127?
In Grab 127 wurde eine anthropomorphe Symbolik gefunden, deren Interpretation wichtige Einblicke in die Glaubensvorstellungen der damaligen Bevölkerung liefert.
- Quote paper
- Daniel Richardt (Author), 2014, Das Gräberfeld von Trebur. Bestattungsplatz der Hinkelstein- und der Großgartacher-Kultur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/536694