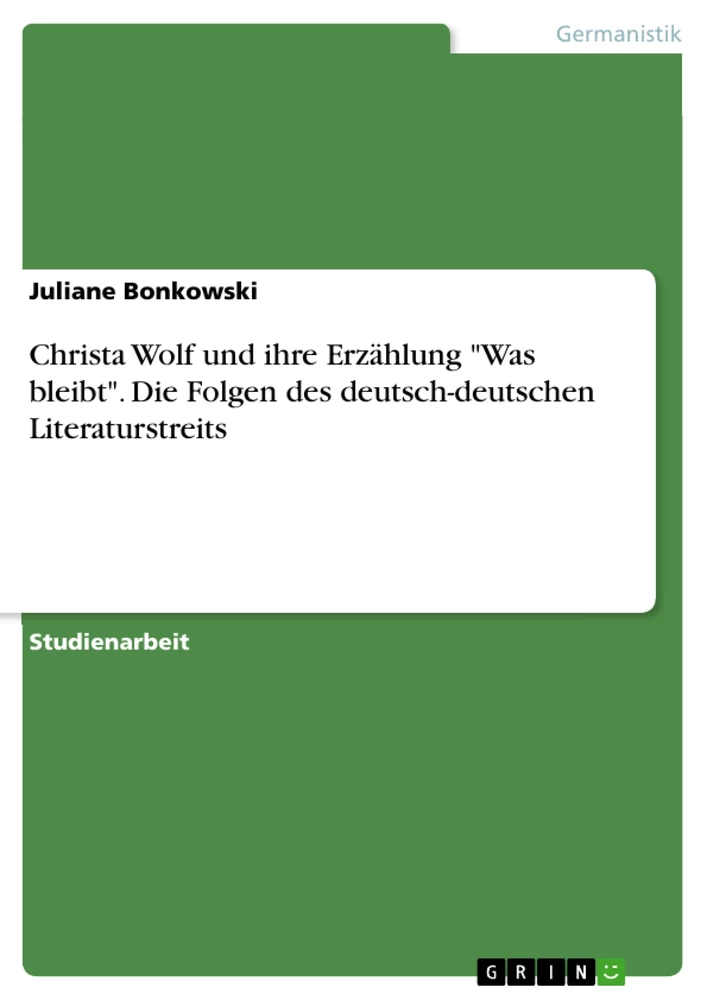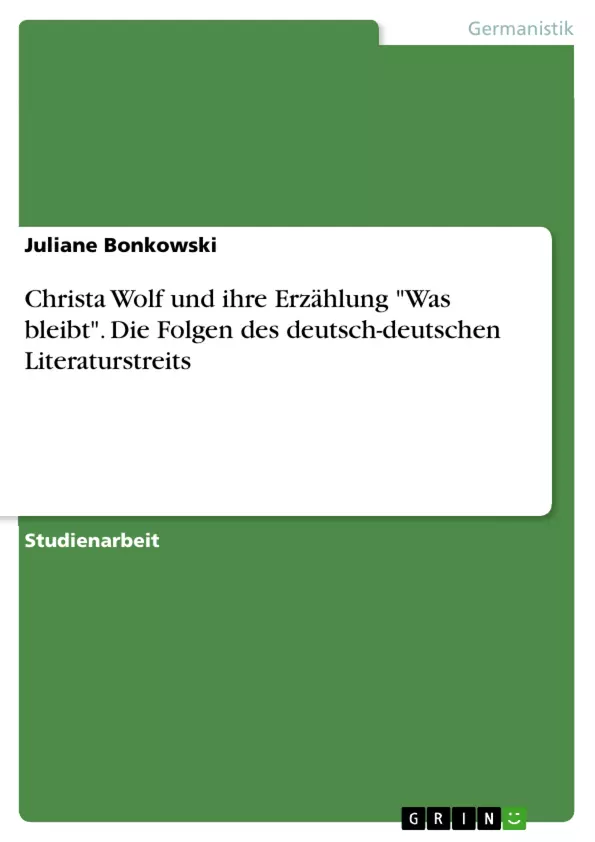Bis zur Veröffentlichung ihres Buches "Was bleibt" wurde Christa Wolf auch in Westdeutschland als Nobelpreisträgerin gehandelt, mit der politischen Wende kam allerdings auch die Wende in der Einschätzung ihres literarischen Werks. Ihr wurde vorgeworfen, dass der Zeitpunkt der Veröffentlichung mehr als ungünstig gewählt war, da sie sich vorher ja auch niemals kritisch zu den Methoden der Staatssicherheit bekannt hätte.
In der vorliegenden Seminararbeit wird dieser Punkt näher beleuchtet. Der Hauptteil beschäftigt sich zuerst mit dem Ministerium für Staatssicherheit und welche Rolle diese Behörde für Literaturschaffende in der DDR spielte. Es folgt eine kurze Biographie zu Christa Wolf und ihre politischen sowie literarischen Schwerpunkte während der sozialistischen Herrschaft. Im nächsten Kapitel wird der Inhalt des Werkes "Was bleibt" zusammengefasst und einer Analyse unterzogen. Der letzte Punkt beschäftigt sich mit dem deutsch-deutschen Literaturstreit, dessen Ursachen und die Folgen für Christa Wolf und die deutsche Literaturgesellschaft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Ministerium für Staatssicherheit und dessen Einfluss auf die Literaturpolitik der DDR
- Das Leben der Christa Wolf
- Kurzbiographie
- Politisches und literarisches Leben während der DDR
- Die Erzählung Was bleibt
- Zusammenfassung des Inhalts
- Formale und sprachliche Merkmale
- Analyse
- Der deutsch-deutsche Literaturstreit als Konsequenz des Werkes
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht die literarische Rezeption des Werkes „Was bleibt“ von Christa Wolf im Kontext der DDR-Literaturpolitik und des deutsch-deutschen Literaturstreits. Sie beleuchtet den Einfluss des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) auf die literarische Produktion in der DDR und analysiert die Rolle von Christa Wolf als Schriftstellerin im Spannungsfeld zwischen politischer Kontrolle und künstlerischer Freiheit.
- Der Einfluss des MfS auf die Literaturpolitik der DDR
- Die Rolle von Christa Wolf als Schriftstellerin in der DDR
- Die Analyse des Werkes „Was bleibt“ im Hinblick auf seine formale und sprachliche Gestaltung
- Der deutsch-deutsche Literaturstreit im Kontext der Rezeption von „Was bleibt“
- Die Bedeutung des Werkes für die deutsche Literaturgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Fokus auf den deutsch-deutschen Literaturstreit legt, der durch die Veröffentlichung von "Was bleibt" ausgelöst wurde. Das zweite Kapitel widmet sich dem MfS und dessen Einfluss auf die Literaturpolitik der DDR. Es werden konkrete Maßnahmen zur Kontrolle und Überwachung von Schriftstellern und Verlagen beschrieben. Das dritte Kapitel behandelt die Biographie von Christa Wolf und beleuchtet ihre politischen und literarischen Aktivitäten im Kontext der DDR.
Das vierte Kapitel konzentriert sich auf die Analyse von "Was bleibt", wobei Inhalt, formale Gestaltung und Sprache beleuchtet werden. Abschließend wird der deutsch-deutsche Literaturstreit als Konsequenz des Werkes und seine Folgen für Christa Wolf und die Literaturgesellschaft untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Staatssicherheit, Literaturpolitik, DDR, Christa Wolf, "Was bleibt", deutsch-deutscher Literaturstreit, künstlerische Freiheit und politische Kontrolle. Diese Schlüsselwörter geben einen Einblick in die zentralen Themen und Konzepte, die in der Arbeit behandelt werden.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Christa Wolfs Erzählung „Was bleibt“?
Die Erzählung beschreibt einen Tag im Leben einer Schriftstellerin in der DDR, die vom Ministerium für Staatssicherheit (Stasi) überwacht wird.
Was war der „deutsch-deutsche Literaturstreit“?
Es war eine heftige Debatte nach der Wende, bei der Christa Wolf vorgeworfen wurde, ihre Kritik an der Stasi erst zu spät veröffentlicht zu haben und eine privilegierte Staatsautorin gewesen zu sein.
Welchen Einfluss hatte die Stasi auf die Literatur in der DDR?
Das MfS kontrollierte Verlage und überwachte Autoren systematisch, um regimekritische Werke zu verhindern und die Literaturpolitik im Sinne des Sozialismus zu steuern.
Wie veränderte sich das Bild von Christa Wolf nach 1990?
Während sie vorher im Westen als Nobelpreiskandidatin gefeiert wurde, wurde sie nach der Wende wegen ihrer Rolle in der DDR und ihrer zeitweisen IM-Tätigkeit stark kritisiert.
Was sind die formalen Merkmale von „Was bleibt“?
Das Werk zeichnet sich durch eine intensive Reflexion der eigenen Sprache und eine subjektive, beklemmende Atmosphäre aus, die die psychischen Folgen der Überwachung verdeutlicht.
- Quote paper
- Juliane Bonkowski (Author), 2016, Christa Wolf und ihre Erzählung "Was bleibt". Die Folgen des deutsch-deutschen Literaturstreits, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/537104