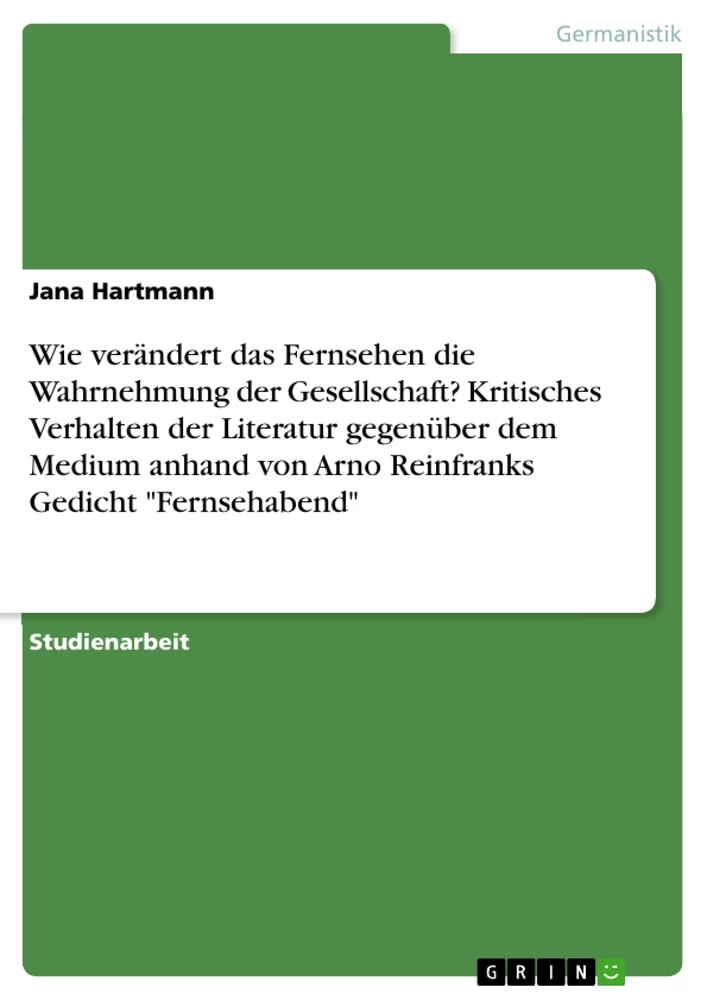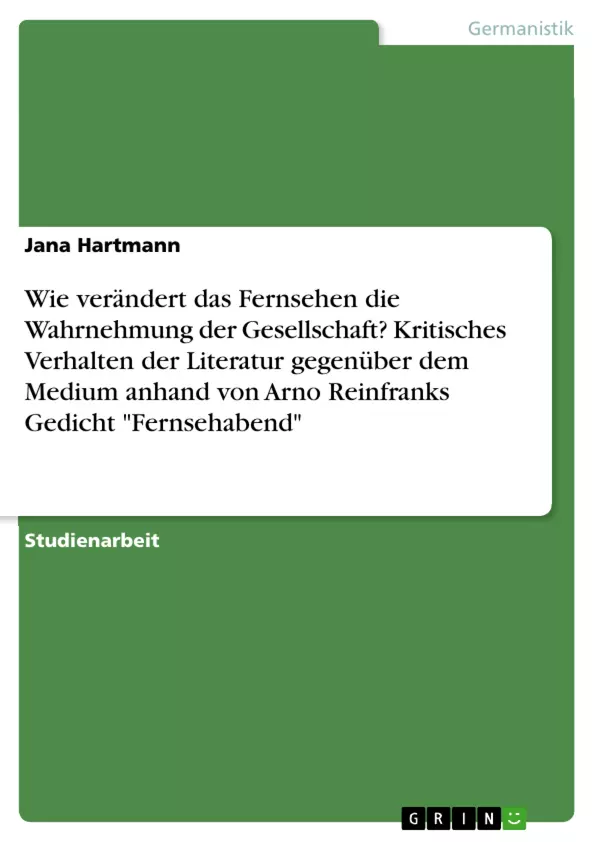Mit der Erfindung des Fernsehens fand die Literatur einen neuen Inhaltsgegenstand, den sie kritisch betrachtete. Wie reagierte die Gesellschaft auf das neue Medium? Wie veränderte sich die Wahrnehmung der Gesellschaft dadurch? Welchen Stellenwert bekam Literatur noch zugeschrieben? All diese Fragen sollen anhand des Gedichts "Fernsehabend" von Arno Reinfrank beantwortet werden. Hauptaugenmerk soll dabei die "verschobene Wahrnehmung von Ferne und Nähe" der Gesellschaft, entstanden durch das Fernsehen sein.
Zuvor soll allerdings ein allgemeiner Überblick darüber gegeben werden, in welcher Wechselwirkung Literatur und Fernsehen zueinander stehen. Uwe Japp beschäftigt sich innerhalb seines Aufsatzes "Das Fernsehen als Gegenstand der Literatur und der Literaturwissenschaft" damit, wie die Literatur Bezug zum Fernsehen nimmt. Er spricht von drei unterschiedlichen Typen: die kritische, die konstatierende und die kontaminierende Bezugnahme. Bei der kritischen Bezugnahme geht es darum, dass Autoren der Literatur sich hauptsächlich kritisch dem Fernsehen gegenüber äußern. Man muss hierbei zwischen kritischem Verhalten dem Fernsehen im Allgemeinen oder dem Fernsehen als Charakteristikum einer modernen Welt unterscheiden. Die konstatierende Bezugnahme beschäftigt sich damit, wie Fernsehen als Gegenstand in literarische Werke eingebaut wird, das heißt welche Wirkung der Gegenstand an sich auf das Umfeld von Protagonisten hat. Der letzte Typ der Bezugnahme ist die kontaminierende, bei der es darum geht, wie sich das Fernsehen auf das Verhalten von Autoren und beispielsweise deren Schreibstil auswirkt. Die Wirkung des Fernsehens auf Autor und Rezipienten und deren Beziehung ist bisher kaum erforscht worden und man findet unterschiedliche Äußerungen von Literaten zu diesem Thema. Hans Wollschläger spricht beispielsweise davon, wie sich Schriftsteller gezwungenermaßen von der Literatur abwenden, um durch das moderne Medium Fernsehen eine gesicherte Anstellung garantiert zu bekommen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Fernsehen als Gegenstand der Literaturwissenschaft
- Interpretation und Analyse von Fernsehabend von Arno Reinfrank
- Alltäglichkeit des Fernsehens
- Wahrnehmung von Ferne und Nähe
- Generationskonflikt und Verlust der Hörkultur
- Reizüberflutung und Götzenherrschaft des Fernsehens
- Appell zum Umbruch der Gesellschaft
- Kritik am Medium oder der konsumierenden Gesellschaft?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss des Fernsehens auf die deutschsprachige Literatur seit 1955. Sie konzentriert sich insbesondere auf die Frage, wie das Fernsehen die Wahrnehmung der Gesellschaft verändert und wie die Literatur auf dieses Medium reagiert.
- Fernsehen als Gegenstand der Literaturwissenschaft
- Verschobene Wahrnehmung von Ferne und Nähe durch das Fernsehen
- Generationskonflikt im Kontext des Fernsehens
- Kritik an der Passivität und Reizüberflutung des Fernsehens
- Appell zum Umdenken in der Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Beziehung zwischen Literatur und Fernsehen, insbesondere die kritische, konstatierende und kontaminierende Bezugnahme. Sie stellt fest, dass das Fernsehen einen wichtigen Gegenstand für die Literatur geworden ist und untersucht, wie sich das Medium auf das Schreibverhalten und die Wahrnehmung von Autoren auswirkt.
Die Interpretation und Analyse von Arno Reinfranks Gedicht "Fernsehabend" konzentriert sich auf die Darstellung der Alltäglichkeit des Fernsehens, die verschobene Wahrnehmung von Ferne und Nähe, den daraus resultierenden Generationskonflikt und die Kritik an der Reizüberflutung und Götzenherrschaft des Mediums. Die Analyse zeigt auf, wie Reinfrank den Einfluss des Fernsehens auf die Gesellschaft kritisch beleuchtet und einen Appell zum Umbruch der Gesellschaft formuliert.
Schlüsselwörter
Fernsehen, Literatur, Wahrnehmung, Gesellschaft, Kritik, Arno Reinfrank, Fernsehabend, Generationskonflikt, Passivität, Reizüberflutung, Nähe, Ferne
Häufig gestellte Fragen
Wie reagiert die Literatur auf das Medium Fernsehen?
Laut Uwe Japp gibt es drei Typen: die kritische, die konstatierende und die kontaminierende Bezugnahme.
Was kritisiert Arno Reinfrank in seinem Gedicht „Fernsehabend“?
Reinfrank kritisiert die Passivität der Gesellschaft, die Reizüberflutung und die verschobene Wahrnehmung von Nähe und Ferne durch das Fernsehen.
Was ist die „verschobene Wahrnehmung von Ferne und Nähe“?
Durch das Fernsehen rückt das zeitlich und räumlich Entfernte scheinbar nah heran, während die unmittelbare soziale Umgebung (z. B. die Familie) vernachlässigt wird.
Welcher Generationskonflikt wird im Gedicht thematisiert?
Es wird der Verlust der Hörkultur und des zwischenmenschlichen Gesprächs beschrieben, da das Fernsehen als „Götze“ den familiären Austausch ersetzt.
Wozu ruft die Literatur in Bezug auf das Fernsehen auf?
Oft enthalten literarische Werke einen Appell zum Umbruch und zu einem kritischeren Konsumverhalten gegenüber Massenmedien.
- Quote paper
- Jana Hartmann (Author), 2017, Wie verändert das Fernsehen die Wahrnehmung der Gesellschaft? Kritisches Verhalten der Literatur gegenüber dem Medium anhand von Arno Reinfranks Gedicht "Fernsehabend", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/537144