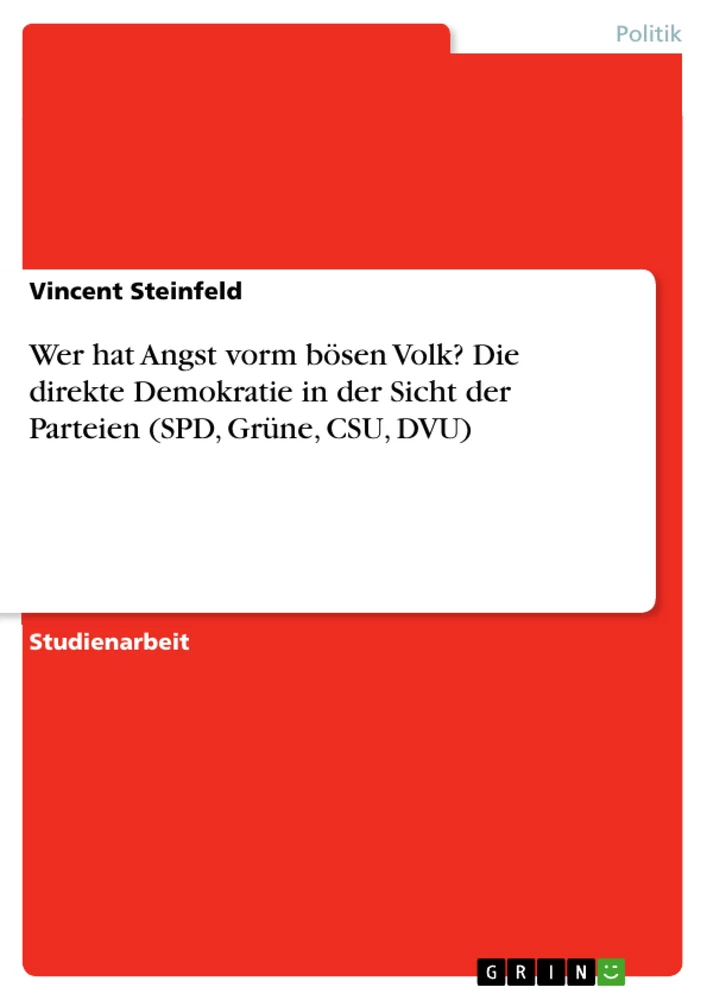Im Jahre 1998 vereinbarte die rot-grüne Regierungskoalition den Versuch zu unternehmen das Grundgesetz zu ändern und die auf kommunaler und Länderebene schon praktizierten plebiszitären Elemente Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid auch auf der Bundesebene einzuführen. Es gelang ihr jedoch erst gegen Ende der Legislaturperiode, sich auf einen dahingehenden Gesetzesentwurf zu einigen.
Als im Jahr 2002 schließlich im Bundestag über selbigen abgestimmt wurde, stellten sich CDU und CSU dagegen - obwohl diese Parteien ganz offenbar bezüglich dieses Themas innerlich gespalten waren. Das Parlament nahm daher den Vorschlag zwar mit einfacher Mehrheit an, die zur Änderung der Verfassung nötige Zweidrittelmehrheit und damit die Umsetzung des Vorschlags wurde allerdings nicht erreicht. Das Thema „direkte Demokratie“ war damit erst einmal vom Tisch - oder etwa doch nicht?
Die Vorgänge um den rot-grünen Vorstoß für mehr direkte Demokratie sollen hier dargestellt werden (2.). Dies kann am anschaulichsten anhand einer Beschreibung der Entwicklung des Umgangs mit dem Thema innerhalb der Regierungskoalition geschehen, bei der auch der rotgrüne Gesetzesentwurf von 2002 im Detail beschrieben wird (2.1.). Doch auch auf Seiten der Opposition fand die direkte Demokratie - trotz aller Geschlossenheit bei der Ablehnung des rot-grünen Entwurfs im Bundestag - Freunde, was sich besonders gut am Beispiel der in dieser Hinsicht stark gespaltenen CSU zeigen lässt (2.2.).
Die Beschäftigung der Parteien mit dem Thema Volksgesetzgebung wird daraufhin kritisch untersucht werden. Dazu ist es vonnöten das Phänomen darzustellen, das maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die direkte Demokratie auf Bundesebene überhaupt auf die rot-grüne Agenda gekommen ist: Die zunehmende Politikverdrossenheit in Deutschland, die die Legitimation des repräsentativen Systems gefährdet (3.1.).
Doch nicht nur die Regierungskoalition auch radikale Parteien machten sich vor diesem Hintergrund die Forderung nach plebiszitären Elementen zu eigen, was am Beispiel der DVU zu zeigen ist (3.1.1.). Bei dem, was sich diese Parteien von diesen Elementen allerdings versprechen, sind wir auch bei dem Punkt angekommen, der den Bundestagsfraktionen den Umgang mit diesem Thema offenbar schwer macht: Der Verlust des Entscheidungsmonopols der etablierten Parteien. Es soll hier der Versuch unternommen werden, darzulegen, warum die Parteien dieser Verlust so schmerzen könnte (3.2.).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der rot-grüne Vorstoß 2002 und die Beschäftigung der Parteien mit der direkten Demokratie
- Die rot-grüne Regierungskoalition
- Die CSU
- Analyse der Plebiszitdebatte: Die Parteien in der Zwickmühle
- Die eine Gefahr: Politikverdrossenheit
- Die DVU als Nutznießer
- Die andere Gefahr: Verlust des Agenda-Settings
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die Debatte um die Einführung direkter Demokratie auf Bundesebene im Jahr 2002, insbesondere die Positionierung der Parteien SPD, Grüne, CSU und DVU. Ziel ist es, den Umgang dieser Parteien mit dem Thema direkte Demokratie zu beleuchten und die Argumente für und gegen eine stärkere Bürgerbeteiligung zu untersuchen.
- Die rot-grüne Initiative zur Einführung von Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid auf Bundesebene.
- Die Positionen der Parteien SPD, Grüne, CSU und DVU in der Debatte um die direkte Demokratie.
- Die Argumente der Parteien bezüglich der möglichen Gefahren von Politikverdrossenheit und dem Verlust des Agenda-Settings durch direkte Demokratie.
- Die Analyse der politischen Strategie und der Motivation der einzelnen Parteien in der Debatte um die direkte Demokratie.
- Die Auswirkungen der Debatte auf die Legitimation des repräsentativen Systems in Deutschland.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der direkten Demokratie und in den rot-grünen Vorstoß für eine Gesetzesänderung im Jahr 2002 ein. Sie stellt die Ausgangssituation und die relevanten Akteure vor.
Kapitel 2 beleuchtet die Entwicklung des Umgangs mit dem Thema der direkten Demokratie innerhalb der rot-grünen Regierungskoalition. Es beschreibt den rot-grünen Gesetzesentwurf von 2002 und die Positionen der einzelnen Parteien, insbesondere die der CSU.
Kapitel 3 analysiert die Debatte um die direkte Demokratie aus der Perspektive der Parteien. Es untersucht die Argumente für und gegen eine stärkere Bürgerbeteiligung, insbesondere im Hinblick auf die Gefahr der Politikverdrossenheit und den möglichen Verlust des Agenda-Settings.
Schlüsselwörter
Direkte Demokratie, Volksinitiative, Volksbegehren, Volksentscheid, Politikverdrossenheit, Agenda-Setting, Legitimation, Repräsentatives System, Rot-Grüne Koalition, SPD, Grüne, CSU, DVU.
Häufig gestellte Fragen
Was war der rot-grüne Vorstoß zur direkten Demokratie 2002?
Die Regierung wollte Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheide auf Bundesebene einführen, scheiterte aber an der notwendigen Zweidrittelmehrheit im Bundestag.
Warum lehnten CDU/CSU den Entwurf ab?
Trotz innerer Spaltung befürchteten sie einen Verlust des Entscheidungsmonopols der Parteien und Gefahren für das repräsentative System.
Welche Rolle spielt die Politikverdrossenheit?
Direkte Demokratie wird oft als Mittel gesehen, um der zunehmenden Politikverdrossenheit entgegenzuwirken und die Legitimation des Systems zu stärken.
Wie nutzt die DVU das Thema direkte Demokratie?
Radikale Parteien wie die DVU fordern plebiszitäre Elemente oft, um den etablierten Parteien Macht zu entziehen und populistische Themen direkt zur Abstimmung zu bringen.
Was ist die Gefahr des „Verlusts des Agenda-Settings“?
Parteien fürchten, dass sie durch Volksentscheide die Kontrolle darüber verlieren, welche Themen politisch priorisiert und wie sie entschieden werden.
- Quote paper
- Vincent Steinfeld (Author), 2005, Wer hat Angst vorm bösen Volk? Die direkte Demokratie in der Sicht der Parteien (SPD, Grüne, CSU, DVU), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/53729