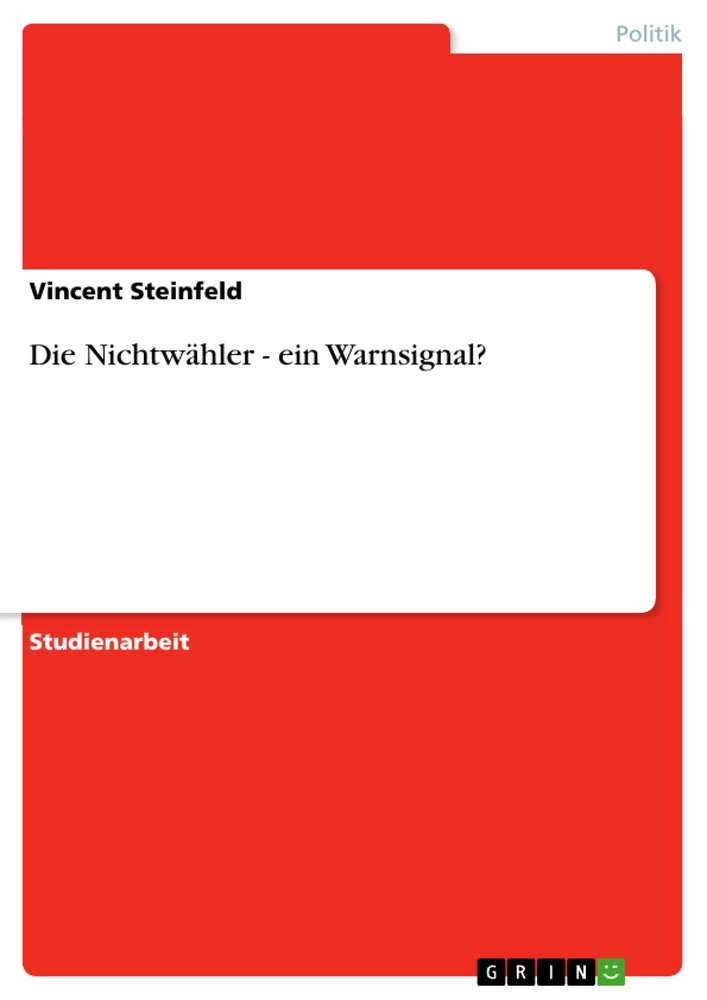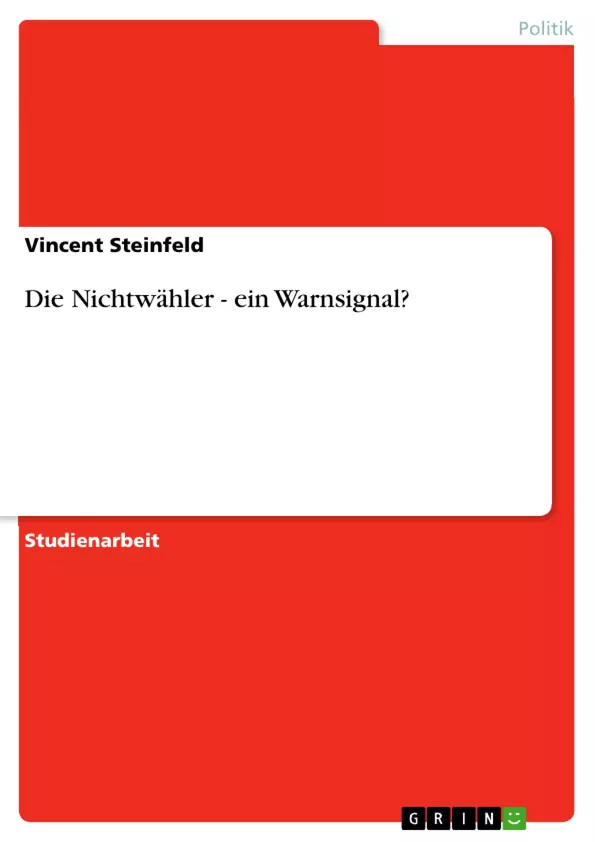„Sie halten keine Parteitage, brauchen keinen Vorsitzenden und kommen ohne Plakate oder Wahlwerbung aus. Trotzdem sind sie auf dem Vormarsch wie keine andere Partei:
Die Partei der Nichtwähler.“
Süddeutsche Zeitung Magazin, 13. März 19922
Die Zeitungsmeldung bringt es auf den Punkt: Jahrzehntelang zeichnete sich die Bevölkerung der Bundesrepublik durch eine mustergültige Wahlbeteiligung aus, die unter den westlichen Demokratien ihresgleichen suchte. Allenfalls in Demokratien mit gesetzlich festgeschriebener Wahlpflicht (z.B. Italien oder Belgien) ging ein höherer Prozentsatz der Wahlbevölkerung wählen, in den restlichen Staaten zog es wesentlich weniger Bürger zu den Urnen.3 Seit Mitte der Achtziger Jahre, besonders aber seit den Jahren nach der deutschen Wiedervereinigung, geht die Beteiligung dramatisch zurück.
Ist diese Entwicklung ein Schritt zu mehr demokratischer Reife oder Anlass zu ernster Sorge? Mit dieser Frage soll sich diese Arbeit beschäftigen. Beruht die zunehmende Wahlenthaltung darauf, dass sich die Bundesbürger zunehmend von einem lange Zeit bestehenden autoritären Politikverständnis mit verinnerlichter „Wahlpflicht“ emanzipieren4 oder rekrutiert sich die Masse der Nichtwähler5 aus mit der Politik oder gar dem politischen System Unzufriedenen ist sie also Symptom einer zunehmenden Politikverdrossenheit?
Um eine Antwort auf diese Frage und eventuell Lösungsmöglichkeiten zu finden, muss zunächst eine andere beantwortet werden: Wer sind die Nichtwähler? Anders als es durch die Zeitungsmeldung am Anfang suggeriert wird, sind die Nichtwähler nämlich alles andere als eine homogene Gruppe. Um ein besseres Bild von dem Untersuchungsobjekt zu bekommen, soll zunächst kurz eine soziologische Betrachtung der Nichtwähler stattfinden (2.). Anschließend soll die politische Bedeutung der Wahlenthaltung analysiert werden: Ist die Wahlenthaltung eine Warnung politikverdrossener Wähler? (3.)
Da sich, wie wir sehen werden, berechtigte Gründe ergeben, die Wahlenthaltung tatsächlich als Krisensymptom zu sehen, soll ein weiterer Abschnitt dieser Arbeit versuchen, mögliche Auswege aus diesem Dilemma aufzuzeigen (4.). Im Fazit soll abschließend auf die aktuelle Entwicklung in den Parteien und bei der Institution „Wahl“ eingegangen werden. Die Frage ist: Sehen die Parteien ihre Möglichkeiten, das Ruder herumzureißen? Und wenn ja: Nutzen sie sie auch? (5.)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wie sieht „der Nichtwähler“ aus? – Eine soziologische Betrachtung
- Politikverdrossenheit als Grund für die Wahlenthaltung?
- Der Weg aus der Krise? – Möglichkeiten der Wiederannäherung...
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Ursachen für die rückläufige Wahlbeteiligung in der Bundesrepublik Deutschland und hinterfragt, ob diese Entwicklung als Symptom für eine zunehmende Politikverdrossenheit interpretiert werden kann. Sie untersucht die soziologischen Merkmale der Nichtwähler und beleuchtet die Bedeutung der Wahlenthaltung als mögliches Warnsignal. Die Arbeit strebt nach einer Erklärung der Ursachen für die Wahlenthaltung und erörtert mögliche Ansätze zur Steigerung der Wahlbeteiligung.
- Entwicklung der Wahlbeteiligung in Deutschland
- Soziologische Merkmale der Nichtwähler
- Politikverdrossenheit als Ursache für die Wahlenthaltung
- Möglichkeiten der Wiederannäherung zwischen Politik und Bürgern
- Bedeutung der Wahlenthaltung als Warnsignal
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Das Kapitel stellt die Entwicklung der Wahlbeteiligung in Deutschland seit den Nachkriegsjahren dar. Es zeigt den historischen Trend der Wahlbeteiligung und die Veränderung dieser Entwicklung im Laufe der Zeit auf. Die Einleitung erläutert die zunehmende Wahlenthaltung seit den Achtziger Jahren und stellt die Kernfrage der Arbeit: Ist die sinkende Wahlbeteiligung ein Zeichen für eine zunehmende Politikverdrossenheit?
Wie sieht „der Nichtwähler“ aus? – Eine soziologische Betrachtung
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den soziologischen Merkmalen der Nichtwähler. Es betrachtet die unterschiedlichen Gruppen von Nichtwählern und analysiert deren Motive für die Wahlenthaltung. Der Fokus liegt auf den konjunkturellen Nichtwählern, die ihre Wahlentscheidung aktiv treffen und somit das größte Potenzial für eine Veränderung der Wahlbeteiligung darstellen.
Politikverdrossenheit als Grund für die Wahlenthaltung?
Das Kapitel untersucht die politische Bedeutung der Wahlenthaltung. Es analysiert, ob die Wahlenthaltung als ein Warnsignal für eine zunehmende Politikverdrossenheit der Bevölkerung interpretiert werden kann. Der Fokus liegt auf den Ursachen für die Politikverdrossenheit und ihrer Verbindung zur Wahlenthaltung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit thematisiert die Bereiche Wahlbeteiligung, Wahlenthaltung, Politikverdrossenheit, Nichtwähler, soziologische Faktoren, Demokratieverständnis, politische Partizipation und Wiederannäherung zwischen Politik und Bürgern.
Häufig gestellte Fragen
Warum sinkt die Wahlbeteiligung in Deutschland?
Gründe sind eine zunehmende Politikverdrossenheit, die Emanzipation von einem autoritären Pflichtgefühl sowie eine wachsende Unzufriedenheit mit dem politischen System.
Wer sind die „konjunkturellen Nichtwähler“?
Dies sind Wähler, die ihre Entscheidung aktiv treffen und je nach politischer Lage oder Angebot entscheiden, ob sie zur Wahl gehen oder nicht. Sie stellen das größte Potenzial für Parteien dar.
Ist Nichtwählen ein Warnsignal für die Demokratie?
Ja, eine dauerhaft niedrige Wahlbeteiligung kann als Krisensymptom gewertet werden, das auf eine tiefe Kluft zwischen Bürgern und politischen Institutionen hinweist.
Gibt es soziologische Merkmale für Nichtwähler?
Nichtwähler sind keine homogene Gruppe. Dennoch zeigen Studien oft Zusammenhänge mit dem Bildungsgrad, dem Alter und der sozialen Integration der Betroffenen.
Wie kann man die Wahlbeteiligung wieder steigern?
Diskutiert werden eine bessere Kommunikation der Parteien, eine stärkere Einbindung der Bürger in Entscheidungsprozesse und eine Wiederannäherung an die Lebensrealität der Menschen.
- Quote paper
- Vincent Steinfeld (Author), 2003, Die Nichtwähler - ein Warnsignal?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/53730