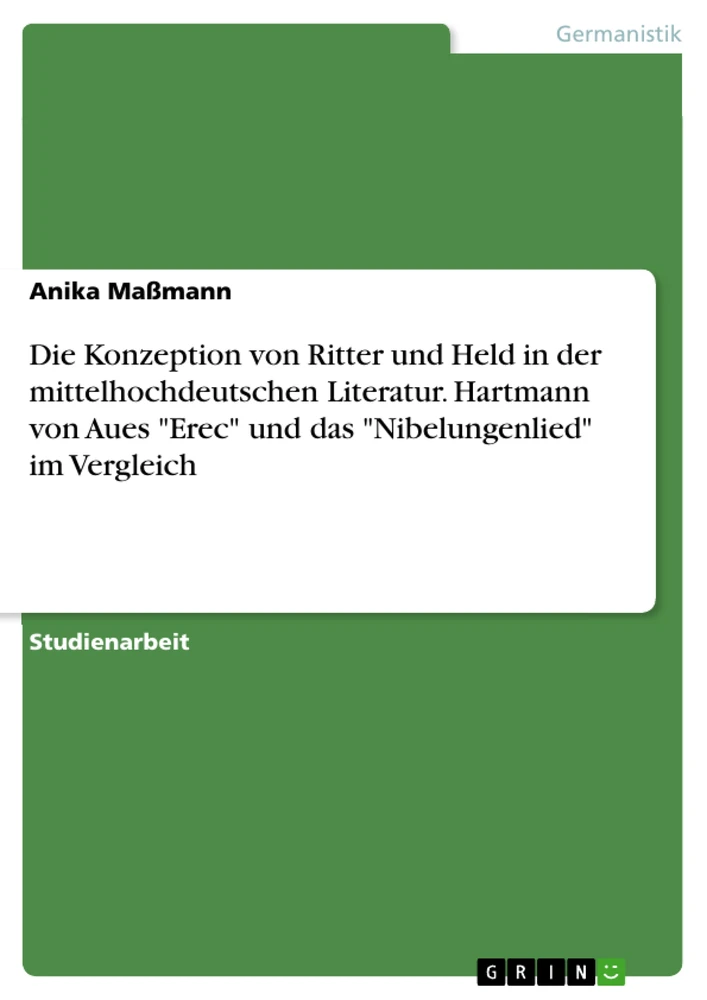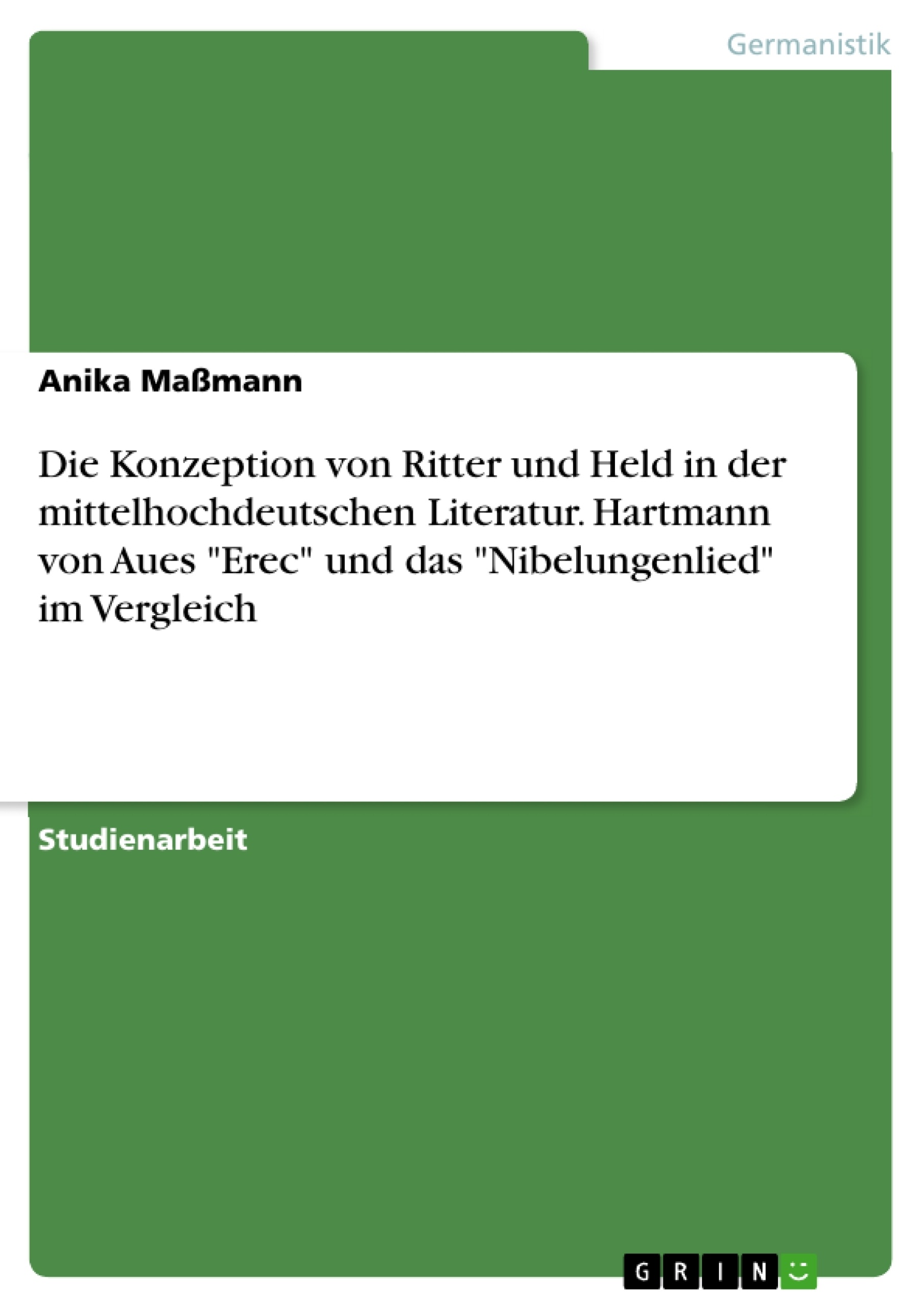Die Konzepte von Held und Ritter spielen in der mittelhochdeutschen Literatur eine wichtige Rolle. Welche Wesensmerkmale das jeweilige Konzept ausmachen und wie sie sich konkret in der Literatur niederschlagen, wird in dieser Arbeit an den Beispielen "Nibelungenlied" und "Erec" erläutert.
Hierbei widmet sich die Arbeit zunächst der Konzeption des Ritters Erec am Beispiel des gleichnamigen Versromans Hartmann von Aues, bevor sie sich den beiden Helden Hagen und Siegfried aus dem" Nibelungenlied" widmet. Im Anschluss erfolgt eine kurze Gegenüberstellung der beiden Konzepte, bevor ein abschließendes Fazit die Arbeit abrundet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Konzeption des Ritters
- 2.1 Der Ritter Erec
- 3. Die Konzeption des Helden
- 3.1 Die Helden Hagen und Siegfried
- 4. Gegenüberstellung
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konzeption von Ritter und Held in der mittelhochdeutschen Literatur anhand von Hartmanns von Aue Erec und dem Nibelungenlied. Ziel ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Konzepte herauszuarbeiten und deren gesellschaftliche Bedeutung im Kontext des Mittelalters zu beleuchten.
- Der Wandel des Ritterbegriffs vom militärischen Dienst zum höfischen Ideal
- Die religiösen und weltlichen Aspekte des Rittertums
- Der Held als Repräsentant archaischer Werte und gesellschaftlich destabilisierender Kräfte
- Der Vergleich der Figuren Erec (als Ritter) und Hagen/Siegfried (als Helden)
- Die Gegenüberstellung von Artus- und Heldenepik
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und beschreibt die Artus- und Heldenepik als zwei bedeutende Epengattungen der mittelhochdeutschen Literatur. Sie stellt die zentralen Figuren Ritter und Held einander gegenüber und kündigt die Analyse anhand von Hartmanns von Aue Erec und dem Nibelungenlied an.
2. Die Konzeption des Ritters: Dieses Kapitel beleuchtet den Wandel des Ritterbegriffs vom römischen miles (Soldat) zum höfischen Ideal des Mittelalters. Es werden die Entwicklung des Begriffs, seine religiöse Ausprägung (milites Christi) und die Verbindung von religiösen und weltlichen Tugenden (Frauendienst, höfische Etikette) erörtert. Anhand von Zitaten aus verschiedenen Werken werden die zentralen Tugenden des Ritters wie Demut, Mitleid, Treue (triuwe) und Höflichkeit (hövescheit) erläutert. Die Bedeutung von Ehre (êre) und moralischer Integrität (morâliteit) wird ebenfalls hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Mittelhochdeutsche Literatur, Ritter, Held, Artus-Epik, Heldenepik, Hartmann von Aue, Erec, Nibelungenlied, Ritterideal, höfische Kultur, religiöse Tugenden, weltliche Tugenden, Tugendlehre, triuwe, hövescheit, êre, gesellschaftliche Bedeutung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Konzeption von Ritter und Held in der mittelhochdeutschen Literatur
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Konzeption von Ritter und Held in der mittelhochdeutschen Literatur. Sie vergleicht die Figuren und Konzepte aus Hartmanns von Aues Erec (Ritter) und dem Nibelungenlied (Helden) um Unterschiede und Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten und deren gesellschaftliche Bedeutung im Mittelalter zu beleuchten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Wandel des Ritterbegriffs vom militärischen Dienst zum höfischen Ideal, die religiösen und weltlichen Aspekte des Rittertums, den Helden als Repräsentant archaischer Werte, den Vergleich der Figuren Erec, Hagen und Siegfried, und die Gegenüberstellung von Artus- und Heldenepik.
Welche Texte werden analysiert?
Die Haupttexte dieser Analyse sind Hartmanns von Aues Erec und das Nibelungenlied. Zusätzlich werden weitere mittelhochdeutsche Texte herangezogen, um den Wandel des Ritterbegriffs zu veranschaulichen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur Konzeption des Ritters und des Helden, einen Vergleich beider Konzepte, und ein Fazit. Die Kapitel enthalten detaillierte Analysen der Figuren und ihrer jeweiligen literarischen Kontexte.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Mittelhochdeutsche Literatur, Ritter, Held, Artus-Epik, Heldenepik, Hartmann von Aue, Erec, Nibelungenlied, Ritterideal, höfische Kultur, religiöse Tugenden, weltliche Tugenden, Tugendlehre, triuwe, hövescheit, êre, gesellschaftliche Bedeutung.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen der Konzeption des Ritters (in Erec) und des Helden (im Nibelungenlied) herauszuarbeiten und deren Bedeutung im gesellschaftlichen Kontext des Mittelalters zu analysieren.
Welche Aspekte des Rittertums werden untersucht?
Die Arbeit untersucht den Wandel des Ritterbegriffs, seine religiöse Ausprägung (milites Christi), die Verbindung von religiösen und weltlichen Tugenden (Frauendienst, höfische Etikette), und zentrale Tugenden wie Demut, Mitleid, Treue (triuwe) und Höflichkeit (hövescheit). Die Bedeutung von Ehre (êre) und moralischer Integrität (morâliteit) wird ebenfalls betrachtet.
Wie werden Ritter und Held verglichen?
Der Vergleich von Ritter und Held erfolgt durch eine Gegenüberstellung der Figuren Erec (als Ritter) und Hagen/Siegfried (als Helden), wobei ihre Handlungen, Motive und ihre Rolle innerhalb der jeweiligen Epengattung analysiert werden. Die Arbeit beleuchtet die unterschiedlichen Werte und Ideale, die diese Figuren repräsentieren.
- Quote paper
- Anika Maßmann (Author), 2016, Die Konzeption von Ritter und Held in der mittelhochdeutschen Literatur. Hartmann von Aues "Erec" und das "Nibelungenlied" im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/537357