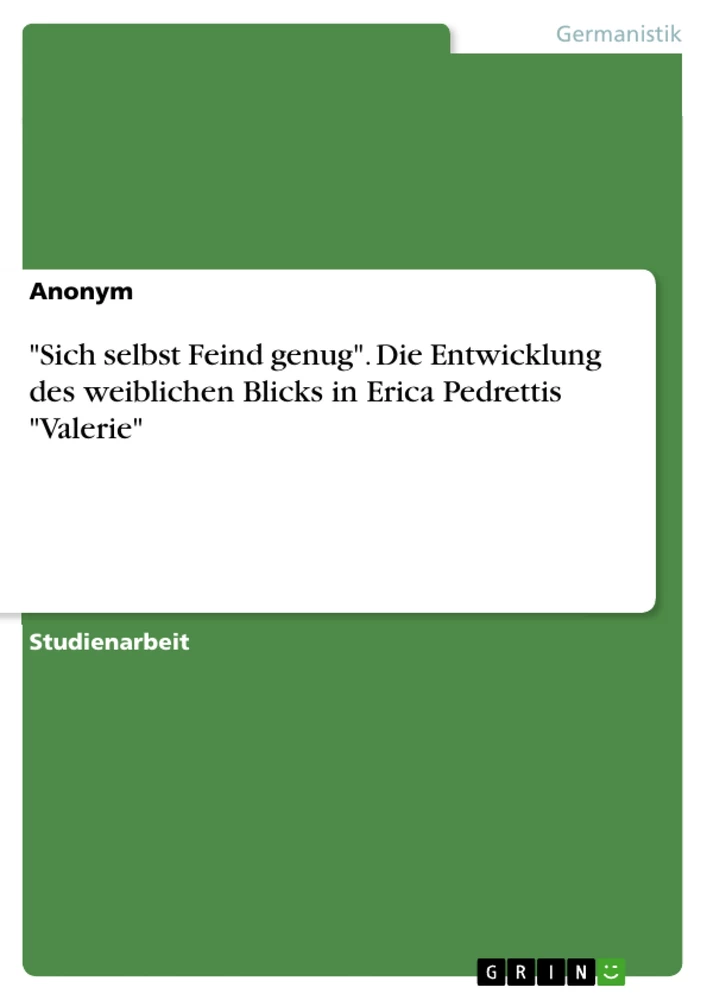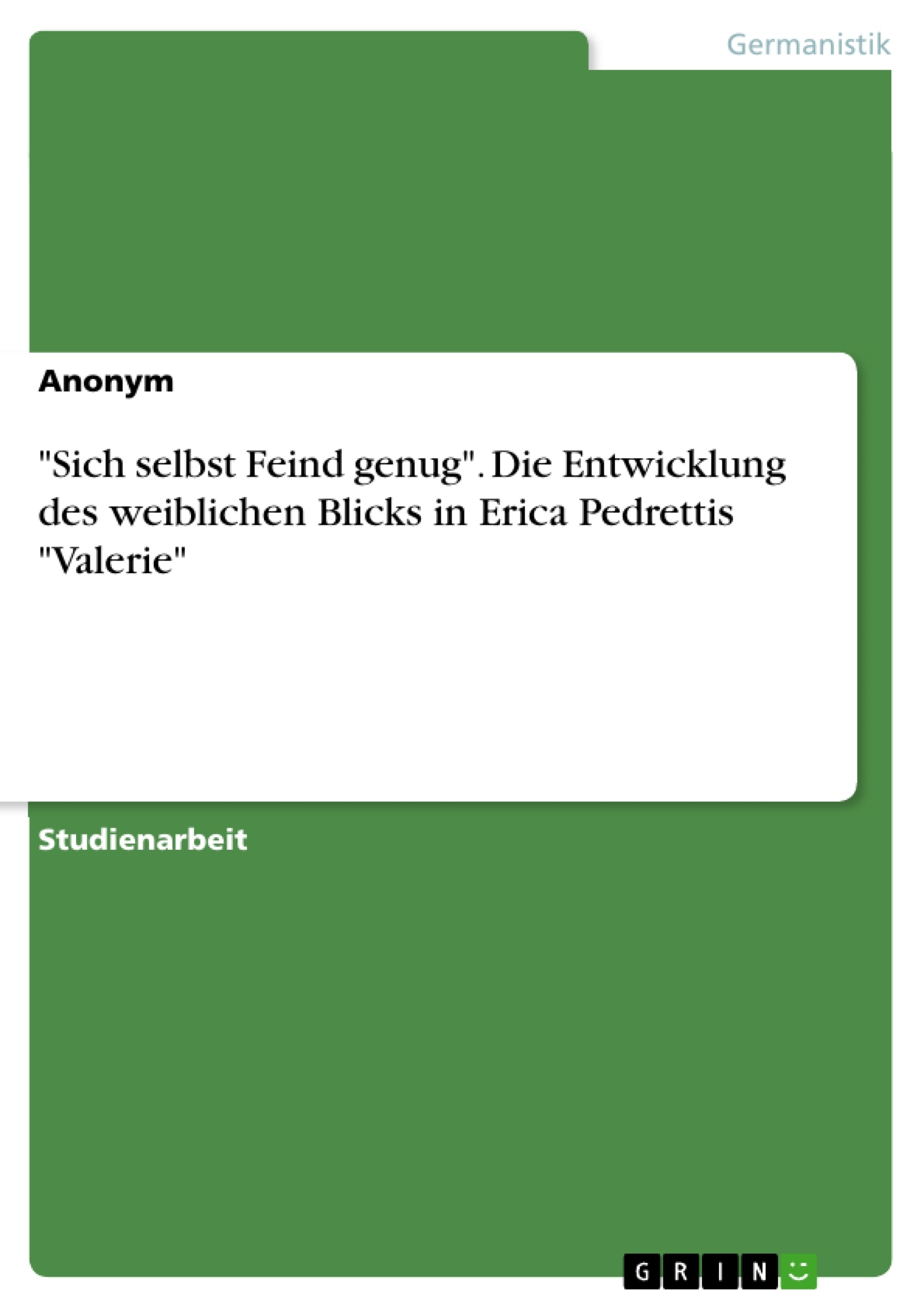In Erica Pedrettis 1986 erschienenen "Valerie oder Das unerzogene Auge" erzählt die Autorin die Geschichte einer Frau, eines Modells und deren Tod durch Krebs. Sie greift dabei auf die historische Konstellation zwischen dem Modell Valentine Godé-Darel und dem Maler Ferdinand Hodler zurück. Aber anders als Godé-Darel, die nur als Bildobjekt existiert, bekommt Valerie eine Stimme, mehr noch einen eigenen Blick verliehen. Das Verhältnis zwischen Maler und Modell, das in der Regel männlich/weiblich, aktiv/passiv besetzt ist, erfährt hier in gewisser Wiese eine Umkehrung, wenn das Modell als sinngebendes Subjekt auftritt. Zuerst nur Spiegel ihres Malers Franz gelingt Valerie eine Lösung und Emanzipation ihrer eigenen Gedanken, ihres eigenen Blickes. Die Dinge fügen sich anders in ihrem unerzogenen Blick, weniger normativ als es bei Franz der Fall ist, aber doch auf ihre eigene Art sehend und erkennend.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- DER MALER
- Das Modell als Spiegel des männlichen Subjekts
- DAS MODELL
- Valeries Adaption des männlichen Blickes
- Bilder einer Landschaft als Entwicklung des eigenen Blicks
- Chinametaphorik
- Krankenhausmetaphorik
- Warten
- DAS GÄNZLICH UNERZOGENE AUGE
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text untersucht die Entwicklung des weiblichen Blicks in Erica Pedrettis Roman "Valerie oder Das unerzogene Auge". Das Werk analysiert die Beziehung zwischen dem Maler Franz und seinem Modell Valerie, deren Geschichte an die Konstellation zwischen Ferdinand Hodler und Valentine Godé-Darel angelehnt ist. Der Fokus liegt auf der Umkehrung des traditionellen Verhältnisses von Maler und Modell und der Entstehung eines unabhängigen weiblichen Blicks.
- Der männliche Blick und seine Auswirkungen auf das weibliche Objekt
- Valeries Entwicklung eines eigenen Blicks als Emanzipation
- Die Rolle von Metaphern und Symbolen in Valeries Wahrnehmung
- Die Bedeutung des "unerzogenen Auges" für Valeries Selbstfindung
- Das Verhältnis zwischen Liebe, Kunst und Tod in der Beziehung zwischen Franz und Valerie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in den Roman "Valerie oder Das unerzogene Auge" von Erica Pedretti ein und stellt die Beziehung zwischen dem Maler Franz und seinem Modell Valerie vor, die an die Geschichte von Ferdinand Hodler und Valentine Godé-Darel angelehnt ist. Der Text betont die Bedeutung des weiblichen Blicks und die Umkehrung des traditionellen Verhältnisses von Maler und Modell.
DER MALER
Dieses Kapitel analysiert das Verhältnis zwischen Maler und Modell unter dem Blickwinkel der psychoanalytischen Theorie. Der männliche Blick wird als ein Blick der Kastration und des Mangels dargestellt, der die Frau zum Objekt der Begierde und Projektion macht. Valerie wird als Spiegel des männlichen Subjekts und als Objekt des Malers Franz dargestellt, der sie als Repräsentation der Weiblichkeit und der Natur betrachtet.
DAS MODELL
In diesem Kapitel wird Valeries Entwicklung eines eigenen Blicks beleuchtet. Es werden verschiedene Aspekte ihrer Wahrnehmung und ihre Adaption des männlichen Blicks analysiert, darunter ihre Verwendung von Metaphern wie der Chinametaphorik und der Krankenhausmetaphorik. Valerie entwickelt einen "unerzogenen" Blick, der ihr hilft, die Welt auf eine andere Weise zu sehen und sich von der männlichen Perspektive zu lösen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieses Textes sind: weiblicher Blick, männlicher Blick, Modell, Maler, Emanzipation, "unerzogenes Auge", Metapher, Symbol, Kastration, Projektion, Psychoanalyse, Pedretti, Valerie, Franz, Hodler, Godé-Darel.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Erica Pedrettis Roman "Valerie"?
Der Roman thematisiert die Geschichte von Valerie, einem Modell, und ihrem Krebstod, angelehnt an die historische Beziehung zwischen Ferdinand Hodler und Valentine Godé-Darel.
Was bedeutet der Begriff "das unerzogene Auge" im Werk?
Es beschreibt Valeries Entwicklung eines eigenen, unabhängigen weiblichen Blicks, der sich von den normativen Vorgaben des männlichen Malers emanzipiert.
Welche Rolle spielt die Psychoanalyse in der Analyse des Textes?
Die Arbeit nutzt psychoanalytische Theorien, um den männlichen Blick als Instrument der Kastration und Projektion zu untersuchen, dem das Modell als Spiegel dient.
Wie verändert sich das Verhältnis zwischen Maler und Modell?
Das traditionell aktiv-passive (männlich-weibliche) Verhältnis erfährt eine Umkehrung, indem das Modell als sinngebendes Subjekt mit eigener Stimme auftritt.
Welche Metaphern werden in der Analyse hervorgehoben?
Besonders die Chinametaphorik und die Krankenhausmetaphorik (Thema Warten) spielen eine zentrale Rolle für Valeries Wahrnehmung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2012, "Sich selbst Feind genug". Die Entwicklung des weiblichen Blicks in Erica Pedrettis "Valerie", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/537428