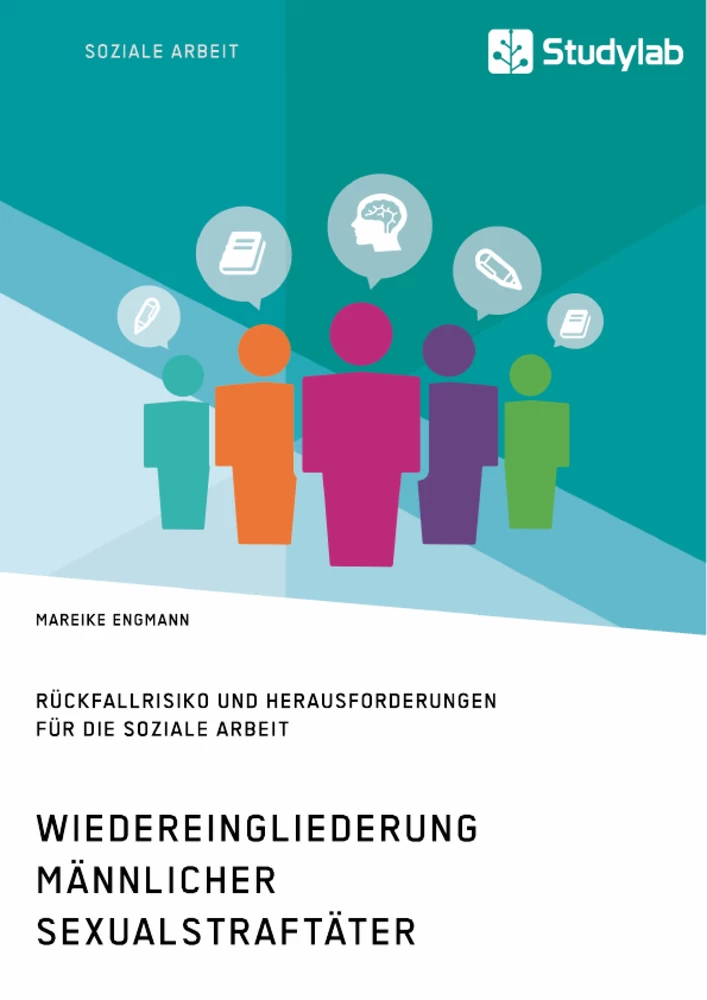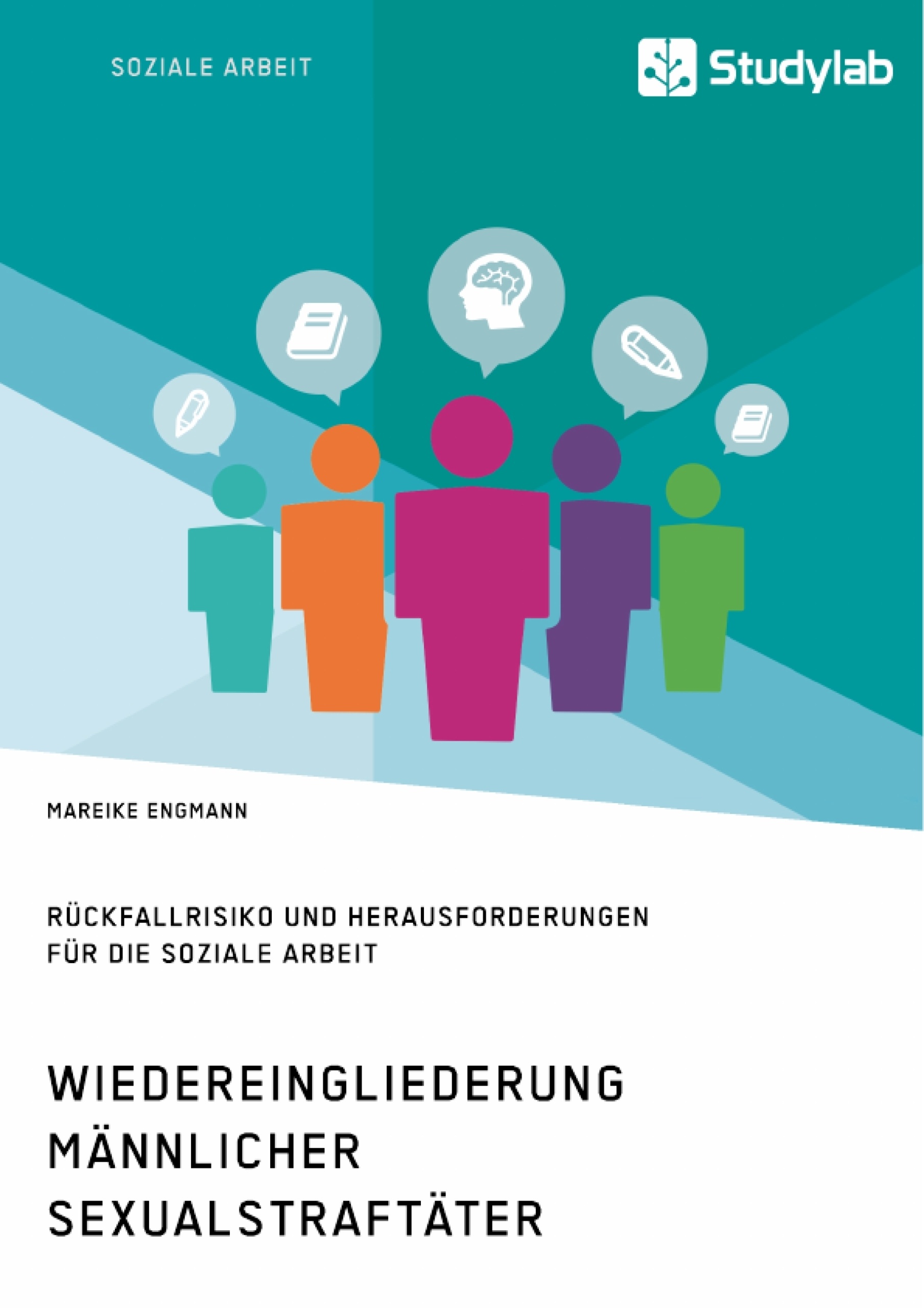Sexualstraftäter verstoßen nicht nur gegen das Strafgesetzbuch, sondern auch gegen das deutsche Grundgesetz. Denn in Artikel 1 steht: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Eine Sexualstraftat bricht diese Rechte, außerdem hat sie weitreichende Folgen für das Leben der Opfer. Es ist deshalb umso wichtiger, dass bei der Wiedereingliederung von Sexualstraftätern das Rückfallrisiko bekannt ist.
Warum und wie entsteht sexualstraffälliges Verhalten? Welche Konzepte zur Wiedereingliederung männlicher Sexualstraftäter gibt es? Welche sind bereits praxiserprobt? Und welche Herausforderungen entstehen für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter? Mareike Engmann setzt sich mit der Rückfallquote nach Sexualstraftaten sowie dem Thema Wiedereingliederung auseinander.
Dazu klärt Engmann die Begrifflichkeit einer Sexualstraftat sowie ihre rechtlichen Grundlagen. Außerdem analysiert sie unterschiedliche Typen von Sexualstraftätern sowie die jeweiligen Eigenschaften einer Sexualstraftat. Anschließend stellt sie exemplarisch das niedersächsische Konzept zum Umgang mit rückfallgefährdeten Sexualstraftätern vor. Ihre Publikation unterstreicht, wie wichtig die Soziale Arbeit beim Thema Wiedereingliederung ist.
Aus dem Inhalt:
- Vergewaltigung;
- Sexualdelikt;
- Bewährungshilfe;
- Resozialisierung;
- Strafvollzug
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Sexualstraftäter und Sexualdelikte
- 2.1 Begriffsbestimmung Sexualstraftäter
- 2.2 Sexualstraftäter Klassifizierung
- 2.3 Theoretischer Ansatz für sexualstraffälliges Verhalten
- 2.4 Rückfallrisiko Sexualstraftäter
- 3 Wiedereingliederung
- 3.1 Begriffserklärung Wiedereingliederung
- 3.2 Stationäre Wiedereingliederung von Sexualstraftätern
- 3.3 Ambulante Wiedereingliederung durch das Niedersächsische Konzept
- 4 Herausforderungen für Justizsozialarbeitende im ambulanten Wiedereingliederungsprozess
- 4.1 Fachliche Klärung
- 4.2 Professionelle Aufgaben und Methoden
- 4.3 Gesellschaftliches Bild
- 4.4 Medien und Öffentlichkeitsarbeit
- 4.5 Besondere Klientengruppen
- 5 Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Wiedereingliederung männlicher Sexualstraftäter und den damit verbundenen Herausforderungen für die Soziale Arbeit. Ziel ist es, einen Überblick über den Prozess der Wiedereingliederung zu geben, die relevanten theoretischen Ansätze zu beleuchten und die spezifischen Schwierigkeiten, denen Justizsozialarbeitende begegnen, zu analysieren.
- Begriffsbestimmung und Klassifizierung von Sexualstraftätern
- Theoretische Ansätze zum Verständnis sexualstraffälligen Verhaltens
- Methoden und Herausforderungen der Wiedereingliederung (stationär und ambulant)
- Die Rolle der Justizsozialarbeit im Wiedereingliederungsprozess
- Gesellschaftliche und mediale Wahrnehmung von Sexualstraftätern
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Wiedereingliederung männlicher Sexualstraftäter ein und skizziert die Bedeutung des Themas für die Soziale Arbeit. Sie beschreibt den Aufbau der Arbeit und benennt die Forschungsfragen, die im Verlauf behandelt werden. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrachtung des Rückfallrisikos und der Herausforderungen, denen sich die beteiligten Fachkräfte gegenübersehen.
2 Sexualstraftäter und Sexualdelikte: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Begriffsbestimmung von Sexualstraftätern und Sexualdelikten. Es beschreibt verschiedene Klassifizierungssysteme, die zur Einordnung des Verhaltens und des Risikoprofils der Täter herangezogen werden (z.B. nach Knight und Prentky). Darüber hinaus werden theoretische Ansätze zum Verständnis sexualstraffälligen Verhaltens vorgestellt und das Rückfallrisiko im Detail beleuchtet. Die verschiedenen Facetten des Themas werden umfassend dargestellt, um ein fundiertes Verständnis der Thematik zu schaffen.
3 Wiedereingliederung: Das Kapitel widmet sich dem Prozess der Wiedereingliederung von Sexualstraftätern. Es werden sowohl stationäre als auch ambulante Wiedereingliederungsmaßnahmen erläutert, wobei das niedersächsische Konzept als Beispiel für eine ambulante Strategie detailliert dargestellt wird. Die verschiedenen Ansätze werden hinsichtlich ihrer Zielsetzung, Methoden und Wirksamkeit kritisch beleuchtet, wobei der Fokus auf den jeweiligen Herausforderungen für die Betroffenen und die beteiligten Fachkräfte liegt. Die unterschiedlichen Behandlungsansätze werden miteinander verglichen und ihre Vor- und Nachteile diskutiert.
4 Herausforderungen für Justizsozialarbeitende im ambulanten Wiedereingliederungsprozess: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die spezifischen Herausforderungen, denen Justizsozialarbeitende im ambulanten Wiedereingliederungsprozess begegnen. Es werden fachliche, methodische und gesellschaftliche Aspekte beleuchtet. Die Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit den Klienten, den Angehörigen und anderen Institutionen, der Umgang mit der öffentlichen Wahrnehmung und den Medien, sowie die besonderen Herausforderungen bei bestimmten Klientengruppen werden eingehend analysiert. Das Kapitel bietet einen detaillierten Einblick in die komplexe und anspruchsvolle Arbeit der Justizsozialarbeit im Kontext der Wiedereingliederung.
Schlüsselwörter
Wiedereingliederung, Sexualstraftäter, Rückfallrisiko, Justizsozialarbeit, Ambulante Wiedereingliederung, Stationäre Wiedereingliederung, Niedersächsisches Konzept, Risikoklassifizierung, Sexualdelikte, Gesellschaftliche Wahrnehmung, Medien, Herausforderungen.
Häufig gestellte Fragen zur Wiedereingliederung männlicher Sexualstraftäter
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit der Wiedereingliederung männlicher Sexualstraftäter und den damit verbundenen Herausforderungen für die Soziale Arbeit. Sie gibt einen Überblick über den Wiedereingliederungsprozess, beleuchtet relevante theoretische Ansätze und analysiert die Schwierigkeiten von Justizsozialarbeitenden.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Begriffsbestimmung und Klassifizierung von Sexualstraftätern, theoretische Ansätze zum Verständnis sexualstraffälligen Verhaltens, Methoden und Herausforderungen der Wiedereingliederung (stationär und ambulant), die Rolle der Justizsozialarbeit, sowie die gesellschaftliche und mediale Wahrnehmung von Sexualstraftätern.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Sexualstraftäter und Sexualdelikte, Wiedereingliederung, Herausforderungen für Justizsozialarbeitende im ambulanten Wiedereingliederungsprozess und Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas und baut auf den vorherigen Kapiteln auf.
Was wird im Kapitel "Sexualstraftäter und Sexualdelikte" behandelt?
Dieses Kapitel liefert eine umfassende Begriffsbestimmung, beschreibt Klassifizierungssysteme (z.B. nach Knight und Prentky), stellt theoretische Ansätze zum Verständnis sexualstraffälligen Verhaltens vor und beleuchtet detailliert das Rückfallrisiko.
Was wird im Kapitel "Wiedereingliederung" behandelt?
Das Kapitel erläutert stationäre und ambulante Wiedereingliederungsmaßnahmen, mit dem niedersächsischen Konzept als Beispiel für eine ambulante Strategie. Es beleuchtet die Zielsetzung, Methoden und Wirksamkeit verschiedener Ansätze und diskutiert deren Vor- und Nachteile.
Welche Herausforderungen für Justizsozialarbeitende werden im vierten Kapitel behandelt?
Das vierte Kapitel konzentriert sich auf die spezifischen Herausforderungen im ambulanten Wiedereingliederungsprozess. Es beleuchtet fachliche, methodische und gesellschaftliche Aspekte, die Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit Klienten, Angehörigen und Institutionen, den Umgang mit öffentlicher Wahrnehmung und Medien sowie die besonderen Herausforderungen bei bestimmten Klientengruppen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Wiedereingliederung, Sexualstraftäter, Rückfallrisiko, Justizsozialarbeit, Ambulante Wiedereingliederung, Stationäre Wiedereingliederung, Niedersächsisches Konzept, Risikoklassifizierung, Sexualdelikte, Gesellschaftliche Wahrnehmung, Medien, Herausforderungen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, einen Überblick über die Wiedereingliederung männlicher Sexualstraftäter zu geben, relevante theoretische Ansätze zu beleuchten und die spezifischen Schwierigkeiten für Justizsozialarbeitende zu analysieren. Der Fokus liegt auf einer ganzheitlichen Betrachtung des Rückfallrisikos und der Herausforderungen der beteiligten Fachkräfte.
- Quote paper
- Mareike Engmann (Author), 2020, Wiedereingliederung männlicher Sexualstraftäter. Rückfallrisiko und Herausforderungen für die Soziale Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/537450