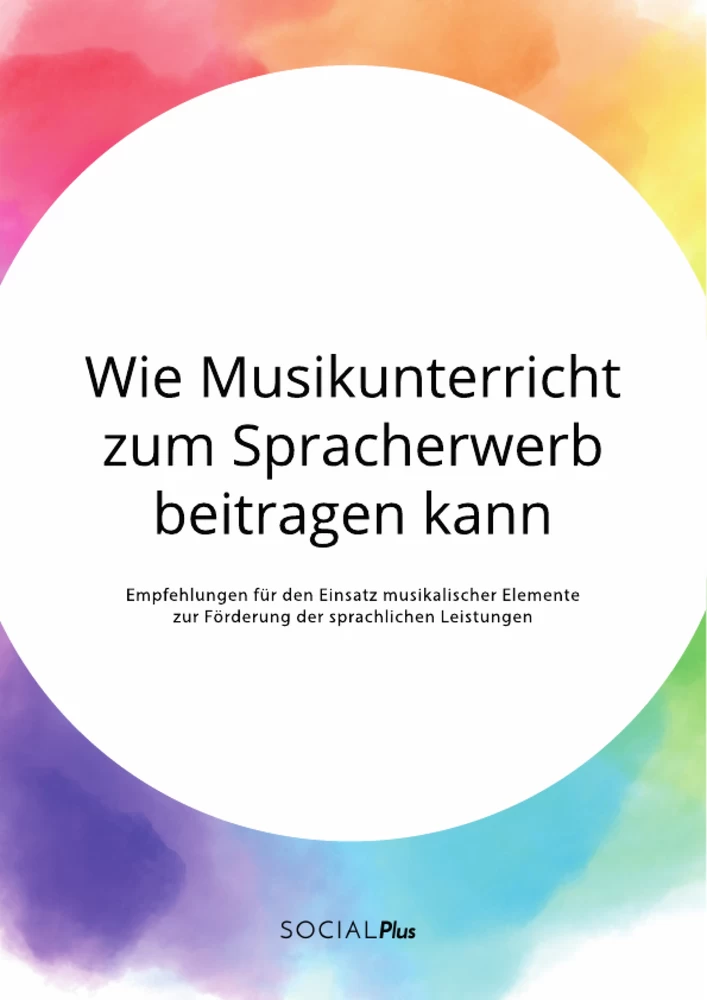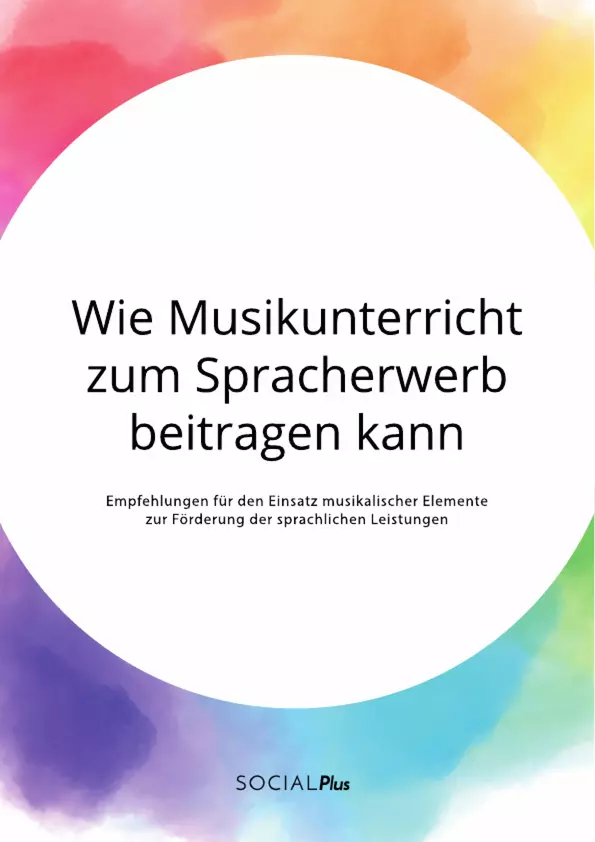Musizieren kann zu Verbesserungen im räumlichen Denken, in der Intelligenz und in sprachlichen Fähigkeiten führen. Dennoch kommt Musik im schulischen Alltag hauptsächlich im Musikunterricht zum Einsatz.
Welche Parallelen kann man zwischen Sprache und Musik feststellen? Wie kann Musik beim Erlernen einer Sprache helfen und wie wirkungsvoll ist eine musikalische Förderung in dieser Hinsicht? Treten Unterschiede bei der musikalischen Förderung des Erst- und Zweitsprachenerwerbs auf?
Die Autorin untersucht, welche musikalischen Methoden erfolgreich zur Förderung des Spracherwerbs beitragen. Sie stellt konkrete Einsatzmöglichkeiten von Musik im Erst- und Fremdsprachenunterricht vor und zeigt, für welche Aufgabenbereiche sie sich eignet. Ihr Buch richtet sich an Pädagog/innen, Erzieher/innen und Lehrkräfte.
Aus dem Inhalt:
- Musizieren;
- Hörverstehen;
- Schreibfähigkeit;
- Leseverständnis;
- Lieddiktate;
- Erzähllieder
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Parallelen zwischen Musik und Sprache
- Vergleichbare Merkmale und Unterschiede
- Gemeinsamer Ursprung
- Neuronale Gemeinsamkeiten
- Syntax in der Musik
- Die Rolle der Musik beim Spracherwerb
- Wirkung von Musik auf das Gehirn
- Frühe Sprachentwicklung
- Erstspracherwerb
- Fremdsprachenerwerb
- Steigerung der Motivation durch Emotionen
- Prosodie - lautliche Eigenschaften der Sprache
- Transfereffekte – Auswirkungen musikalischer Betätigung auf sprachliche Leistungen
- Hörverständnis
- Lese- und Schreibfähigkeit
- Vokabular-Erhöhung
- Syntax
- Aussprache
- Möglichkeiten der Verwendung von Musik zur Förderung des Spracherwerbs
- Lieder
- Rhythmische Ansätze
- Erzähllieder, Klanggeschichten und Sprechgesang
- Lieddiktate
- Musikvideos
- Gedichte
- Musik und Bewegung
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Möglichkeiten, wie Musik zur Förderung des Spracherwerbs eingesetzt werden kann. Sie untersucht, wie Musik und Sprache auf neuronaler Ebene zusammenhängen und welche Auswirkungen musikalische Aktivität auf die sprachlichen Fähigkeiten haben kann. Die Forschungsfrage ist, welche musikalischen Methoden erfolgreich zur Steigerung der sprachlichen Leistungen beitragen können.
- Zusammenhänge zwischen Musik und Sprache
- Die Rolle der Musik beim Spracherwerb
- Transfereffekte von musikalischer Betätigung auf die sprachliche Leistungsfähigkeit
- Mögliche Einsatzformen von Musik im Spracherwerb
- Didaktisches Potenzial der Musik im Sprachunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel legt die Grundlage für die Untersuchung, indem es die komplexe Beziehung zwischen Musik und Sprache beleuchtet. Es werden Parallelen und Unterschiede zwischen den beiden Systemen analysiert, die sowohl auf kognitiver als auch auf neuronaler Ebene bestehen. Das zweite Kapitel geht auf die Rolle der Musik beim Spracherwerb ein. Es wird untersucht, wie Musik das Gehirn beeinflusst, wie sie die Sprachentwicklung im frühen Kindesalter fördern kann und wie sie für den Erwerb der Mutter- und Fremdsprache genutzt werden kann. Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die Transfereffekte musikalischer Aktivität auf die sprachliche Leistungsfähigkeit. Es wird gezeigt, wie Musik die Bereiche Hörverständnis, Lese- und Schreibfähigkeit, Wortschatzentwicklung, Syntax und Aussprache positiv beeinflussen kann. Das vierte Kapitel präsentiert verschiedene Möglichkeiten, Musik zur Förderung des Spracherwerbs einzusetzen, darunter Lieder, rhythmische Ansätze, Erzähllieder, Lieddiktate, Musikvideos, Gedichte und die Kombination von Musik mit Bewegung.
Schlüsselwörter
Spracherwerb, Musikpädagogik, musikalische Förderung, Transfereffekte, Sprache und Musik, neuronale Zusammenhänge, Didaktik, Musiktherapie, Spracherwerbsunterricht, musikalische Elemente, Rhythmus, Melodie, Gesang, Lieddiktate, Musikvideos, Gedichte, Bewegung, Sprachentwicklung, Erstspracherwerb, Fremdsprachenerwerb, Motivation.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2020, Wie Musikunterricht zum Spracherwerb beitragen kann. Empfehlungen für den Einsatz musikalischer Elemente zur Förderung der sprachlichen Leistungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/537467