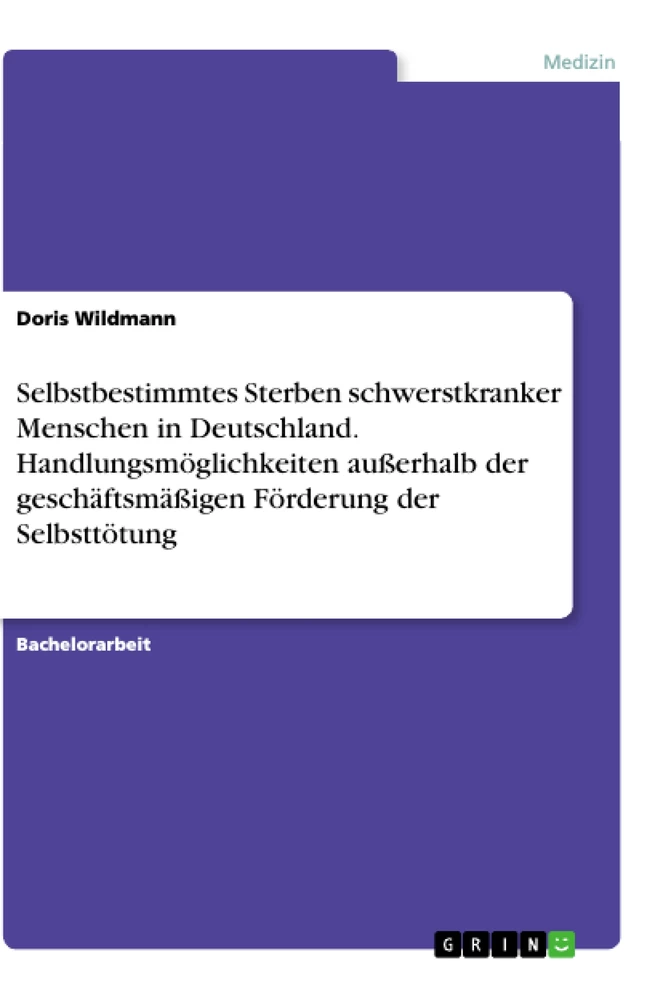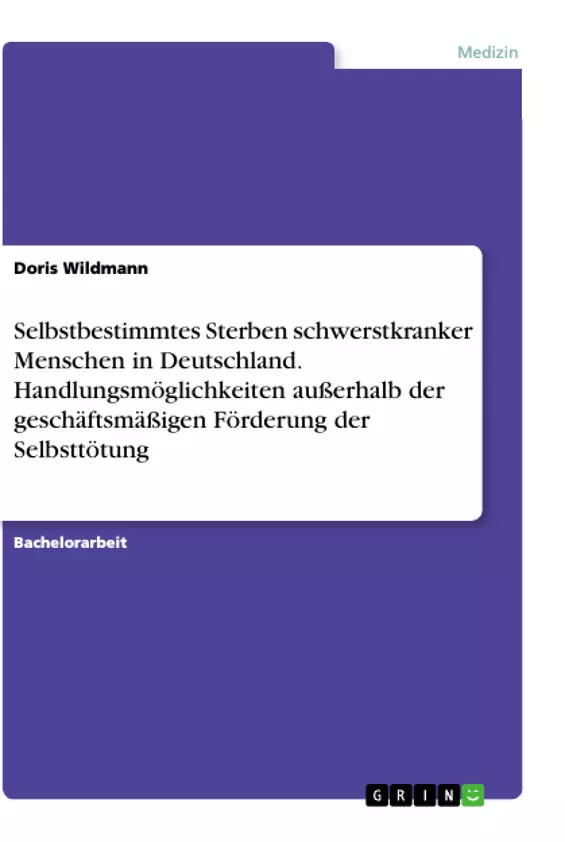Welche Möglichkeiten stehen einem schwerstkranken Menschen in Deutschland offen, um selbstbestimmt zu sterben, außerhalb der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung? Durch die Einführung des § 217 StGB im Dezember 2015 wurde die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung unter Strafe gestellt. Ziel war, dass Vereine, die in diesem Bereich tätig waren, ihre Tätigkeit einstellen sollten. Dies wurde erreicht, doch Ärzte sind verunsichert, welche medizinischen Tätigkeiten am Lebensende ihrer Patienten als geschäftsmäßig gelten. Zeitgleich hat die Bundesregierung das Hospiz- und Palliativgesetz (HPG) geschaffen. Damit sollen Vorsorgemaßnahmen am Lebensende verbessert und der Patientenwille gestärkt werden. Der Patientenwille ist maßgeblich für ärztliches und pflegerisches Handeln. Das neue Gesetz soll dazu beitragen, dass das Selbstbestimmungsrecht der Menschen in Deutschland am Lebensende gestärkt wird.
Durchgeführt wurde eine Literaturstudie an den Datenbanken der Katholischen Stiftungshochschule und der Staatsbibliothek München. Dissertationen der Technischen Universität München wurden online recherchiert. Informationen von Gesellschaften, die das Thema Sterbehilfe und/oder Palliativpflege als Schwerpunkt haben, wurden eingeholt. Menschen mit einer schweren Krankheit in einer ausweglosen Situation wünschen sich häufig eine Beendigung ihres Leidens. Nach einer Studie von Monforte-Royo, Villavicencio-Chávez, Tomás-Sábado, Mahtani-Chugani & Balaguer wird dieser Wunsch als Reaktion auf immenses emotionales Leid hervorgerufen. Diese Menschen erleben einen Selbstverlust, der mit dem Funktions- und Rollenverlust auch den Sinnverlust einschließt. Ein zentraler Aspekt dabei ist der empfundene Verlust des persönlichen Würdegefühls. Daher stellt sich die Frage, wie ein Mensch Würdeverlust empfinden kann, da nach dem deutschen Rechtssystem einem jeden Menschen die Würde innewohnt. Verliert ein Mensch seine Würde durch eine schwerste Krankheit?
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Methodik
- 3 Begrifflichkeiten
- 3.1 Geschäftsmäßige Förderung
- 3.2 Euthanasie versus Sterbehilfe: Rückblick und gegenwärtige Situation
- 4 Arten der Sterbehilfe
- 4.1 Aktive Sterbehilfe
- 4.1.1 Indirekte aktive Sterbehilfe
- 4.1.2 Direkte aktive Sterbehilfe
- 4.1.3 Beihilfe zur Selbsttötung
- 4.2 Passive Sterbehilfe
- 4.2.1 Sterbebegleitung
- 4.2.2 Zulassen des Sterbens
- 5 Grenzen des Selbstbestimmungsrechtes eines schwerstkranken Menschen
- 5.1 Sterbeorte in Deutschland
- 5.2 Verhältnismäßigkeit von Autonomie und Selbstbestimmung zueinander
- 5.3 Menschenwürde am Lebensende
- 6 Pro und contra des § 217 StGB Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung
- 6.1 Gründe für die Einführung des § 217 StGB
- 6.1.1 Selbsttötung gefährdet das Leben
- 6.1.2 Gefahr von ökonomischen Interessen
- 6.2 Kritik am § 217 StGB
- 7 Vorsorgemöglichkeiten bei schwerster Krankheit und Sterben in Deutschland
- 7.1 Willensäußerung durch den Patienten selbst
- 7.2 Selbstbestimmung durch einen Vertreter
- 7.3 Selbstbestimmung durch die Patientenverfügung
- 7.4 Vorausverfügung durch Gesundheitliche Versorgungsplanung
- 7.5 Medizinische Therapien am Lebensende ohne Vorsorgemaßnahmen
- 7.5.1 Ermittlung und Berücksichtigung des mutmaßlichen Willens
- 7.5.2 Sonderfall Wachkoma
- 8 Humane und straffreie Beendigung einer unerträglichen Leidenssituation am Lebensende
- 8.1 Freiwilliger Verzicht auf Essen und Trinken
- 8.2 Durchführung der Beendigung von lebenserhaltenden Maßnahmen
- 8.2.1 Gütliches Vorgehen
- 8.2.2 Vorgehen bei Widerstand
- 8.2.3 Durchsetzung des Patientenwillens über den Rechtsweg
- 8.3 Intensive palliative Schmerzbehandlung und palliative Sedierung
- 9 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit der rechtlichen und ethischen Problematik des selbstbestimmten Sterbens schwerstkranker Menschen in Deutschland im Kontext des § 217 StGB und des Hospiz- und Palliativgesetzes (HPG). Sie analysiert die Handlungsmöglichkeiten außerhalb der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung und untersucht die Spannungsfelder zwischen Selbstbestimmungsrecht und dem Schutz des Lebens.
- Rechtliche Rahmenbedingungen des selbstbestimmten Sterbens in Deutschland
- Ethische Aspekte der Sterbehilfe und des Patientenwillens
- Handlungsmöglichkeiten für schwerstkranke Menschen am Lebensende
- Bedeutung des Hospiz- und Palliativgesetzes für das Selbstbestimmungsrecht
- Kritik und Bewertung des § 217 StGB und seiner Auswirkungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den aktuellen Stand der Debatte um Sterbehilfe in Deutschland beleuchtet und die Forschungsfrage formuliert: Welche Möglichkeiten stehen einem schwerstkranken Menschen in Deutschland offen, um selbstbestimmt zu sterben, außerhalb der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung?
Kapitel 2 beschreibt die Methodik der Arbeit, die sich auf eine Literaturstudie an den Datenbanken der Katholischen Stiftungshochschule und der Staatsbibliothek München sowie auf Dissertationen der Technischen Universität München stützt. Außerdem wurden Informationen von Gesellschaften zum Thema Sterbehilfe und Palliativpflege eingeholt.
Kapitel 3 widmet sich der Klärung von Begrifflichkeiten wie "Geschäftsmäßige Förderung" und setzt die aktuelle Diskussion um Sterbehilfe in den historischen Kontext. Dabei werden die verschiedenen Arten der Sterbehilfe definiert: aktive, passive und indirekte Sterbehilfe sowie die Beihilfe zur Selbsttötung.
Kapitel 4 untersucht die Grenzen des Selbstbestimmungsrechtes eines schwerstkranken Menschen in Deutschland. Dabei werden die Sterbeorte in Deutschland, das Verhältnis von Autonomie und Selbstbestimmung sowie die Frage der Menschenwürde am Lebensende betrachtet.
Kapitel 5 beleuchtet die Vor- und Nachteile des § 217 StGB und geht auf die Kritik an diesem Gesetz ein. Die Argumente für die Einführung des § 217 StGB, die auf den Schutz des Lebens und die Vermeidung von ökonomischen Interessen abzielen, werden ebenso betrachtet wie die Kritik, die den Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht beklagt.
Kapitel 6 analysiert die verschiedenen Vorsorgemöglichkeiten, die schwerstkranken Menschen in Deutschland zur Verfügung stehen. Dazu zählen Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten und die Vorausverfügung durch Gesundheitliche Versorgungsplanung. Außerdem werden medizinische Therapien am Lebensende ohne Vorsorgemaßnahmen betrachtet, insbesondere die Ermittlung und Berücksichtigung des mutmaßlichen Willens sowie der Sonderfall Wachkoma.
Kapitel 7 zeigt die humanen und straffreien Möglichkeiten der Beendigung einer unerträglichen Leidenssituation am Lebensende auf. Dabei werden der freiwillige Verzicht auf Essen und Trinken mit palliativmedizinischer Begleitung, die Beendigung von lebenserhaltenden Maßnahmen sowie die intensive palliative Schmerzbehandlung und palliative Sedierung untersucht. Die verschiedenen rechtlichen und ethischen Aspekte dieser Maßnahmen werden im Detail analysiert.
Kapitel 8 fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und zieht Schlussfolgerungen aus der Analyse. Es zeigt, dass das Selbstbestimmungsrecht in Deutschland durch den § 217 StGB eingeschränkt ist, aber dennoch Möglichkeiten bestehen, einen guten Tod zu erfahren.
Schlüsselwörter
Selbstbestimmtes Sterben, Sterbehilfe, § 217 StGB, Hospiz- und Palliativgesetz, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Palliativmedizin, palliative Sedierung, Menschenwürde, Autonomie, Selbstbestimmung, Lebensende, Gesundheitswesen, Ethik, Recht
Häufig gestellte Fragen
Was verbietet der § 217 StGB in Deutschland?
Der Paragraph stellte die geschäftsmäßige (auf Wiederholung angelegte) Förderung der Selbsttötung unter Strafe, was vor allem Vereine der Sterbehilfe betraf.
Welche Arten der Sterbehilfe werden unterschieden?
Man unterscheidet aktive Sterbehilfe (direkt/indirekt), Beihilfe zur Selbsttötung sowie passive Sterbehilfe (Zulassen des Sterbens durch Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen).
Wie kann man seinen Willen am Lebensende rechtlich absichern?
Dies ist durch eine Patientenverfügung, eine Vorsorgevollmacht oder eine gesundheitliche Versorgungsplanung (Vorausverfügung) möglich.
Was ist der "freiwillige Verzicht auf Essen und Trinken" (FVET)?
Es ist eine humane und straffreie Möglichkeit, das eigene Leben selbstbestimmt zu beenden, wobei eine palliativmedizinische Begleitung zur Linderung von Leiden empfohlen wird.
Welche Rolle spielt die palliative Sedierung?
Palliative Sedierung dient dazu, unerträgliche Leiden am Lebensende durch die Herabsetzung des Bewusstseins zu lindern, wenn andere Therapien nicht mehr ausreichen.
- Quote paper
- Doris Wildmann (Author), 2020, Selbstbestimmtes Sterben schwerstkranker Menschen in Deutschland. Handlungsmöglichkeiten außerhalb der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/537754