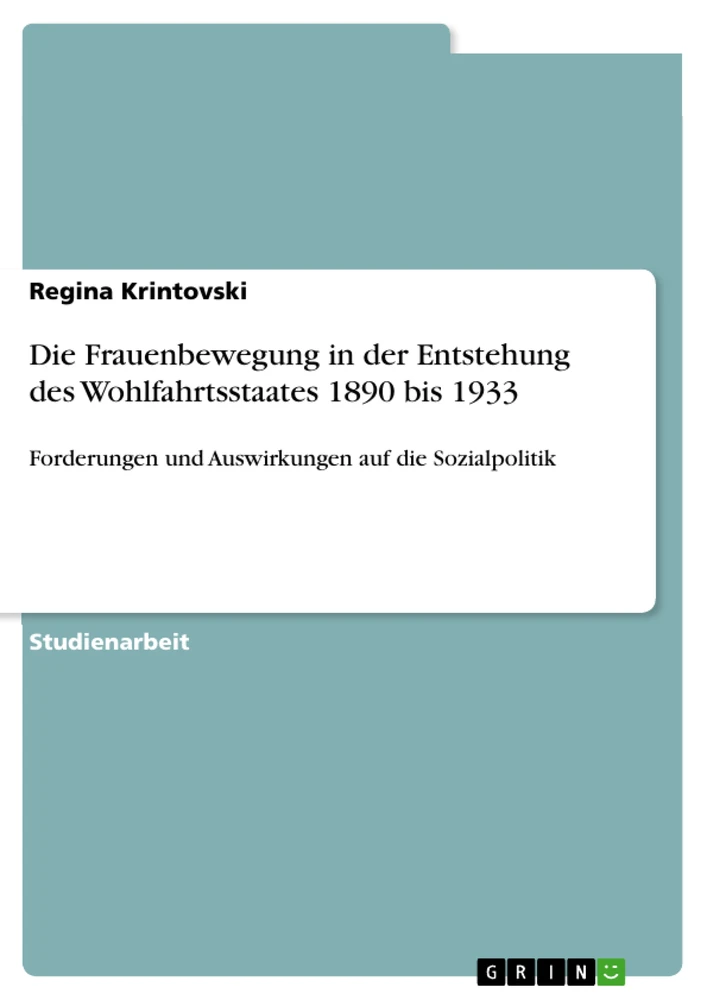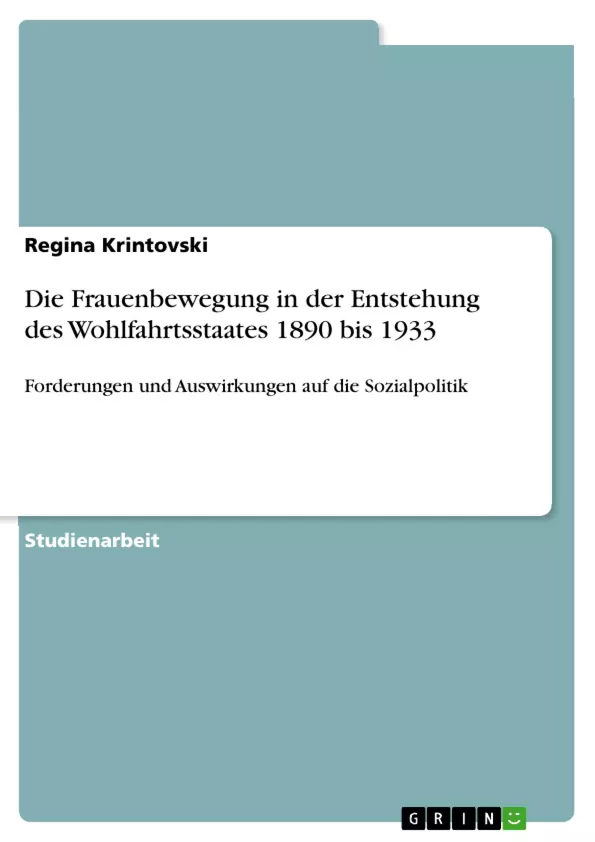Die Arbeit beschäftigt sich mit der Thematik der Frauenbewegung. Die Forderungen der Frauenbewegung zu den Bereichen Bildung, Armut und dem Frauenwahlrecht stehen hierbei im Vordergrund. Somit liegt das Hauptaugenmerk auf der Beantwortung der Frage, welche Forderungen die Frauenbewegung in der Entstehung des Wohlfahrtsstaates stellten und welche Auswirkungen diese auf die Sozialpolitik hatten.
Zunächst werden die Anfänge der Frauenbewegung im frühen neunzehnten Jahrhundert erläutert, die schon vor 1890 begonnen haben. Weiterhin geht der Autor auf die Feministin Louise Otto-Peters ein sowie auf den vor ihr gegründeten Allgemeinen Deutschen Frauenverein. Dabei wird erläutert, wofür dieser Verein einstand und dessen Mitglieder gekämpft haben. Anschließend wird der maternalistische Feminismus behandelt, der sich gegen die Armut von Müttern engagiert hat. Hierbei wird erläutert, wie weibliche Armut entstehen konnte und welche Forderungen die mutterschaftsbezogene Frauenbewegung hatte. Darauf folgenden werden die Kämpfe um das Frauenwahlrecht beschrieben und dabei auch auf die Frauenbewegung während des Ersten Weltkrieges eingegangen. Abschließend wird die Nachkriegszeit behandelt. Hierfür wird erläutert, welche Auswirkungen die Frauenbewegung aus der Vorkriegszeit und Kriegszeit auf die Sozialpolitik hatte und welche Gesetze aus ihren Forderungen geschlossen wurden. Weiterhin wird thematisiert, wie die Frauenbewegung in der Weimarer Republik weiter ging und wie das neue Bild der Frau in dieser Zeit aussah sowie dieses in der Gesellschaft aufgenommen wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Frauenbewegung in der Entstehung des Wohlfahrtsstaates 1890-1933
- Louise Otto-Peters und der Allgemeine Deutsche Frauenverein
- Weibliche Armut und der maternalistische Feminismus
- Das Frauenwahlrecht
- Auswirkungen der Frauenbewegung auf die Nachkriegszeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit den Forderungen der Frauenbewegung in Deutschland während der Entstehung des Wohlfahrtsstaates von 1890 bis 1933. Sie untersucht, wie die Frauenbewegung zu den Bereichen Bildung, Armut und dem Frauenwahlrecht beitrug, und welche Auswirkungen diese Forderungen auf die Sozialpolitik hatten.
- Die Anfänge der Frauenbewegung im 19. Jahrhundert
- Die Rolle von Louise Otto-Peters und dem Allgemeinen Deutschen Frauenverein
- Der maternalistische Feminismus und die Bekämpfung der weiblichen Armut
- Der Kampf um das Frauenwahlrecht und die Auswirkungen auf die Frauenbewegung während des Ersten Weltkriegs
- Die Folgen der Frauenbewegung für die Sozialpolitik in der Nachkriegszeit und die Entwicklung des Frauenbildes in der Weimarer Republik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung liefert einen Überblick über die Rolle von Frauen im 19. Jahrhundert und stellt die Bedeutung der Frauenbewegung für die Erlangung von Rechten und Gleichberechtigung heraus. Kapitel 2 beleuchtet die Anfänge der Frauenbewegung in Deutschland und die Aktivitäten von Louise Otto-Peters sowie des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins. Es werden die Herausforderungen weiblicher Armut und die Forderungen des maternalistischen Feminismus behandelt. Das Kapitel zum Frauenwahlrecht diskutiert die Kämpfe um dieses Recht und die Bedeutung der Frauenbewegung während des Ersten Weltkriegs. Die Auswirkungen der Frauenbewegung auf die Nachkriegszeit werden im letzten Kapitel untersucht, wobei die Entwicklungen in der Weimarer Republik und das sich verändernde Frauenbild im Mittelpunkt stehen.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit konzentriert sich auf die Frauenbewegung in Deutschland während der Entstehung des Wohlfahrtsstaates, wobei die Schwerpunkte auf den Bereichen Bildung, Armut und dem Frauenwahlrecht liegen. Die wichtigsten Schlüsselbegriffe umfassen Feminismus, Frauenrechte, Sozialpolitik, Louise Otto-Peters, Allgemeiner Deutscher Frauenverein, maternalistischer Feminismus, Frauenwahlrecht, Weimarer Republik und das sich verändernde Frauenbild.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Louise Otto-Peters?
Eine bedeutende deutsche Feministin und Gründerin des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins im 19. Jahrhundert.
Was ist maternalistischer Feminismus?
Eine Strömung, die sich besonders für die Rechte und die soziale Absicherung von Müttern einsetzte.
Wann erhielten Frauen in Deutschland das Wahlrecht?
Das Frauenwahlrecht wurde in Folge der Revolution 1918 eingeführt.
Wie veränderte sich das Frauenbild in der Weimarer Republik?
Es entstand das Bild der „neuen Frau“, die berufstätig, modern und politisch aktiv war.
Welchen Einfluss hatte die Frauenbewegung auf die Sozialpolitik?
Ihre Forderungen führten zu neuen Gesetzen im Bereich Mutterschutz, Bildung und Armutsbekämpfung.
- Quote paper
- Regina Krintovski (Author), 2019, Die Frauenbewegung in der Entstehung des Wohlfahrtsstaates 1890 bis 1933, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/537866