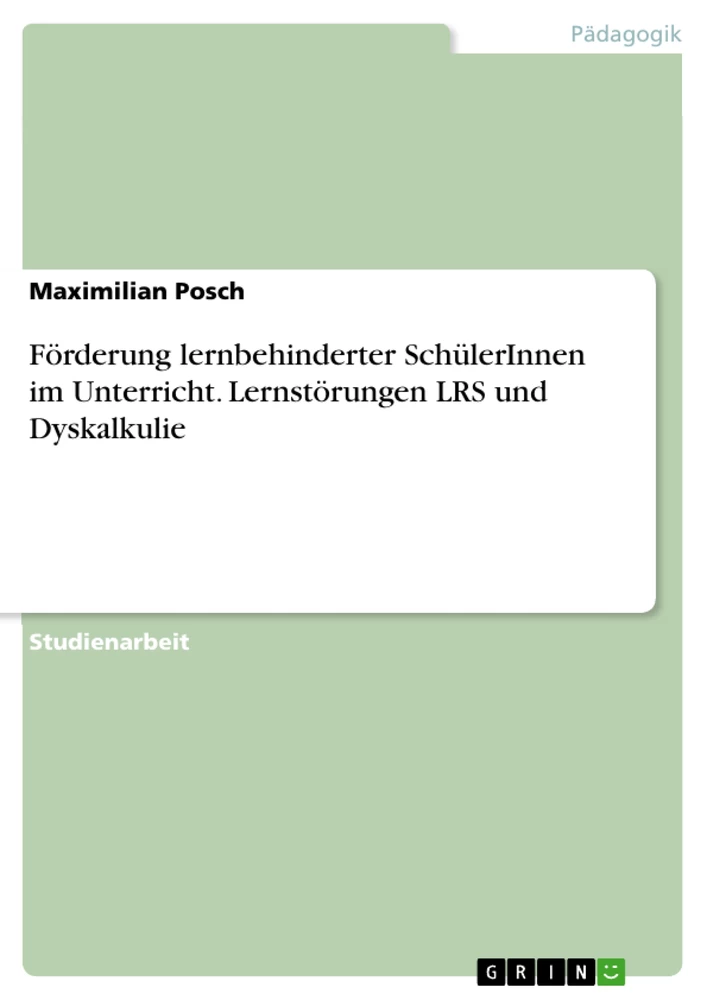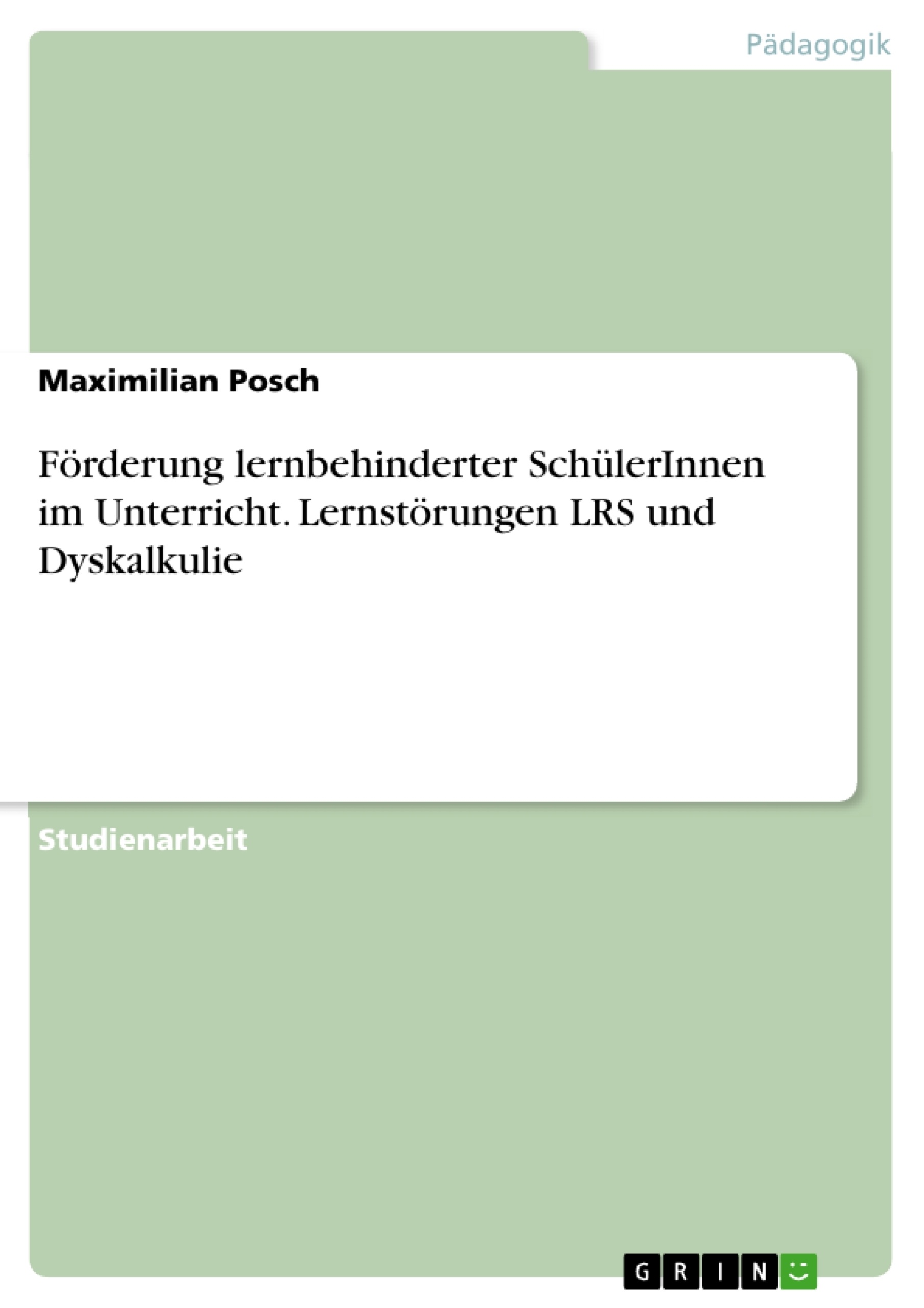Zu Beginn der Arbeit werden die beiden Lernstörungen LRS und Dyskalkulie kurz dargestellt und im Anschluss wird sich der Frage gewidmet, welche Chancen und Möglichkeiten eine Lehrperson hat lernschwache Schülerinnen und Schüler in den normalen Unterricht zu integrieren und entsprechend zu fördern, damit die Lernschwäche kein Hindernis im Lernprozess mehr darstellt. Anschließend wird erörtert, welche besonderen Herausforderungen sich für eine Lehrperson daraus ergeben und welche Kompetenzen vorhanden sein müssen.
Im Schulalltag trifft eine Lehrperson tagtäglich auf verschiedene Lerngruppen, die sich in sämtlichen Merkmalen unterscheiden. Sei es das Alter, die Größe der Gruppe, der Anteil von Mädchen und Jungen oder allein die Persönlichkeiten der Schülerinnen und Schüler. Allein dies erfordert von einer Lehrperson besonders die Fähigkeit sich immer wieder auf neue Unterrichtssituationen einzustellen und den Unterricht entsprechend zu planen, um den Schülerinnen und Schülern einen bestmöglichen Wissenszuwachs zu ermöglichen.
Zusätzlich zu dieser Heterogenität der Schulklasse kann nicht davon ausgegangen werden, dass jeder dieser Schülerinnen und Schüler gleich leistungsfähig ist und an den gleichen Voraussetzungen und Maßstäben gemessen werden kann, sei es aus körperlichen, sozialen oder kognitiven Gründen. Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Umgang mit Schülerinnen und Schülern, die aufgrund von Lernstörungen nicht die normalen Leistungserwartungen erbringen können. Genauer gesagt Kinder, bei denen eine Lese – Rechtschreibschwäche (LRS) und/oder Dyskalkulie diagnostiziert wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Lernstörungen
- Allgemein
- Lese-Rechtschreibschwäche (LRS)
- Dyskalkulie
- Chancen und Möglichkeiten der Integration von lernschwachen Schülerinnen und Schülern
- Unterrichtsplanung und Unterrichtsmethode
- Umgang mit Fehlern der lernschwachen Schülerinnen und Schüler und Schwierigkeiten in der Praxis
- Herausforderungen und Kompetenzen der Lehrperson
- Diagnostik
- Umgang mit lernschwachen Schülerinnen und Schülern
- Soziale Integration und Motivation der lernschwachen Schülerinnen und Schüler
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Umgang mit Schülerinnen und Schülern, die aufgrund von Lernstörungen wie LRS und Dyskalkulie nicht die normalen Leistungserwartungen erfüllen können. Sie befasst sich mit der Frage, wie diese Kinder erfolgreich in den Unterricht integriert und gefördert werden können, sodass ihre Lernschwäche kein Hindernis im Lernprozess mehr darstellt.
- Darlegung der Lernstörungen LRS und Dyskalkulie
- Chancen und Möglichkeiten der Integration von lernschwachen Schülern in den Unterricht
- Unterrichtsplanung und -methoden zur Förderung lernschwachen Schüler
- Herausforderungen für Lehrkräfte im Umgang mit lernschwachen Schülern
- Notwendige Kompetenzen von Lehrkräften zur erfolgreichen Integration lernschwachen Schüler
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung liefert einen Überblick über die heterogenen Lerngruppen im Schulalltag und führt in das Thema der Lernstörungen ein. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Definition und den Auswirkungen von Lernstörungen, insbesondere LRS und Dyskalkulie.
Kapitel drei widmet sich den Chancen und Möglichkeiten, die sich durch die Integration lernschwachen Schüler in den normalen Unterricht ergeben. Es werden verschiedene Unterrichtsplanungs- und -methoden beleuchtet, um die individuellen Bedürfnisse dieser Schüler zu berücksichtigen.
Das vierte Kapitel thematisiert die Herausforderungen und Kompetenzen von Lehrkräften im Umgang mit lernschwachen Schülern. Es werden Punkte wie Diagnostik, individuelle Förderung und die soziale Integration dieser Schüler angesprochen.
Schlüsselwörter
Lernstörungen, LRS, Dyskalkulie, Integration, Inklusion, Unterrichtsplanung, Differenzierung, Förderung, Lernschwäche, Herausforderungen, Kompetenzen, Lehrkraft, Soziale Integration, Motivation
Häufig gestellte Fragen
Wie können Schüler mit LRS im Unterricht gefördert werden?
Durch individuelle Binnendifferenzierung, den Einsatz von Hilfsmitteln und eine wertschätzende Fehlerkultur kann die Lese-Rechtschreibschwäche im Lernprozess abgemildert werden.
Was ist Dyskalkulie und wie zeigt sie sich?
Dyskalkulie ist eine Rechenschwäche, bei der Betroffene grundlegende mathematische Konzepte und Zahlenräume nur schwer erfassen können, was oft eine gezielte Diagnostik erfordert.
Welche Kompetenzen benötigen Lehrkräfte für Inklusion?
Lehrkräfte müssen über diagnostische Fähigkeiten verfügen, flexibel in der Unterrichtsplanung sein und die soziale Integration sowie Motivation der Schüler fördern können.
Wie wichtig ist die soziale Integration bei Lernbehinderungen?
Sehr wichtig, da Lernstörungen oft zu Frustration und Ausgrenzung führen. Eine inklusive Klassenatmosphäre stärkt das Selbstwertgefühl und die Lernbereitschaft.
Können lernschwache Schüler am regulären Unterricht teilnehmen?
Ja, die Arbeit zeigt Chancen und Methoden auf, wie durch angepasste Anforderungen eine erfolgreiche Teilhabe am normalen Unterricht möglich ist.
- Quote paper
- Maximilian Posch (Author), 2015, Förderung lernbehinderter SchülerInnen im Unterricht. Lernstörungen LRS und Dyskalkulie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/538086