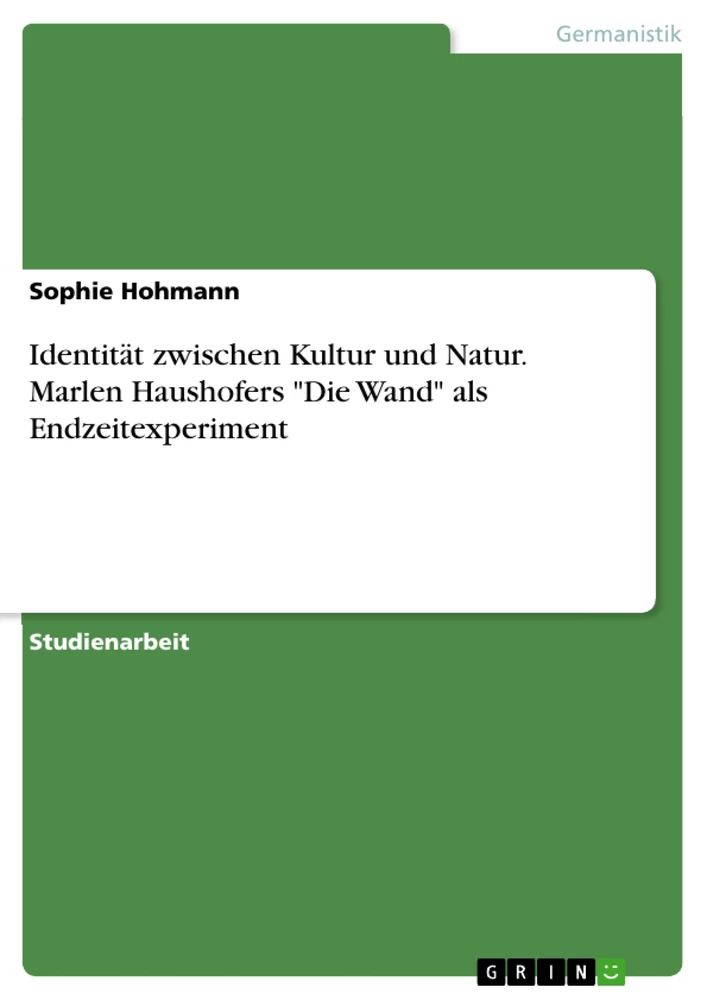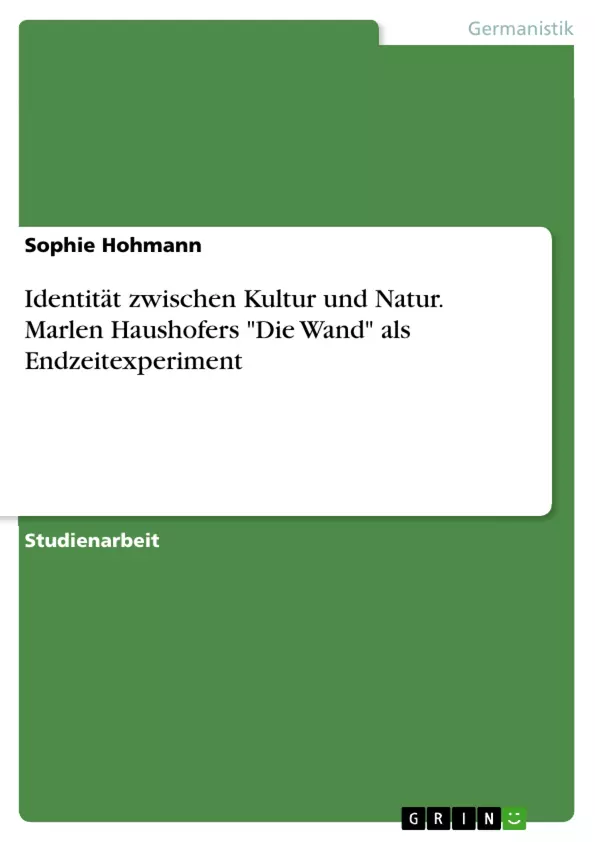Verliert ein sozial isolierter Mensch das Bewusstsein für seine eigene Existenz? Diese Frage stellt sich auch Marlen Haushofer in ihrem wohl bekanntesten Roman "Die Wand" (1963). Nach erstmaligen Lesen scheint sich dies nicht eindeutig bestätigen zu lassen, denn bis Ende des Romans, nach zweieinhalb Jahren im abgeschotteten, nicht sozialisierten und menschenleeren Raum, existiert und schreibt Haushofers Protagonistin immer noch. Dies führt zu der Frage, was geschieht denn dann mit der Ich-Erzählerin, abgekapselt von jeglicher zwischenmenschlicher Kommunikation? Bleibt sie unverändert, wandelt sich ihr Wesen oder löst sich ihr Existenzbewusstsein möglicherweise doch zunehmend auf? Die vorliegende Arbeit will sowohl den Prozess der Identitätsauflösung als auch die Entwicklung einer potenziellen Identitätserneuerung auf verschiedenen Ebenen untersuchen. Als Leitfaden der Untersuchung sollen folgende Forschungsfragen dienen: Gelingt es der Ich-Erzählerin, in der neuen Welt eine neue und stabile Identität auszubilden? Welche Faktoren tragen zum Gelingen oder Misslingen einer positiven Entwicklung bei?
Um diese Frage angemessen beantworten zu können, wird zunächst die Rezeptionsgeschichte des Romans aufgegriffen. Als theoretische Grundlage dient ein kurzer Umriss des zeitgenössischen Identitätsbegriffs sowie Lotmans strukturalistisch-semiotisches Raummodell, das in aller Kürze skizziert wird. Mit Rückblick auf diese theoretische Basis wird zunächst der Prozess der Identitätsauflösung untersucht. Im Anschluss wird gezeigt, welche identitätsstiftenden Begebenheiten die Handlung begleiten und somit eine gänzliche Auflösung des Ichs verhindern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Rezeptionsgeschichte
- Identität, Raum und Ereignis
- Die Wand als Identitätsexperiment
- Identitätsauflösung
- Die psychische Veränderung
- Die physische Veränderung
- Identitätserneuerung
- Familiäre Fürsorge
- Die Funktion des Schreibens
- Die Bedeutung der Zeit
- Die Bedeutung des Raumes
- Identitätsauflösung
- Fazit: Die Jagdhütte als Brücke zwischen Natur und Kultur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Marlen Haushofers Roman „Die Wand“ (1963) als Endzeitexperiment, das die Frage nach der Identitätsbildung in Isolation und Abwesenheit sozialer Interaktion untersucht. Das Hauptanliegen der Arbeit ist die Erforschung der Prozesse der Identitätsauflösung und -erneuerung der Protagonistin in einer Welt, die durch eine unsichtbare Wand von der Außenwelt abgeschottet ist.
- Die Auswirkungen der räumlichen und sozialen Isolation auf die Identität
- Die Rolle von Natur und Kultur bei der Identitätsbildung
- Die Bedeutung von Sprache und Schreiben als Mittel der Selbstfindung
- Die Entwicklung der Ich-Erzählerin im Kontext der Endzeitgeschichte
- Die Beziehung zwischen Individualität und Gesellschaft in der Isolation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Identitätsbildung in Isolation ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Gelingen oder Misslingen der Identitätserneuerung der Protagonistin. Die Rezeptionsgeschichte des Romans beleuchtet verschiedene Interpretationen und thematische Ansätze, u. a. die biografische Ebene, die zivilisationskritische Perspektive und die Parallelen zu Defoes „Robinson Crusoe“. Im Kapitel „Identität, Raum und Ereignis“ werden zentrale Begriffe der Arbeit definiert, insbesondere die Identität als dynamisches und sozial konstruiertes Konzept und Lotmans Raummodell. Die folgenden Kapitel untersuchen die Prozesse der Identitätsauflösung und -erneuerung durch die Analyse der psychischen und physischen Veränderungen der Protagonistin, ihrer Auseinandersetzung mit der Umwelt und dem Einfluss von Sprache und Schreiben. Das Kapitel über die „Identitätserneuerung“ beleuchtet die Bedeutung von familiärer Fürsorge, der Funktion des Schreibens, der Zeit und des Raumes für die Bildung einer neuen Identität.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen der Identitätsbildung, der Isolation, der Endzeit, der Natur und Kultur, sowie der Bedeutung von Sprache und Schreiben. Weitere wichtige Begriffe sind die Raumtheorie, die Rezeptionsgeschichte von Marlen Haushofers Roman „Die Wand“ und die Analyse der psychischen und physischen Veränderungen der Protagonistin. Die Arbeit greift auf zentrale Konzepte der Identitätstheorie und der Literaturwissenschaft zurück, um die Prozesse der Identitätsentwicklung in einem außergewöhnlichen Kontext zu untersuchen.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Marlen Haushofers Roman „Die Wand“?
Der Roman beschreibt das Leben einer Frau, die durch eine unsichtbare Wand plötzlich von der Außenwelt isoliert wird und allein in der Natur überleben muss.
Führt soziale Isolation zur Auflösung der Identität?
Die Arbeit untersucht, wie die Protagonistin ohne menschliche Kommunikation ihr altes Ich verliert, aber gleichzeitig eine neue Identität in Harmonie mit der Natur entwickelt.
Welche Funktion hat das Schreiben für die Ich-Erzählerin?
Das Schreiben dient als Mittel der Selbstvergewisserung und hilft der Protagonistin, ihr Bewusstsein für die eigene Existenz in der Isolation aufrechtzuerhalten.
Was bedeutet die Jagdhütte im Kontext von Natur und Kultur?
Die Jagdhütte fungiert als Brücke zwischen der alten kulturellen Welt und der neuen, wilden Natur, in der die Protagonistin neue Überlebensstrategien findet.
Welches Raummodell wird zur Analyse herangezogen?
Die Arbeit nutzt Lotmans strukturalistisch-semiotisches Raummodell, um die Grenze zwischen dem „Innen“ (hinter der Wand) und dem „Außen“ zu analysieren.
- Citar trabajo
- Sophie Hohmann (Autor), 2019, Identität zwischen Kultur und Natur. Marlen Haushofers "Die Wand" als Endzeitexperiment, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/538138