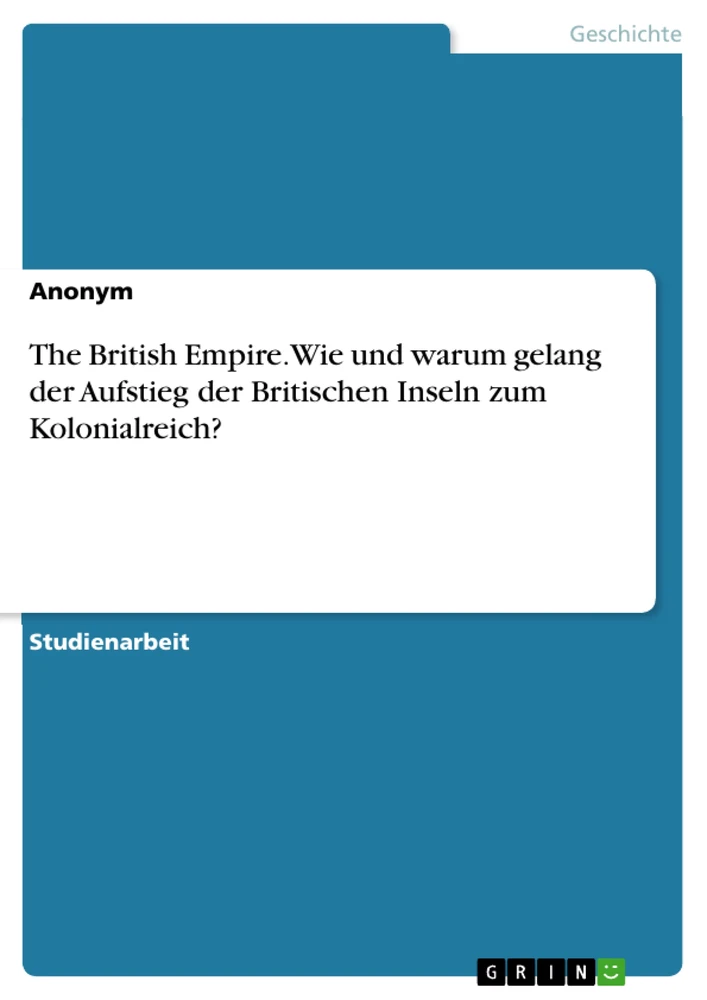Im Rahmen dieser Hausarbeit soll anhand von Beispielen die wesentlichen Schritte und Entwicklungen von einer eher auf sich selbst fixierten Inselmacht bis hin zum klassischen Empire aufgezeigt und untersucht werden. Besonderes Augenmerk soll auf der frühen Entwicklungsphase liegen, also der Zeit, in der Britannien quasi aus der zweiten Reihe heraus an den anderen europäischen Kolonialmächten vorbeizog. Bei der Betrachtung sollen drei Gebiete in den Mittelpunkt rücken, die als Beispiele für die verschiedenen Vorgehensweisen der Briten bei der Kolonisation untersucht werden.
Nach der Einleitung wird ein knappes Bild der britischen Inseln im späten Mittelalter gegeben, um ein Verständnis der Ausgangssituation herzustellen. Dabei sollen vor allem die britischen Interessen und Gegebenheiten zu dieser Zeit, aber auch die Expansionsbestrebungen anderer europäischer Mächte kurz dargestellt werden. Nach der weiteren Hinführung zum Thema wird an drei Beispielen gezeigt, wie sich die Briten auf dem jeweiligen Schauplatz durchgesetzt haben. Als Beispiel werden Nordamerika, die Westindischen Inseln in der Karibik und schließlich Indien gewählt. Auch in diesem Teil wird nicht auf jedes Detail der viele Jahrhunderte umspannenden Geschichte eingegangen. Vielmehr ist die Untersuchung auf den Beginn der Kolonien beschränkt. In diesem Abschnitt soll auch die Frage nach dem Warum beantwortet werden, also die Motivation, dort eine Kolonie zu gründen oder sich besonders zu engagieren.
Nach der Vorstellung der britischen Expansion in Nordamerika, der Karibik und Indien werden im Fazit schließlich noch einmal Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet. Hier soll auch die Frage beantwortet werden, welches die Erfolgsfaktoren für die Briten in dem jeweiligen Gebiet waren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Britannien im späten Mittelalter
- Das ältere Empire - Beginn der Kolonisierung
- Karibik
- Nordamerika
- Indien
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Entwicklung des britischen Inselreiches von einer regionalen Macht zu einem weltumspannenden Kolonialreich. Der Fokus liegt auf der frühen Phase der Expansion, wobei exemplarisch die Kolonisierung von Nordamerika, der Karibik und Indien betrachtet wird. Die Arbeit beleuchtet die Strategien der Briten, ihre Motive und die Faktoren, die zu ihrem Erfolg beitrugen.
- Die Entwicklung Englands im späten Mittelalter und die Voraussetzungen für seine spätere Kolonialisierung.
- Die britischen Kolonialisierungsstrategien in Nordamerika, der Karibik und Indien.
- Die wirtschaftlichen und politischen Motive hinter der britischen Expansion.
- Vergleich der britischen Vorgehensweisen in den verschiedenen Kolonien.
- Analyse der Erfolgsfaktoren des britischen Kolonialunternehmens.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit, welche die Entwicklung des Britischen Empire von seinen Anfängen bis zum Status eines Kolonialreiches beleuchtet. Der Schwerpunkt liegt auf der frühen Phase und untersucht exemplarisch die Kolonisierung von Nordamerika, der Karibik und Indien. Die Arbeit konzentriert sich auf die Strategien, Motive und Erfolgsfaktoren der britischen Kolonialpolitik.
Britannien im späten Mittelalter: Dieses Kapitel skizziert die Lage der britischen Inseln im späten Mittelalter. Es beschreibt die Fokussierung Englands auf Frankreich und die relative Nachrangigkeit transatlantischer Bestrebungen. Die wirtschaftliche Abhängigkeit von der Wollproduktion und der eingeschränkte Seehandel werden hervorgehoben. Die gescheiterten Expeditionen von John Cabot verdeutlichen die anfängliche Zurückhaltung bei der Überseeexpansion. Die zunehmende Konkurrenz auf dem europäischen Tuchmarkt und die Spannungen mit Spanien/Portugal schufen wirtschaftliche und politische Herausforderungen, die letztlich die Suche nach neuen Investitionsmöglichkeiten und Handelsrouten antrieben.
Das ältere Empire - Beginn der Kolonisierung: Dieses Kapitel untersucht die ersten Schritte der britischen Kolonisierung, wobei die Beispiele Nordamerika, Karibik und Indien im Detail behandelt werden (obwohl die Zusammenfassung des Originals nur die Einleitung dieses Kapitels enthält und keine weiteren Informationen zu den einzelnen Regionen bietet). Die hohen Risiken privat finanzierter Expeditionen werden erwähnt, ebenso wie der Anreiz durch potenzielle Gewinne. Die Erwähnung von Sir Hugh Willoughbys Expeditionen dient als einleitender Punkt in die Kolonialgeschichte.
Schlüsselwörter
Britisches Empire, Kolonialismus, Imperialismus, Expansion, Nordamerika, Karibik, Indien, Mittelalter, Wirtschaft, Handel, Wollproduktion, Seewege, Kolonialstrategien, Erfolgsfaktoren.
Häufig gestellte Fragen: Entwicklung des Britischen Imperiums
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Entwicklung des britischen Inselreiches von einer regionalen Macht zu einem weltumspannenden Kolonialreich. Der Fokus liegt auf der frühen Phase der Expansion, insbesondere der Kolonisierung von Nordamerika, der Karibik und Indien. Analysiert werden die Strategien der Briten, ihre Motive und die Faktoren, die zu ihrem Erfolg beitrugen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung Englands im späten Mittelalter und die Voraussetzungen für seine spätere Kolonialisierung. Sie analysiert die britischen Kolonialisierungsstrategien in Nordamerika, der Karibik und Indien, untersucht die wirtschaftlichen und politischen Motive hinter der britischen Expansion, vergleicht die britischen Vorgehensweisen in den verschiedenen Kolonien und analysiert schließlich die Erfolgsfaktoren des britischen Kolonialunternehmens.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über Britannien im späten Mittelalter, ein Kapitel über den Beginn der Kolonisierung (mit Fokus auf Nordamerika, Karibik und Indien) und ein Fazit.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit und den Schwerpunkt auf die frühe Phase der britischen Kolonialexpansion, insbesondere die Kolonisierung von Nordamerika, der Karibik und Indien. Sie benennt die zu untersuchenden Strategien, Motive und Erfolgsfaktoren der britischen Kolonialpolitik.
Worauf konzentriert sich das Kapitel über Britannien im späten Mittelalter?
Dieses Kapitel skizziert die Lage der britischen Inseln im späten Mittelalter. Es beschreibt die Fokussierung Englands auf Frankreich, die relative Nachrangigkeit transatlantischer Bestrebungen, die wirtschaftliche Abhängigkeit von der Wollproduktion, den eingeschränkten Seehandel und die gescheiterten Expeditionen von John Cabot. Es hebt die zunehmende Konkurrenz auf dem europäischen Tuchmarkt und die Spannungen mit Spanien/Portugal hervor, die letztlich die Suche nach neuen Investitionsmöglichkeiten und Handelsrouten antrieben.
Was ist der Inhalt des Kapitels über den Beginn der Kolonisierung?
Dieses Kapitel untersucht die ersten Schritte der britischen Kolonisierung, mit detaillierter Betrachtung von Nordamerika, der Karibik und Indien (obwohl die Zusammenfassung nur die Einleitung dieses Kapitels enthält). Es erwähnt die hohen Risiken privat finanzierter Expeditionen und den Anreiz durch potenzielle Gewinne. Die Erwähnung von Sir Hugh Willoughbys Expeditionen dient als einleitender Punkt in die Kolonialgeschichte.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Britisches Empire, Kolonialismus, Imperialismus, Expansion, Nordamerika, Karibik, Indien, Mittelalter, Wirtschaft, Handel, Wollproduktion, Seewege, Kolonialstrategien, Erfolgsfaktoren.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2009, The British Empire. Wie und warum gelang der Aufstieg der Britischen Inseln zum Kolonialreich?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/538207