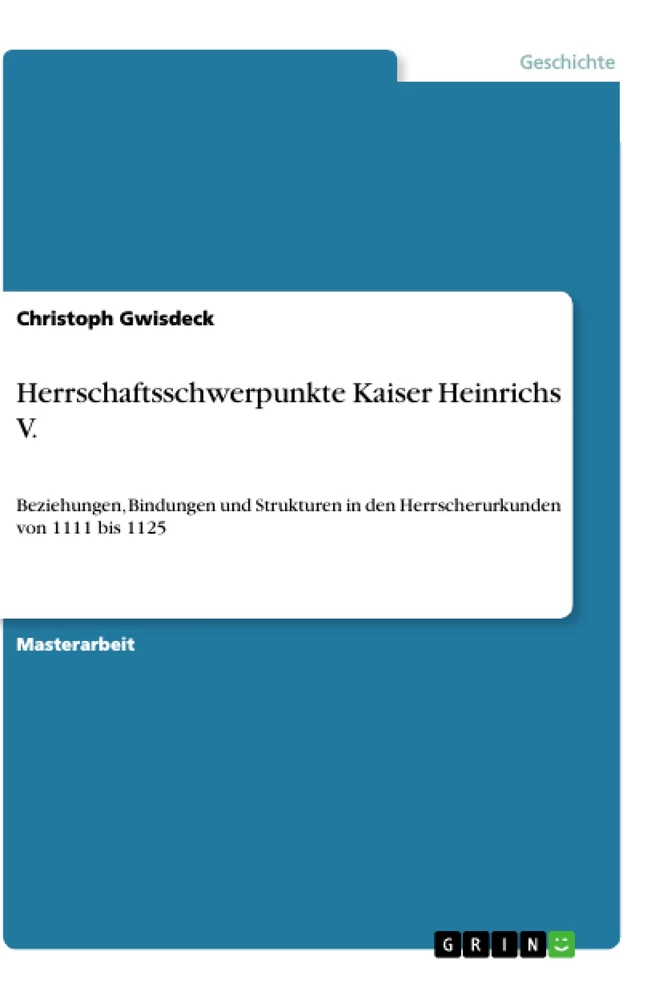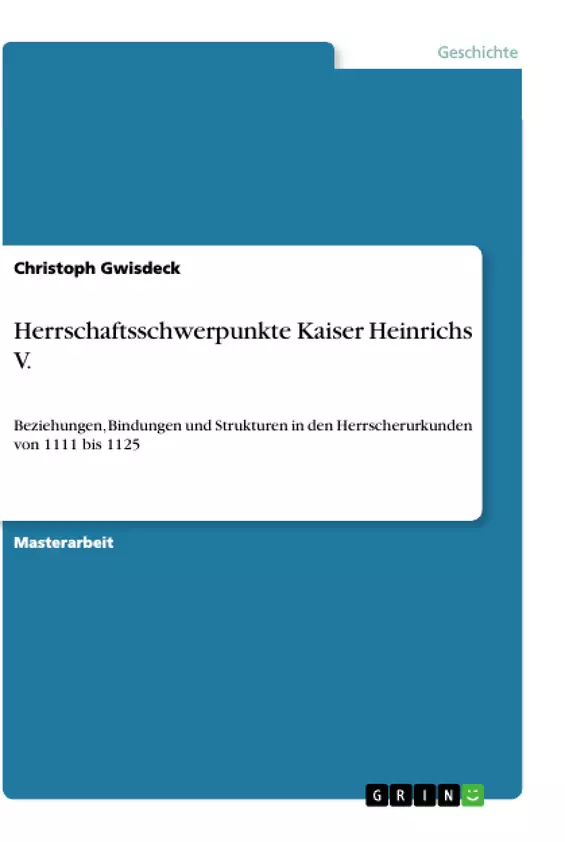Anhand des vorgestellten Korpus werden folgende Thesen untersucht: Der von Heinrich angestrebte und zur Herrschaft benötigte Konsens mit den Großen des Reiches konnte von ebenjenem auf Dauer nicht erreicht werden. Sein autokratischer werdendes Verhalten gegenüber den Fürsten und seine Haltung im Investiturstreit resultierten in einige Konflikte, die die Beziehungen belasteten und zu Brüchen führten.
Als Folge aus der Entfremdung von Heinrich und den Fürsten sowie dem Zusammenschluss ebenjener Fürsten um des Friedens willen, stellte das Wormser Konkordat einen Vertrag dar, dem Heinrich sich nicht mehr entziehen konnte. Dieser Wandel der Bindungen wird mittels der Intervenienten- und Zeugenlisten sichtbar: Brüche belegen ein Abwenden vom König, Kontinuitäten die Königsnähe und –treue. Daraus wird vor allem erkennbar, dass Heinrichs Unterstützer, die ihn bereits zum Königtum verhalfen und ihn bei seiner Kaiserkrönung begleiteten, bis zum Tode größtenteils treu an seiner Seite verblieben.
Im ersten Schritt stehen die Urkundensprache und -struktur im Fokus, also das Erkennen von Interventions- und Zeugenlisten sowie ihre Platzierung innerhalb einer Urkunde. Im gleichen Kapitel wird die Entwicklung dieser Listen von vereinzelten Nennungen von Großen innerhalb der Diplomata bis hin zur signifikanten Bedeutungs- und Quantitätssteigerung nachgezeichnet und mit der Methodik der vorherigen Herrscher verglichen.
Der Hauptteil der Arbeit befasst sich mit den Unterstützern und Förderern sowie den Gegnern Heinrichs. Der Zeitraum 1111 bis 1125 wurde dafür bewusst gewählt: Für diesen Zeitraum ist mir bisher keine zusammenhängende systematische Auswertung von Intervenienten- und Zeugenlisten, sowie von Ausstellungsorten und Empfängern in den Diplomata Heinrichs bekannt. Die Zeit vor Heinrichs Kaiserkrönung inklusive einer systematischen Auswertung der Personen in seiner sozialen Nähe wurde von Stefan Weinfurter bereits vorgestellt.
Darüber hinaus lieferte Jürgen Dendorfer bereits einige Analysen hinsichtlich der Fürsten am königlichen Hof zum Ende der Salierzeit und speziell zu den Staufern. Gerold Meyer von Knonau betrachtet in seinen Jahrbüchern detailliert die Herrschaft Heinrichs, gibt aber nur stellenweise Einblick in die Diplomata und ist aufgrund der Veröffentlichungsjahre an manchen Stellen überholt. Mittels weiterer Schwerpunkte und einer genaueren Betrachtung der Diplomata setze ich mich von diesen Arbeiten ab.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Entwicklung und Bedeutung der Intervenienten- und Zeugenlisten
- Unterstützer und Entwicklungen vor 1111
- Periode I
- Die Diplomata des ersten Italienzuges
- Die Diplomata nach der Italienrückkehr
- Der Bruch mit Erzbischof Friedrich von Köln
- Der Bruch mit Bruno von Speyer?
- Die Stellung des Bischofs Otto von Bamberg
- Die engsten Vertrauten Heinrichs
- Periode II
- Die Diplomata des zweiten Italienzuges
- Bischof Hartwig von Regensburg – Kampf um Unterstützung
- Periode III
- Periode IV
- Die Diplomata von 1122 bis 1125
- Das Wormser Konkordat – Rückkehr zum allgemeinen Konsens?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Beziehungen, Bindungen und Strukturen zwischen Kaiser Heinrich V. und seinen Großen in den Jahren 1111 bis 1125. Im Fokus stehen die Intervenienten- und Zeugenlisten in den Diplomata Heinrichs, die Aufschluss über das politische Gefüge und die Dynamik der Beziehungen zwischen dem Herrscher und seinen Fürsten geben.
- Die Entwicklung der Intervenienten- und Zeugenlisten in den Diplomata Heinrichs V.
- Die Rolle der Großen des Reiches in Heinrichs V. Herrschaft und deren Einfluss auf die politische Entwicklung.
- Die Ursachen für Brüche und Kontinuitäten in den Beziehungen zwischen Heinrich V. und seinen Fürsten im Kontext des Investiturstreits.
- Die Bedeutung des Wormser Konkordats für die Gestaltung des Verhältnisses zwischen König und Fürsten.
- Die Analyse der Diplomata Heinrichs V. mittels Periodisierung als Methode zur Erforschung der Veränderungen im Herrschaftsgefüge.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung befasst sich mit den Herausforderungen, denen Heinrich V. bei seinem Regierungsantritt gegenüberstand, und stellt den Fokus der Arbeit auf die Beziehungen zwischen dem Kaiser und seinen Großen dar. Kapitel 2 untersucht die Entwicklung und Bedeutung der Intervenienten- und Zeugenlisten in den Diplomata Heinrichs. Kapitel 3 beleuchtet die Unterstützer und Entwicklungen vor 1111. Die Kapitel 4-7 analysieren die Diplomata in vier Perioden und untersuchen die Beziehungen zwischen Heinrich V. und seinen Großen in diesen Zeitabschnitten. Kapitel 4 widmet sich der ersten Periode, die von Februar 1111 bis Februar 1116 reicht und die Ereignisse des ersten Italienzugs Heinrichs sowie die Verhandlungen mit dem Papst umfasst. Kapitel 5 befasst sich mit der zweiten Periode, die von Februar 1116 bis Mai 1122 reicht und die zweite Italienreise Heinrichs beinhaltet. Kapitel 6 behandelt die Periode von Mai 1122 bis März 1124, und Kapitel 7 die Periode von März 1124 bis Mai 1125, in der das Wormser Konkordat geschlossen wird.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Intervenienten- und Zeugenlisten in den Diplomata Heinrichs V., um die Beziehungen zwischen dem Kaiser und seinen Großen zu beleuchten. Schlüsselwörter sind daher Diplomata, Intervenientenlisten, Zeugenlisten, Heinrich V., Investiturstreit, Wormser Konkordat, Fürsten, Beziehungen, Bindungen, Strukturen, Herrschaftsform, Konsens, Brüche, Kontinuitäten.
Häufig gestellte Fragen
Was verraten Intervenienten- und Zeugenlisten über Heinrich V.?
Diese Listen in den Urkunden belegen Brüche und Kontinuitäten in den Beziehungen zu den Fürsten und zeigen, wer dem Kaiser treu blieb oder sich abwandte.
Warum scheiterte der Konsens zwischen Heinrich V. und den Großen?
Sein zunehmend autokratisches Verhalten und die Haltung im Investiturstreit führten zu einer Entfremdung von den Reichsfürsten.
Was war die Bedeutung des Wormser Konkordats von 1122?
Es markiert einen Wandel, bei dem Heinrich V. durch den Zusammenschluss der Fürsten zu einem Vertrag gezwungen wurde, der den Investiturstreit beilegte.
Wer waren die engsten Vertrauten des Kaisers?
Die Arbeit analysiert Diplomata, um Unterstützer wie Bischof Otto von Bamberg und deren Rolle im Herrschaftsgefüge zwischen 1111 und 1125 zu identifizieren.
Wie veränderte sich die Urkundensprache unter Heinrich V.?
Es gab eine signifikante Bedeutungs- und Quantitätssteigerung der Zeugennennungen, was den wachsenden Einfluss der Fürsten am königlichen Hof widerspiegelt.
- Quote paper
- Christoph Gwisdeck (Author), 2015, Herrschaftsschwerpunkte Kaiser Heinrichs V., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/538749