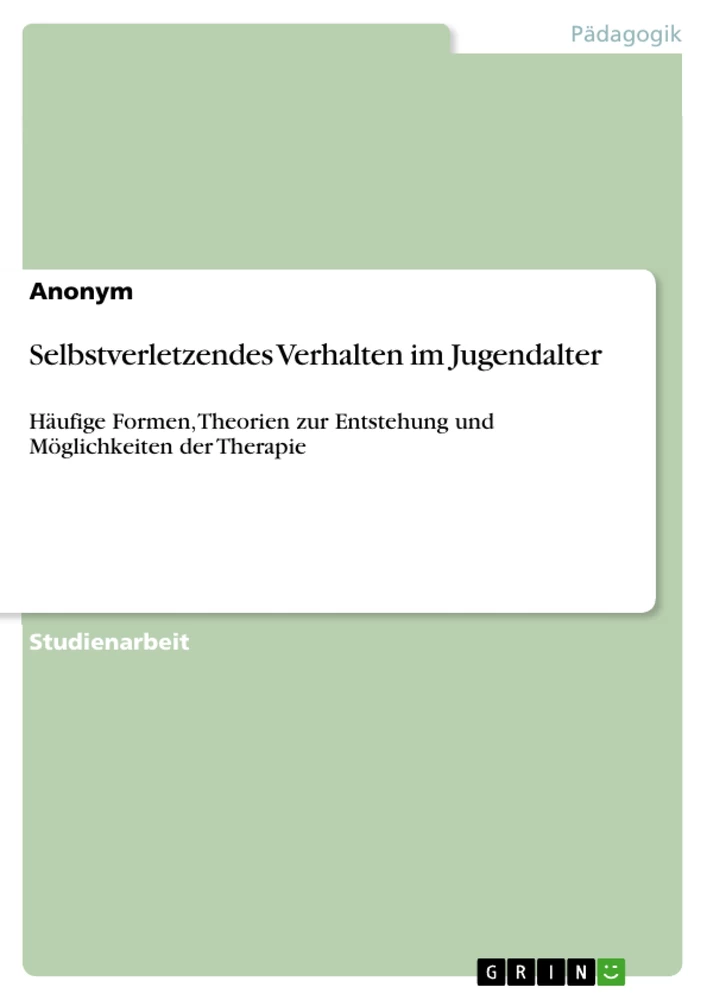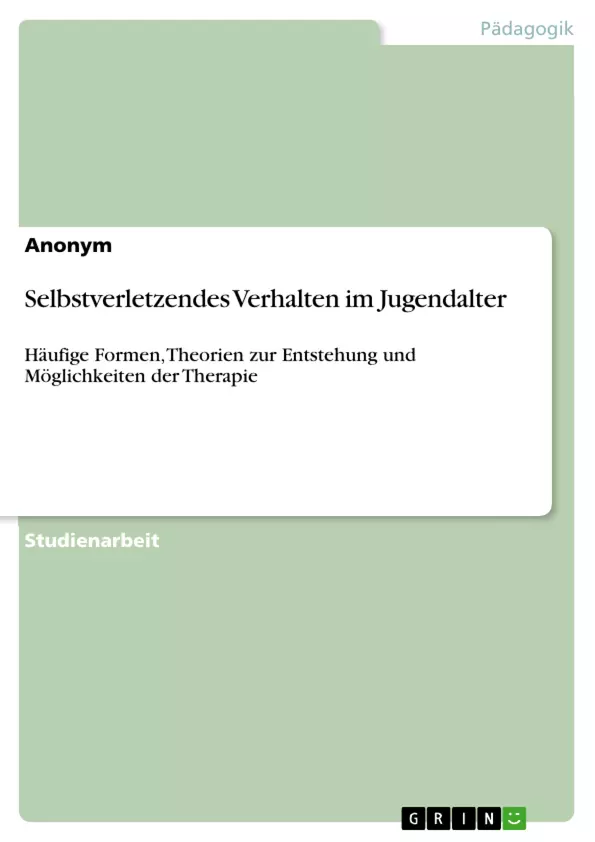Selbstverletzendes Verhalten ist schon lange nichts Seltenes mehr. Zwar lässt sich die Zahl derer, die sich selbst absichtlich verletzen, nur schwer bestimmen, doch die Tendenz ist steigend. Obwohl die Dunkelziffer sehr hoch ist, lässt sich doch sagen, dass die meisten Menschen, die dieses Verhalten an den Tag legen, Jugendliche oder junge Erwachsene sind, die oft im Laufe ihrer Adoleszenz beginnen, ihren Körper z.B. durch Schnitte zu malträtieren (Teuber 2008). Da dies eine entscheidende Phase im Leben vieler junger Menschen ist, möchte ich mich im Zuge dieser Hausarbeit näher mit dem Phänomen der Selbstverletzung auseinandersetzen.
In dieser Arbeit soll eine Definition zunächst klären, um was es sich bei dem Begriff „Selbstverletzendes Verhalten“ handelt. Im Anschluss daran sollen häufige Formen und Methoden dieser Handlungsform genannt und erläutert werden, gefolgt von einigen Theorien zur Entstehung. Zum Schluss sollen noch mehrere Möglichkeiten und Ansätze zur Therapie dieser Jugendlichen angeführt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition
- 3. Häufige Formen und Methoden
- 4. Theorien zur Entstehung
- 4.1. Erklärungsansätze
- 4.1.1. Neurobiologie
- 4.1.2. Borderline-Persönlichkeitsstörung
- 4.1.3. Depression und andere Störungen
- 4.1.4. Erlebnisse der Gegenwart und der Kindheit
- 4.1.5. Sonstige Erklärungsansätze
- 4.2. Funktionen der Selbstverletzung
- 4.1. Erklärungsansätze
- 5. Möglichkeiten der Therapie
- 5.1. Psychotherapie
- 5.2. Medikamentöse Therapie
- 5.3. Jugendhilfe und Sozialarbeit
- 6. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, das Phänomen selbstverletzenden Verhaltens im Jugendalter zu beleuchten. Es werden Definition, häufige Formen, Entstehungstheorien und Therapieansätze vorgestellt. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der komplexen Ursachen und der Möglichkeiten der Intervention.
- Definition und Abgrenzung selbstverletzenden Verhaltens
- Häufige Formen und Methoden der Selbstverletzung bei Jugendlichen
- Neurobiologische und psychosoziale Erklärungsansätze für selbstverletzendes Verhalten
- Die Rolle von psychischen Störungen wie Depression und Borderline-Persönlichkeitsstörung
- Möglichkeiten der therapeutischen Intervention und Unterstützung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik selbstverletzenden Verhaltens bei Jugendlichen ein und verdeutlicht die Relevanz des Themas anhand eines persönlichen Erfahrungsberichtes. Sie umreißt den Aufbau der Arbeit und kündigt die zentralen Abschnitte an, die sich mit Definition, Formen, Theorien und Therapieansätzen befassen. Die steigende Tendenz selbstverletzenden Verhaltens bei Jugendlichen wird hervorgehoben, wobei die Dunkelziffer betont wird. Der Fokus liegt auf der Adoleszenz als einer entscheidenden Phase, in der dieses Verhalten oft beginnt.
2. Definition: Dieses Kapitel widmet sich der Definition von selbstverletzendem Verhalten. Es wird die Schwierigkeit der Abgrenzung zu suizidalem Verhalten thematisiert und verschiedene wissenschaftliche Perspektiven darauf beleuchtet. Die Arbeit hebt die Debatte um die Rolle der Intention hervor und präsentiert eine Definition, die den Konsens der neueren Forschung widerspiegelt: Selbstverletzendes Verhalten wird als eine funktionell motivierte, direkte und offene Verletzung des eigenen Körpers definiert, die nicht sozial akzeptiert ist und ohne Suizidabsicht vorgenommen wird. Es werden Beispiele für sowohl direkte als auch indirekte Formen der Selbstverletzung genannt.
3. Häufige Formen und Methoden: Das Kapitel beschreibt häufige Formen und Methoden selbstverletzenden Verhaltens bei Jugendlichen. Es unterscheidet zwischen leichten und schweren Formen und geht auf verschiedene Kategorien ein, wie z.B. direkte und indirekte Selbstverletzung. Direkte Formen wie Schneiden, Verbrennen oder Schlagen werden detailliert erläutert, ebenso wie indirekte Formen wie Essstörungen oder Drogenmissbrauch. Die Wahl der Körperregionen für Selbstverletzungen wird im Kontext von Verbergungsmöglichkeiten diskutiert, ebenso wie die Variabilität der Methoden im Laufe der Zeit und die unterschiedlichen Arten der Präsentation der Verletzungen. Die häufigste Methode, das Ritzen, wird hervorgehoben, wobei die Kreativität der Jugendlichen bei der Wahl der Methoden betont wird.
4. Theorien zur Entstehung: Dieses Kapitel befasst sich mit Theorien zur Entstehung selbstverletzenden Verhaltens. Es wird betont, dass es sich um Theorien und nicht um gesicherte Tatsachen handelt. Der neurobiologische Aspekt wird diskutiert, wobei die Rolle von Endorphinen und der Möglichkeit eines suchtartigen Verhaltens hervorgehoben wird. Obwohl ein genetischer Faktor nicht empirisch belegt ist, werden mögliche Einflüsse des Stoffwechsels angesprochen. Das Kapitel deutet auf weitere Erklärungsansätze hin, die in den Unterkapiteln detaillierter behandelt werden (z.B. Borderline-Persönlichkeitsstörung, Depression, Kindheitserlebnisse).
Schlüsselwörter
Selbstverletzendes Verhalten, Jugendalter, Selbstschädigung, Suizidalität, Adoleszenz, Neurobiologie, Endorphine, Psychische Störungen, Depression, Borderline-Persönlichkeitsstörung, Therapie, Psychotherapie, Medikamentöse Therapie, Jugendhilfe.
Häufig gestellte Fragen zu Selbstverletzendem Verhalten bei Jugendlichen
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Dieser Text bietet einen umfassenden Überblick über selbstverletzendes Verhalten im Jugendalter. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Stichwortverzeichnis. Die behandelten Themen umfassen Definition und Abgrenzung von selbstverletzendem Verhalten, häufige Formen und Methoden, neurobiologische und psychosoziale Erklärungsansätze, die Rolle von psychischen Störungen (wie Depression und Borderline-Persönlichkeitsstörung) und schließlich Möglichkeiten therapeutischer Interventionen.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text ist in Kapitel unterteilt, die sich mit der Einleitung, Definition, Formen und Methoden, Entstehungstheorien und Therapieansätzen befassen. Jedes Kapitel wird kurz zusammengefasst. Innerhalb der Kapitel zu Entstehungstheorien wird detailliert auf neurobiologische Aspekte, die Rolle von psychischen Störungen und Kindheitserlebnisse eingegangen.
Was wird unter selbstverletzendem Verhalten verstanden?
Der Text definiert selbstverletzendes Verhalten als eine funktionell motivierte, direkte und offene Verletzung des eigenen Körpers, die nicht sozial akzeptiert ist und ohne Suizidabsicht vorgenommen wird. Es wird zwischen direkten (z.B. Schneiden, Verbrennen) und indirekten (z.B. Essstörungen, Drogenmissbrauch) Formen unterschieden.
Welche Formen und Methoden der Selbstverletzung werden beschrieben?
Der Text beschreibt verschiedene Formen und Methoden, darunter direkte Selbstverletzungen wie Schneiden, Verbrennen oder Schlagen, und indirekte Formen wie Essstörungen oder Drogenmissbrauch. Es wird die Variabilität der Methoden und die Wahl der Körperregionen im Hinblick auf Verbergungsmöglichkeiten diskutiert.
Welche Theorien zur Entstehung von selbstverletzendem Verhalten werden behandelt?
Der Text beleuchtet verschiedene Theorien, darunter neurobiologische Aspekte (Rolle von Endorphinen, suchtartiges Verhalten), den Einfluss psychischer Störungen wie Depression und Borderline-Persönlichkeitsstörung, und die Bedeutung von Kindheitserfahrungen. Es wird betont, dass es sich um Theorien und nicht um gesicherte Tatsachen handelt.
Welche Therapieansätze werden vorgestellt?
Der Text erwähnt verschiedene Therapieansätze, darunter Psychotherapie, medikamentöse Therapie und Unterstützung durch Jugendhilfe und Sozialarbeit.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Selbstverletzendes Verhalten, Jugendalter, Selbstschädigung, Suizidalität, Adoleszenz, Neurobiologie, Endorphine, Psychische Störungen, Depression, Borderline-Persönlichkeitsstörung, Therapie, Psychotherapie, Medikamentöse Therapie, Jugendhilfe.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Dieser Text richtet sich an ein akademisches Publikum und dient der Analyse von selbstverletzendem Verhalten bei Jugendlichen. Die Informationen sind für wissenschaftliche Zwecke und die Erforschung des Themas bestimmt.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2013, Selbstverletzendes Verhalten im Jugendalter, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/538760