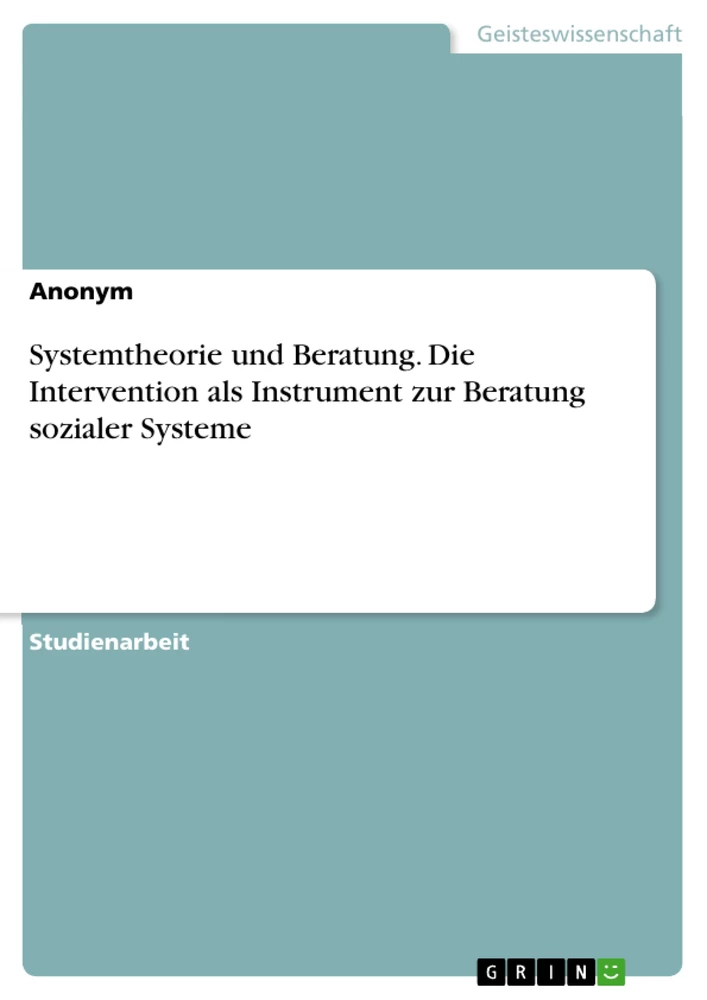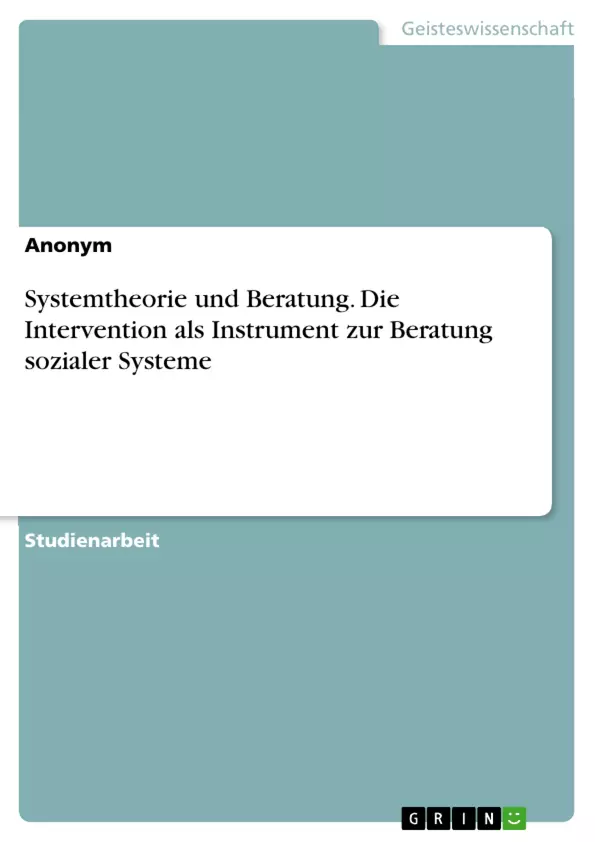Woher kommt die Systemtheorie und was sind ihre Ursprünge? Welchen Stellenwert hat die systemische Intervention bei der Beratung sozialer Systeme - und was sind überhaupt "Intervention" und "soziale Systeme"? In der folgenden Arbeit sollen Antworten auf diese Fragen gefunden und damit eine kurze Einführung in das Thema der systemtheoretischen Beratung und der Intervention gegeben werden. Zuerst soll der Ursprung der systemischen Perspektive aufgezeigt werden. Hier werden die allgemeine, die soziologische und die personale Systemtheorie vorgestellt. Im weiteren Verlauf, soll dann genauer auf die Intervention eingegangen werden. Es soll geklärt werden, was Intervention überhaupt ist, welche Systeme daran beteiligt sind und welche Ebenen und Dimensionen hierbei wichtig sind. Zum Abschluss sollen schließlich noch die Potenziale und Grenzen der systemischen Intervention angesprochen werden.
Die systemische Beratung scheint in den letzten Jahrzehnten einen immer stärkeren Aufschwung zu erleben. Sie bietet eine neue Sichtweise auf die Welt, in welcher Probleme nicht nur eine Ursache haben, sondern durch das Zusammenwirken verschiedener Faktoren in einem komplexen System entstehen. Im Gegensatz zum Eigenschaftsmodell, Verhaltensmodell oder dem Handlungsmodell betrachtet sie nicht nur den Einzelnen, sondern auch das dazugehörige Umfeld oder die Kommunikation als ein System.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Systemtheorie
- Ursprünge der Systemtheorie
- Allgemeine Systemtheorie
- Evolutionistische Systemtheorie
- Soziologische Systemtheorie
- Personale Systemtheorie
- Intervention
- Definition
- Die beteiligten Systeme
- Das Klientensystem
- Das Beratersystem
- Das Beratungssystem
- Die beteiligten Systeme als soziale Systeme
- Ebenen und Dimensionen der Intervention
- Fazit: Potenziale und Grenzen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der systemischen Beratung und ihrer Anwendung in sozialen Systemen. Sie untersucht die Ursprünge der Systemtheorie, erklärt das Konzept der Intervention und beleuchtet die Potenziale und Grenzen der systemischen Intervention.
- Ursprünge der Systemtheorie
- Die Rolle der Intervention in der Beratung
- Ebenen und Dimensionen der Intervention
- Potenziale der systemischen Intervention
- Grenzen der systemischen Intervention
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die systemische Beratung vor und beleuchtet ihre wachsende Bedeutung in den letzten Jahrzehnten. Sie führt die Grundprinzipien der systemischen Perspektive ein und stellt zentrale Fragen zur Herkunft der Systemtheorie und zum Stellenwert der Intervention in der Beratung.
Systemtheorie
Dieses Kapitel behandelt die Ursprünge der Systemtheorie, beginnend mit der allgemeinen Systemtheorie, die aus den 1940er und 1950er Jahren stammt. Es geht auf die Evolutionistische Systemtheorie ein, die sich auf biologische Systeme konzentriert. Schließlich wird die soziologische Systemtheorie vorgestellt, die sich mit sozialen Prozessen und der Differenz von System und Umwelt befasst.
Intervention
Dieses Kapitel beleuchtet die Definition des Begriffs "Intervention" und erläutert die beteiligten Systeme. Es geht auf das Klientensystem, das Beratersystem und das Beratungssystem ein und untersucht die Rolle der Systeme als soziale Systeme. Schließlich werden die Ebenen und Dimensionen der Intervention im Detail dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Systemtheorie, systemische Beratung, Intervention, soziale Systeme, Klientensystem, Beratersystem, Beratungssystem, Ebenen der Intervention, Dimensionen der Intervention, Potenziale der systemischen Intervention, Grenzen der systemischen Intervention.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Systemtheorie und Beratung. Die Intervention als Instrument zur Beratung sozialer Systeme, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/538764