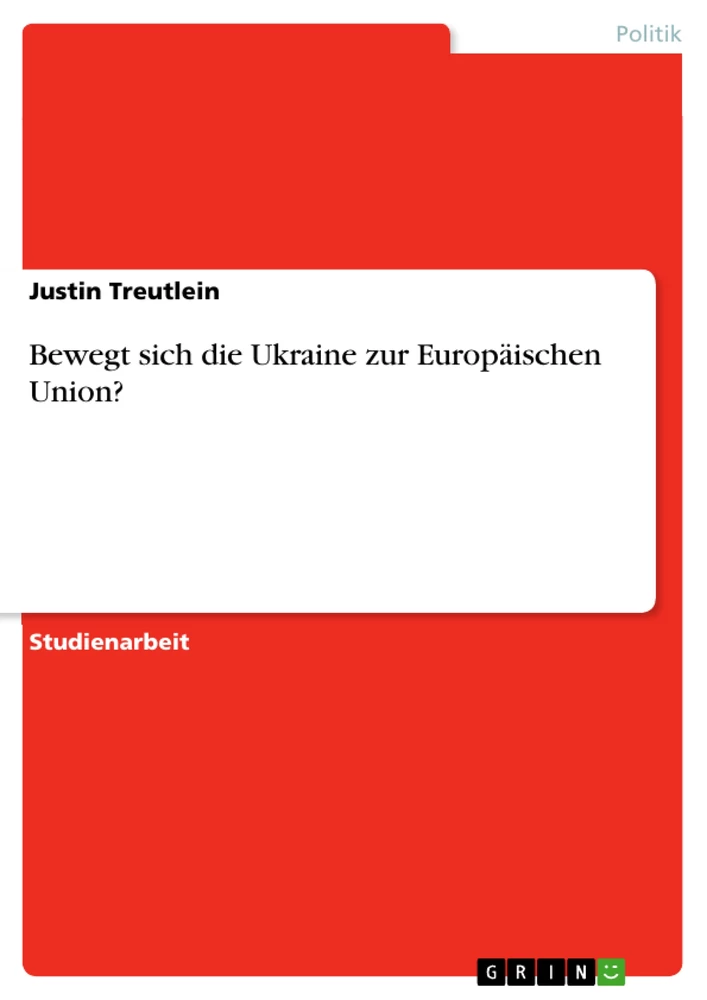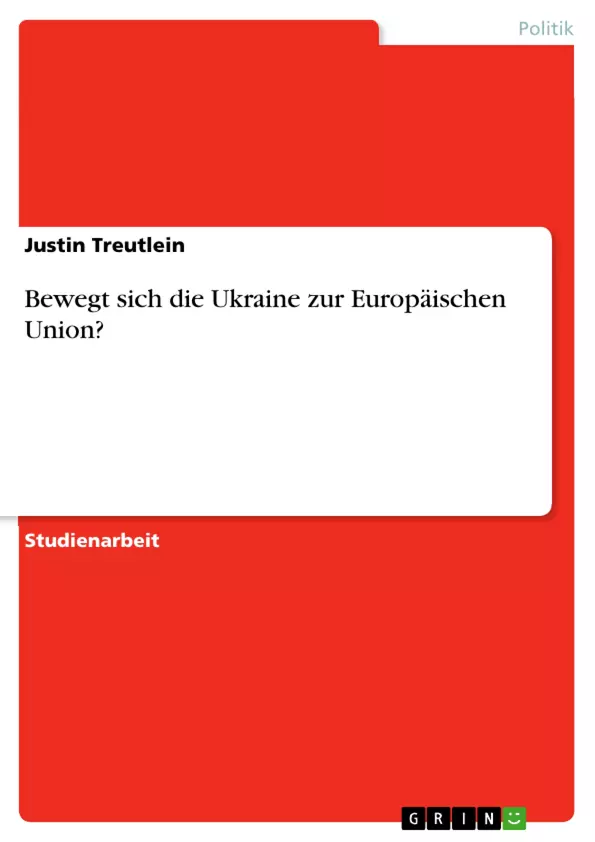Wird die Ukraine auf absehbare Zeit ein Mitgliedstaat der Europäischen Union werden können? Mit Hilfe der Europäisierungstheorie werden die Kooperationsmaßnahmen analysiert. Welche Auswirkungen hat diese Zusammenarbeit auf die EU-Ebene sowie auf die erforderlichen Anpassungsmaßnahmen von Seiten der Ukraine? Diese Arbeit ist für alle interessant, die sich mit den Beziehungen zwischen der EU und der Ukraine zwischen 1991 und März 2019 auseinandersetzen möchten.
Einleitung:
Das Jahr 2019 ist für die Europäische Union (EU) und die Ukraine von hoher politischer Wichtigkeit: Bei der Wahl des Europäischen Parlaments sowie der Präsidentschaftswahl in der Ukraine werden wichtige Weichen für die zukünftigen gegenseitigen Beziehungen gestellt. In dieser Arbeit wird das Verhältnis zwischen der EU und der Ukraine genauer analysiert: Es wird der Frage nachgegangen, ob und wenn ja, inwiefern sich die Ukraine in Richtung EU bewegt. Zu Beginn wird der Begriff Europäisierung als Teil der Theorie genauer untersucht. Hierbei werden Definitions- sowie Abgrenzungsversuche unternommen. Es folgen gegenwärtige Europäisierungsdimensionen, die im anschließenden Empirieteil mit Hilfe einer qualitativen Analyse auf die vergangenen und gegenwärtigen Beziehungen zwischen der EU und der Ukraine seit 1991 angewendet werden. Der Schluss beinhaltet die Beantwortung der Forschungsfrage und gibt einen groben Ausblick, welche Chancen und Perspektiven sich mit einem EU-Beitritt für die Ukraine und die EU ergeben.
Berücksichtigt werden die Sichtweise der Ukraine sowie die der EU. Auffassungen Dritter, insbesondere der Russischen Föderation (Russland), bleiben weitgehend unberücksichtigt. Stichtag ist der 30. März 2019. Danach stattfindende tagesaktuelle Geschehnisse werden nicht mehr erfasst.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1 Theorie: Europäisierung
- 2.1.1 Definition
- 2.1.2 Politische Dimensionen
- 2.2 Empirie: qualitative Analyse der Europäisierungsdimensionen
- 2.2.1 Modernisierungsprozesse durch Kooperationsmaßnahmen
- 2.2.2 Politikentwicklung auf EU-Ebene
- 2.2.3 Anpassungen der nationalen Ebene durch Fokussierung auf nationale Politikfelder
- 2.2.4 Erkenntnisse aus den politischen Entwicklungen
- 2.2.5 Erkenntnisse der Europäisierungsdimensionen aus der Empirie
- 2.1 Theorie: Europäisierung
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Verhältnis zwischen der Europäischen Union (EU) und der Ukraine und analysiert, ob und inwiefern sich die Ukraine in Richtung EU bewegt. Dazu wird der Begriff der Europäisierung genauer beleuchtet, seine Definitionen und Abgrenzungen untersucht, sowie gegenwärtige Europäisierungsdimensionen im Hinblick auf die Beziehungen zwischen der EU und der Ukraine seit 1991 qualitativ analysiert.
- Die Europäisierung als Konzept und ihre verschiedenen Definitionen.
- Die politischen Dimensionen der Europäisierung, insbesondere im Hinblick auf Modernisierungsprozesse, Politikentwicklung auf EU-Ebene und Anpassungen auf nationaler Ebene.
- Die Anwendung der Europäisierungsdimensionen auf die Beziehungen zwischen der EU und der Ukraine durch eine qualitative Analyse.
- Die Chancen und Perspektiven eines möglichen EU-Beitritts für die Ukraine und die EU.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt die Relevanz der Beziehungen zwischen der EU und der Ukraine im Jahr 2019 heraus und skizziert die Forschungsfrage: Bewegt sich die Ukraine in Richtung EU? Die Einleitung erläutert den Aufbau der Arbeit und stellt die wichtigsten Methoden der Analyse vor, darunter die qualitative Analyse der Europäisierungsdimensionen.
2. Hauptteil
2.1 Theorie: Europäisierung
Dieser Abschnitt untersucht den Begriff der Europäisierung und beleuchtet verschiedene Definitionen und Abgrenzungsversuche, insbesondere in Bezug auf die EU und den europäischen Kontinent. Es werden verschiedene Theorien und Modelle vorgestellt, um den Begriff der Europäisierung zu verstehen und zu differenzieren, darunter das Misfit-Modell.
2.1.1 Definition
Hier werden verschiedene Definitionen des Begriffs Europäisierung vorgestellt und diskutiert, wobei die multidimensionalen Aspekte des Prozesses hervorgehoben werden, die von der Konstruktion und Verbreitung von Normen bis zur Anpassung an EU-Standards reichen.
2.1.2 Politische Dimensionen
Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die politischen Dimensionen der Europäisierung und beleuchtet wichtige Bereiche wie Modernisierungsprozesse, Politikentwicklung auf EU-Ebene und Anpassungen auf nationaler Ebene. Beispiele aus der EU-Politik und ihre Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen der EU und anderen Staaten werden diskutiert.
2.2 Empirie: qualitative Analyse der Europäisierungsdimensionen
Dieser Abschnitt wendet die zuvor beschriebenen Europäisierungsdimensionen auf die Beziehungen zwischen der EU und der Ukraine seit 1991 an. Mithilfe einer qualitativen Analyse werden die Auswirkungen von Kooperationsmaßnahmen, die Politikentwicklung auf EU-Ebene und die Anpassungen auf nationaler Ebene in der Ukraine untersucht.
3. Fazit
Dieser Abschnitt enthält die Beantwortung der Forschungsfrage und einen Ausblick auf die Chancen und Perspektiven eines möglichen EU-Beitritts für die Ukraine und die EU.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Europäisierung, EU-Ukraine Beziehungen, qualitative Analyse, politische Dimensionen, Modernisierungsprozesse, Politikentwicklung auf EU-Ebene, Anpassungen auf nationaler Ebene, EU-Beitritt, Chancen und Perspektiven.
Häufig gestellte Fragen
Womit beschäftigt sich diese Arbeit im Kern?
Die Arbeit analysiert das Verhältnis zwischen der EU und der Ukraine seit 1991 und untersucht, ob und wie sich die Ukraine in Richtung einer EU-Mitgliedschaft bewegt.
Was versteht man unter dem Begriff „Europäisierung“?
Europäisierung wird als Prozess definiert, bei dem Normen, Standards und Politiken der EU auf nationaler Ebene (hier die Ukraine) übernommen und angepasst werden.
Welcher Zeitraum wird in der Analyse berücksichtigt?
Die Untersuchung umfasst den Zeitraum von der Unabhängigkeit der Ukraine 1991 bis zum Stichtag am 30. März 2019.
Welche Rolle spielt die Theorie des „Misfit-Modells“?
Es dient dazu, die Diskrepanz zwischen EU-Vorgaben und nationalen Gegebenheiten zu messen, um den notwendigen Anpassungsbedarf der Ukraine aufzuzeigen.
Welche Perspektiven bietet ein möglicher EU-Beitritt der Ukraine?
Ein Beitritt bietet Chancen für Modernisierungsprozesse in der Ukraine und neue strategische Perspektiven für die politische Entwicklung der gesamten Europäischen Union.
- Citar trabajo
- Justin Treutlein (Autor), 2019, Bewegt sich die Ukraine zur Europäischen Union?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/538784