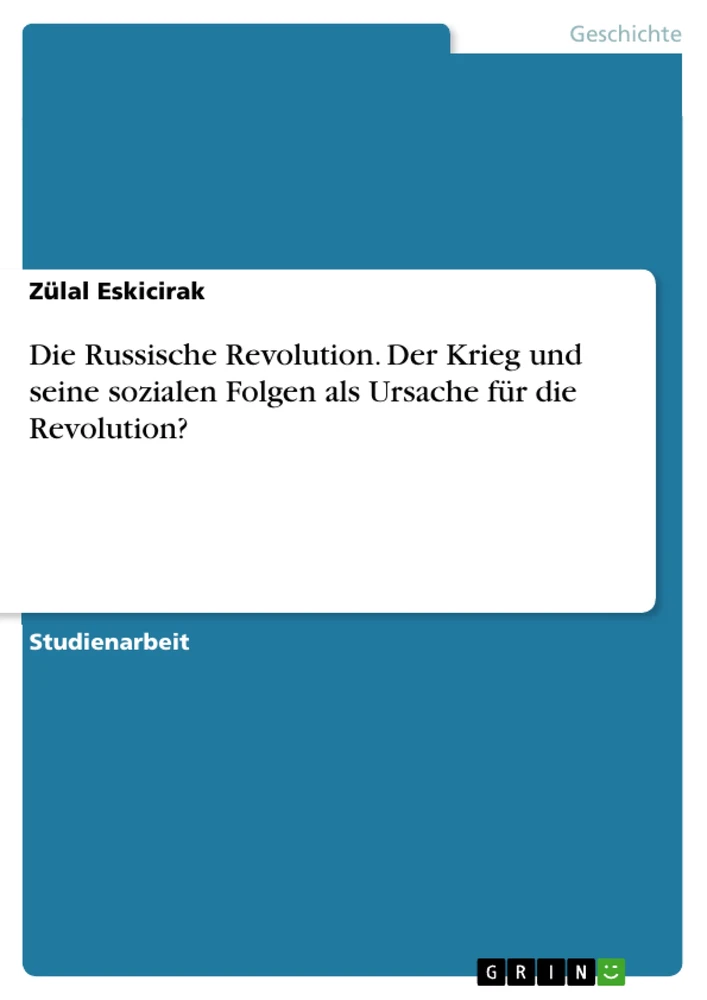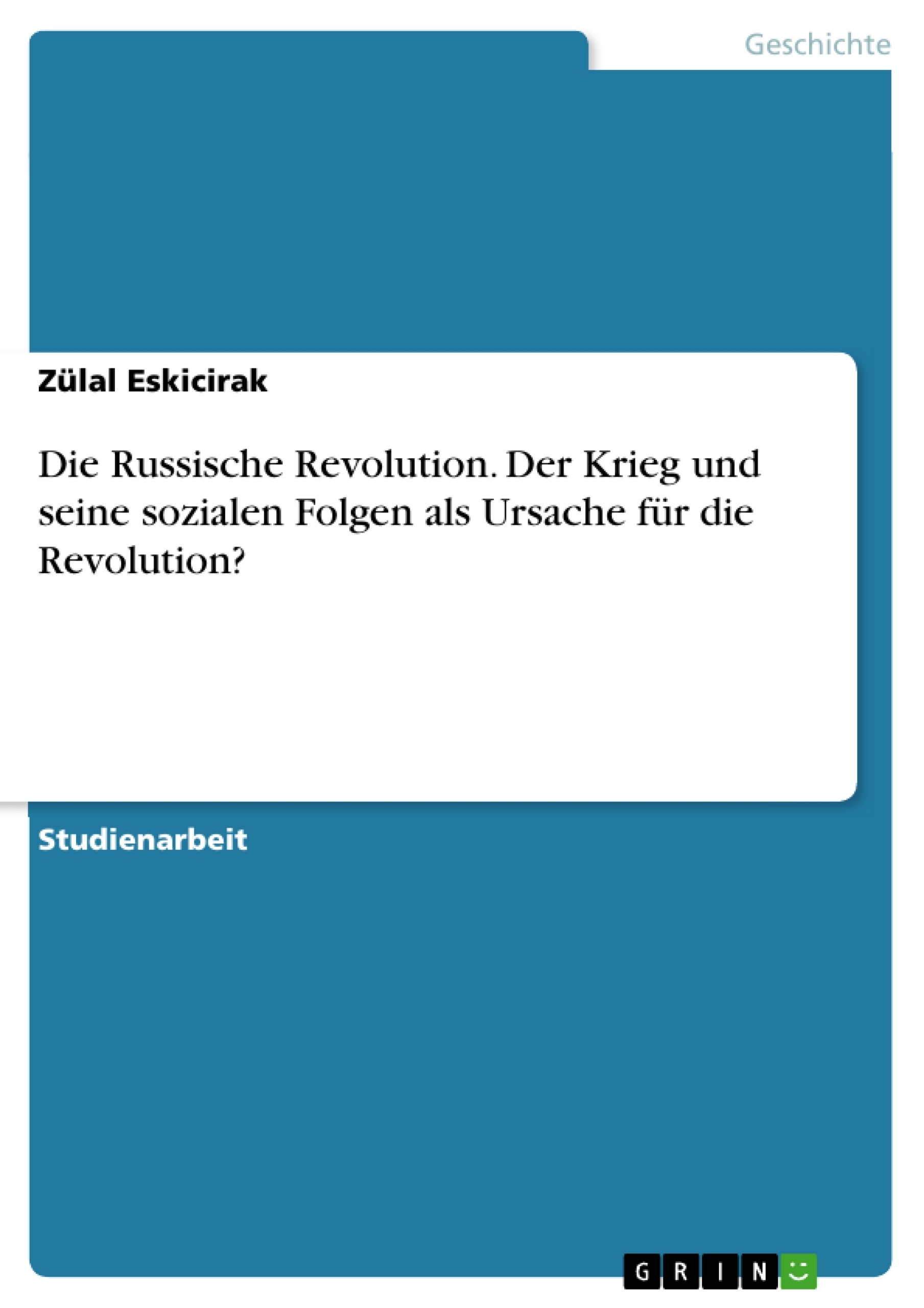Diese Arbeit thematisiert die Russische Revolution und beschäftigt sich mit folgender Frage: Kann der Krieg und seine sozialen Folgen als Ursache oder Anstoß für die Revolution gesehen werden? Die Russische Revolution im Februar 1917 ist eine Revolution der Hauptstadt. Im Verlauf der Auflehnung bis hin zur Revolution schließen sich Moskau und alle anderen Städte des Reiches an; allen voran auch die Front. Binnen weniger Tage bricht das ganze zaristische System zusammen. Am zweiten März 1917 dankt der Zar Nikolaus II. ab. Russland befindet sich seit 1914 im Ersten Weltkrieg mit Deutschland und Österreich. In dieser Zeit erleidet Russland an der Front immer wieder verlustreiche Niederlagen, wodurch die Stimmung im Reich kippt und die Missstände im Land zu einem großen Problem für das Regime werden.
In der nachfolgenden Arbeit werde ich die politische und wirtschaftliche Ausgangssituation bedingt durch den Krieg schildern. In diesem Kapitel wird neben der finanziellen Lage des Reiches und seine Folgen für die Gesellschaft auf die Versorgungskrise und die immer schlechter werdenden städtischen Lebens- und Arbeitsbedingungen eingegangen. Als Nächstes werde ich auf die Ereignisse in der Zeitspanne vom 23. bis 26. Februar eingehen und somit den Verlauf der Volkserhebung veranschaulichen. Daraufhin werde ich in dem letzten Kapitel den Wendepunkt der Geschehnisse und somit den Umschwung zur Revolution darlegen.
Um meine Frage beantworten zu können, dienen mir vor allem das Werk von Helmut Altrichter "Russland 1917. Ein Land auf der Suche nach sich selbst", Orlando Figes "Die Tragödie eines Volkes - Die Epoche der russischen Revolution 1891 bis 1924" und Manfred Hildermeier "Die Russische Revolution 1905–1921" als geeignete Nachschlagewerke, um die tatsächliche Ursache oder den Anstoß benennen zu können. Augenzeugenberichte und Telegramme aus dem Buch "Die Russische Revolution in Augenzeugenberichten", herausgegeben von Richard Kohn, helfen mir dabei eine detailliertere Sicht auf die Geschehnisse zu bekommen und dienen somit als historisch fundierte Untermalung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die politische und wirtschaftliche Ausgangssituation
- Die Volkserhebung
- Der Wendepunkt: Der Beginn der Revolution
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ursachen der Russischen Revolution von 1917. Die zentrale Fragestellung lautet: Kann der Krieg und seine sozialen Folgen als Ursache oder Anstoß für die Revolution gesehen werden? Die Arbeit analysiert die politische und wirtschaftliche Situation vor der Revolution, den Verlauf der Volkserhebung und den Wendepunkt, der zum Ausbruch der Revolution führte.
- Die politische und wirtschaftliche Situation Russlands im Ersten Weltkrieg
- Die Auswirkungen des Krieges auf die Versorgung der Bevölkerung
- Die sozialen und ökonomischen Folgen der Kriegsführung
- Der Verlauf der Volkserhebung im Februar 1917
- Der Übergang von der Volkserhebung zur Revolution
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Einfluss des Ersten Weltkriegs und seiner sozialen Folgen auf den Ausbruch der Russischen Revolution. Sie gibt einen kurzen Überblick über den Verlauf der Revolution und kündigt die Struktur der Arbeit an, die die politische und wirtschaftliche Ausgangssituation, die Volkserhebung und den Wendepunkt zur Revolution behandelt.
Die politische und wirtschaftliche Ausgangssituation: Dieses Kapitel beschreibt die desaströse Lage Russlands im dritten Kriegsjahr. Die anhaltenden militärischen Niederlagen, verbunden mit einer katastrophalen Wirtschaftslage, führen zu einer verheerenden Inflation und einer Versorgungskrise. Die Umstrukturierung der Industrie auf Kriegsproduktion führt zu Knappheit an Konsumgütern, steigenden Preisen und sinkenden Reallöhnen. Die Bevölkerung, insbesondere in den Städten, leidet unter extremen Arbeitsbedingungen, Mangelernährung und hoher Arbeitsbelastung. Der Zusammenbruch der Infrastruktur verschärft die Versorgungsprobleme zusätzlich. Der Krieg beansprucht die männliche Bevölkerung für die Armee, was zu Arbeitskräftemangel in Landwirtschaft und Industrie führt und die Frauen und Kinder zusätzlich belastet.
Schlüsselwörter
Russische Revolution, Erster Weltkrieg, Versorgungskrise, Inflation, soziale Unruhen, Volkserhebung, Zarenreich, politische und wirtschaftliche Ausgangssituation, Arbeitsbedingungen, Kriegsfolgen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Russischen Revolution
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Ursachen der Russischen Revolution von 1917, insbesondere die Rolle des Ersten Weltkriegs und seiner sozialen Folgen als Auslöser oder Anstoß für den Revolutionsausbruch.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Frage lautet: Kann der Krieg und seine sozialen Folgen als Ursache oder Anstoß für die Revolution gesehen werden?
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit analysiert die politische und wirtschaftliche Situation vor der Revolution, den Verlauf der Volkserhebung und den Wendepunkt, der zum Ausbruch der Revolution führte. Konkret werden die politische und wirtschaftliche Situation Russlands im Ersten Weltkrieg, die Auswirkungen des Krieges auf die Versorgung der Bevölkerung, die sozialen und ökonomischen Folgen der Kriegsführung, der Verlauf der Volkserhebung im Februar 1917 und der Übergang von der Volkserhebung zur Revolution untersucht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zur politischen und wirtschaftlichen Ausgangssituation, zur Volkserhebung, zum Wendepunkt (Beginn der Revolution) und ein Fazit. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und gibt einen Überblick über die Struktur. Jedes Kapitel behandelt einen Aspekt der genannten Themen.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird gegeben?
Die Zusammenfassung beschreibt die Einleitung als Einführung der Forschungsfrage und des Inhalts. Das Kapitel zur politischen und wirtschaftlichen Ausgangssituation beschreibt die katastrophale Lage Russlands im dritten Kriegsjahr mit militärischen Niederlagen, katastrophaler Wirtschaftslage, Inflation, Versorgungskrise, Knappheit an Konsumgütern, steigenden Preisen, sinkenden Reallöhnen, extremen Arbeitsbedingungen, Mangelernährung und dem Zusammenbruch der Infrastruktur. Weitere Kapitelzusammenfassungen sind im bereitgestellten HTML-Code enthalten.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Russische Revolution, Erster Weltkrieg, Versorgungskrise, Inflation, soziale Unruhen, Volkserhebung, Zarenreich, politische und wirtschaftliche Ausgangssituation, Arbeitsbedingungen, Kriegsfolgen.
Was ist der Zweck des bereitgestellten Inhaltsverzeichnisses?
Das Inhaltsverzeichnis bietet einen strukturierten Überblick über die einzelnen Kapitel der Arbeit und erleichtert die Navigation durch den Text.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Der Text ist für akademische Zwecke bestimmt und dient der Analyse der Ursachen der Russischen Revolution.
- Arbeit zitieren
- Zülal Eskicirak (Autor:in), 2020, Die Russische Revolution. Der Krieg und seine sozialen Folgen als Ursache für die Revolution?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/538825