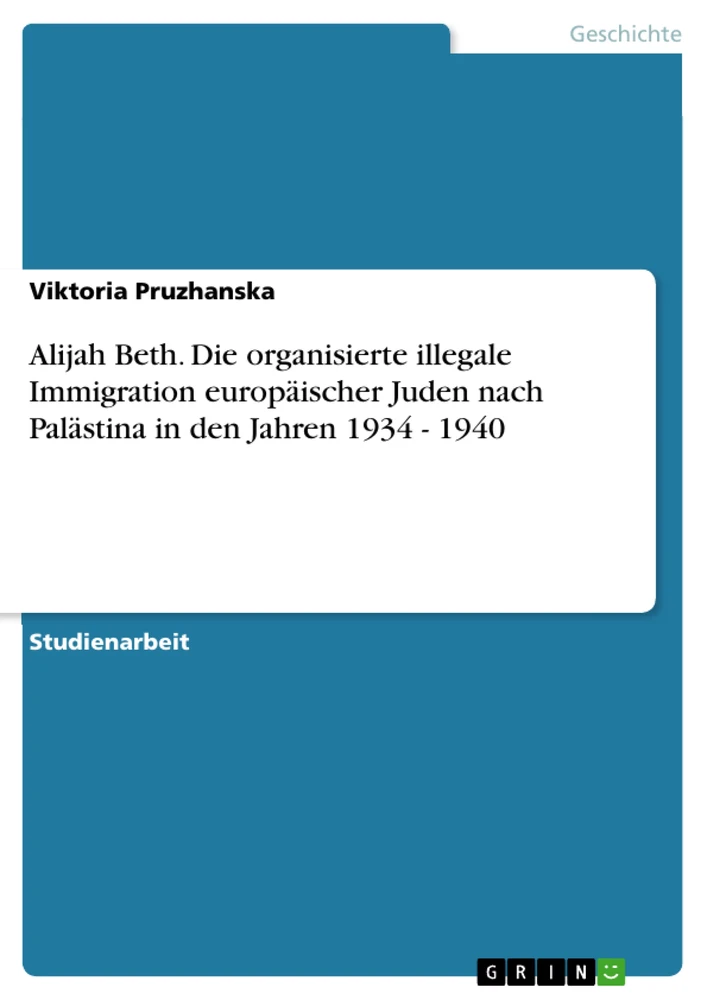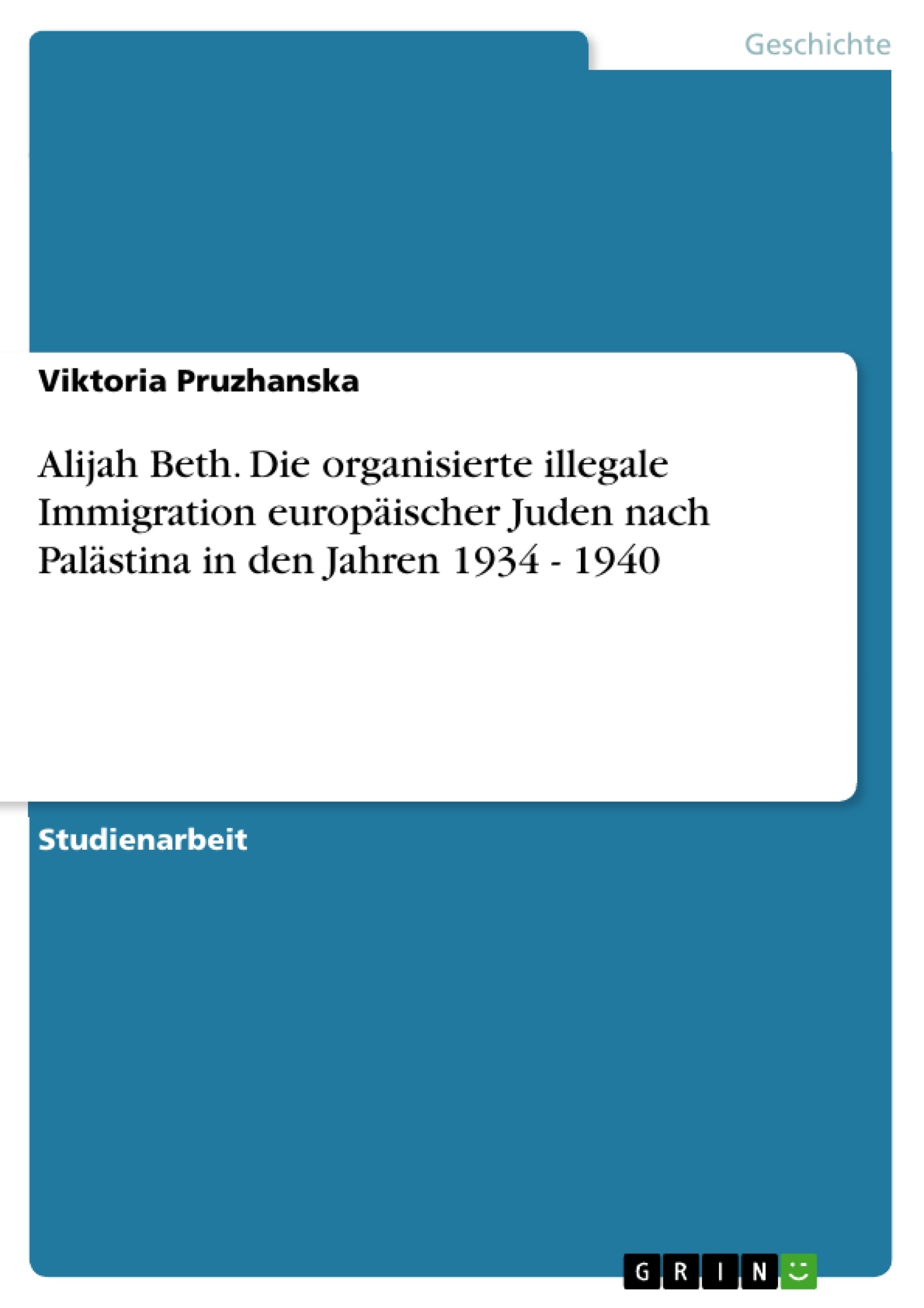Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der organisierten illegalen jüdischen Immigration nach Palästina, der sog. Alijah Beth, in den Jahren 1934-1940 unter dem Gesichtspunkt der Einwanderungseinschränkungen der britischen Regierung einerseits und dem Druck der nationalsozialistischen Verfolgung andererseits. Zur aktuellen Literatur gehören: das Werk von Artur Patek "Jews on Route to Palestine 1934-1944", wo auf breiterer Quellenbasis das Geschichtsgeschehen um illegale Immigration dieser Jahre analysiert wird und V. Kumar "Land der Verheißung - Ort der Zuflucht", das darstellt, welche Rolle die Alijah Beth für die Rettung österreichischer Juden spielte und auch "Die illegale Einwanderung nach Palästina" von W. Benz, welches die illegale Einwanderung mit dem Blick auf die individuelle Dimension der Flucht thematisiert.
Das Thema der organisierten illegalen jüdischen Immigration nach Palästina interessiert mich als eine der interessantesten und eindrucksvollsten Unternehmungen der jüdischen Gemeinschaft zu Erlangung der Freiheit und Unabhängigkeit. Ich versuche folgende Fragen zu beantworten: Was genau war die organisierte illegale Immigration? Welche Faktoren diese Bewegung bestimmten und beeinflussten? Und welche Motive die beteiligten Akteure antrieben?
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Vorgeschichte
- I. Europäische Juden
- II. Palästina der Mandatszeit
- 1. Einwanderungspolitik von Großbritannien
- 2. Arabische Proteste
- 3. Einwanderungspolitik des Yeshuvs
- C. Alijah Beth
- I. Flüchtlinge
- II. Organisatoren
- 1. Revisionisten-Zionisten und die ersten Transporte
- 2. Mossad le Alijah Beth
- 3. Af-Al-Pi und Willy Perl
- III. Kooperation mit dem NS-Regime und Berthold Storfer
- D. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die organisierte illegale jüdische Einwanderung nach Palästina in den Jahren 1934 bis 1940, die als Alijah Beth bekannt ist. Die Arbeit analysiert die komplexe Situation, die durch die Einwanderungseinschränkungen der britischen Mandatsregierung einerseits und den Druck der nationalsozialistischen Verfolgung andererseits geprägt war.
- Die Ursachen und Hintergründe der organisierten illegalen Einwanderung.
- Die Rolle der britischen Mandatspolitik und der arabischen Proteste.
- Die verschiedenen Akteure und Organisationsstrukturen der Alijah Beth.
- Die Motive der beteiligten Personen und ihre Ziele.
- Die Herausforderungen und Konflikte, die mit der illegalen Einwanderung verbunden waren.
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung
Die Einleitung stellt das Thema der Hausarbeit vor und gibt einen Überblick über die bestehende Forschungsliteratur zur Alijah Beth.
B. Vorgeschichte
Dieses Kapitel beleuchtet die historischen und politischen Rahmenbedingungen, die zur Entwicklung der Alijah Beth führten. Hier werden die Situation der europäischen Juden, die politische Lage in Palästina und die Einwanderungspolitik Großbritanniens behandelt.
C. Alijah Beth
Das Kernstück der Hausarbeit liegt in der Analyse der Alijah Beth selbst. Es werden die Flüchtlinge, die Organisatoren der illegalen Einwanderung und die Kooperation mit dem NS-Regime näher betrachtet.
Schlüsselwörter
Alijah Beth, illegale Einwanderung, jüdische Immigration, Palästina, Britische Mandatspolitik, nationalsozialistische Verfolgung, Revisionisten-Zionismus, Flüchtlinge, Organisationen, Kooperation, NS-Regime.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff „Alijah Beth“?
Alijah Beth bezeichnet die organisierte illegale Einwanderung von Juden nach Palästina während der britischen Mandatszeit, insbesondere zwischen 1934 und 1940.
Warum war diese Einwanderung illegal?
Die britische Mandatsregierung schränkte die jüdische Einwanderung aufgrund arabischer Proteste und politischer Erwägungen massiv ein, woraufhin die jüdische Gemeinschaft illegale Wege (ohne Zertifikate) organisierte.
Welche Organisationen steckten hinter der Alijah Beth?
Wichtige Akteure waren der Mossad le Alijah Beth, revisionistische Zionisten (Af-Al-Pi) und Einzelpersonen wie Willy Perl.
Gab es eine Kooperation mit dem NS-Regime?
Ja, es gab paradoxe Situationen, in denen jüdische Organisatoren wie Berthold Storfer mit NS-Behörden verhandelten, um Juden die Ausreise aus Europa zu ermöglichen, da das Regime sie loswerden wollte.
Welchen Einfluss hatte der Druck der Verfolgung auf die Bewegung?
Die zunehmende Gewalt und Entrechtung in Europa machten die Alijah Beth für viele Juden zur einzigen Überlebenschance, was die Bewegung trotz britischer Blockaden massiv antrieb.
- Citar trabajo
- Viktoria Pruzhanska (Autor), 2020, Alijah Beth. Die organisierte illegale Immigration europäischer Juden nach Palästina in den Jahren 1934 - 1940, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/538851