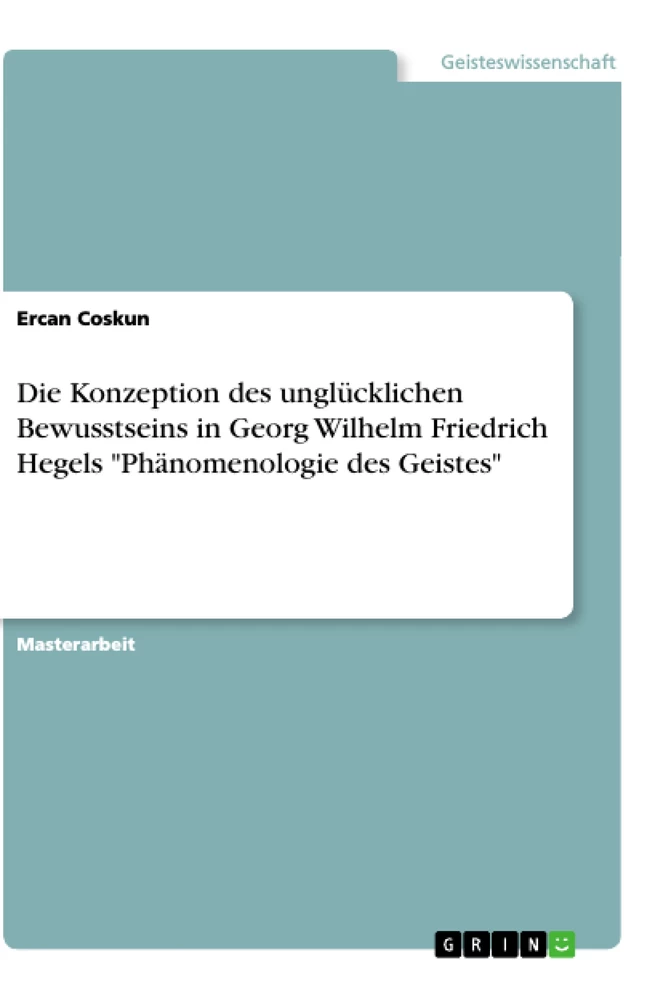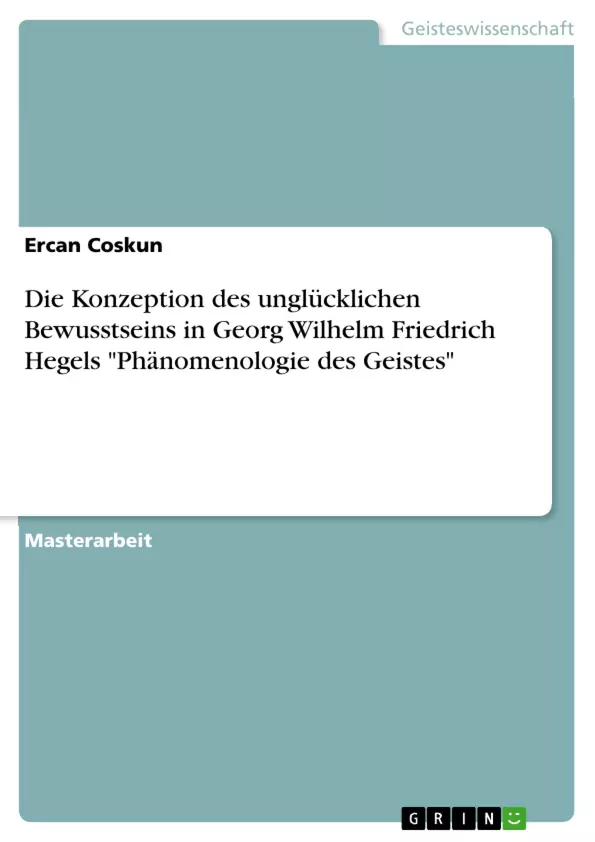Die Arbeit befasst sich mit dem "unglücklichen Bewusstsein" als einer von mehreren Bewusstseinsgestalten in Georg Wilhelm Friedrich Hegels "Phänomenologie des Geistes".
Sie unternimmt dies im Rahmen einer Struktur wie auch einer Vollzugsanalyse. Die Figur des unglücklichen Bewusstseins stellt sich bekanntlich in einer Entzweiung dar: Es ist sowohl allgemeines als auch einzelnes Bewusstsein in einer Selbstbewusstseinseinheit. Die Relation dieser zwei entgegengesetzten Komponenten des Selbstbewusstseins konstituiert näherhin ein Herr-Knecht-Verhältnis, indem das eine – das Einzelne – dem anderen – dem Allgemeinen – unterjocht, die Entgegensetzung der beiden in dieser Koexistenz jedoch nicht aufgehoben, sondern vielmehr befestigt wird.
All diesen Merkmalen nach weist das unglückliche Bewusstsein, wie in dieser Abhandlung vertreten wird, auf zwei Konzeptionen in früheren Abhandlungen Hegels hin: zum einen auf den Mittelbegriff in Hegels Jenaer Logik aus den Jahren 1804/05, zum anderen auf das kantische Sittensubjekt, wie dieses in Hegels Frankfurter Religionsschriften behandelt worden ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Phänomenologie des Geistes
- Spielregeln
- Das Bewusstsein als die sinnliche Gewissheit
- Selbstbewusstsein als Begierde
- Genese des unglücklichen Bewusstseins
- Die Struktur des unglücklichen Bewusstseins
- Das Verhältnis des Denkens im Jenenser Logikentwurf von 1804/05
- Begriff
- Urteil
- Schluss
- Analogie zwischen Logikformen und Bewusstseinsgestalten
- Zerrissenheit des kantischen Sittensubjekts
- Das Verhältnis des Denkens im Jenenser Logikentwurf von 1804/05
- Das Hervortreten des Unwandelbaren
- Die Religiosität des unglücklichen Bewusstseins
- Der knechtische Geist des Judentums
- Jesus als Wesenseinheit
- Das Verhältnis zu dem „gestalteten Unwandelbaren“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das „unglückliche Bewusstsein“ in Hegels Phänomenologie des Geistes mittels Struktur- und Vollzugsanalyse. Sie analysiert die Beziehung zwischen allgemeinem und individuellem Bewusstsein im Rahmen eines Herr-Knecht-Verhältnisses. Die Arbeit vergleicht das unglückliche Bewusstsein mit Konzepten aus Hegels Jenaer Logik und seiner Kritik am kantischen Sittensubjekt.
- Strukturanalyse des unglücklichen Bewusstseins
- Vergleich mit Hegels Jenaer Logik und dem kantischen Sittensubjekt
- Analyse des Herr-Knecht-Verhältnisses im unglücklichen Bewusstsein
- Die Rolle des „Unwandelbaren“ im Bewusstseinsprozess
- Religionsphilosophische Interpretation des unglücklichen Bewusstseins
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit: die Untersuchung des unglücklichen Bewusstseins in Hegels Phänomenologie des Geistes durch Struktur- und Vollzugsanalyse. Es wird die zentrale These vorgestellt, dass das unglückliche Bewusstsein auf Konzeptionen in Hegels Jenaer Logik und seiner Kritik am kantischen Sittensubjekt verweist. Die Arbeit gliedert sich in fünf Abschnitte, die jeweils einen Aspekt dieser These beleuchten.
Phänomenologie des Geistes: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über Hegels Phänomenologie des Geistes, insbesondere über die Spielregeln und die Konzeption von Bewusstsein und Selbstbewusstsein. Es beschreibt die Genese des unglücklichen Bewusstseins aus vorangehenden Bewusstseinsgestalten wie Stoizismus und Skeptizismus. Die Darstellung der "Spielregeln" legt den Grundstein für das Verständnis des gesamten Systems, das als einen notwendigen und vollständigen Bildungsprozess des Bewusstseins dargestellt wird, der von der sinnlichen Gewissheit bis zum absoluten Wissen führt.
Die Struktur des unglücklichen Bewusstseins: Dieser Abschnitt vergleicht die Struktur des unglücklichen Bewusstseins mit Hegels Jenaer Logik (insbesondere den Begriffen Begriff, Urteil und Schluss) und Kants Sittensubjekt. Die Analogie zwischen den logischen Kategorien und den Bewusstseinsgestalten wird untersucht, ebenso wie die Zerrissenheit des kantischen Sittensubjekts zwischen allgemeinem Pflichtgebot und sinnlichen Neigungen. Der Vergleich hebt die strukturelle Ähnlichkeit zwischen beiden hervor, insbesondere das immanente Herr-Knecht-Verhältnis.
Das Hervortreten des Unwandelbaren: Dieses Kapitel behandelt den Wissensvollzug in der Phänomenologie, der mit dem Hervortreten des Unwandelbaren endet. Die Aufspaltung zwischen Essenz und Existenz wird im Kontext des Versuchs des unglücklichen Bewusstseins, innere Versöhnung zu erreichen, analysiert. Der Versuch, eine Komponente zu verabsolutieren und die andere zu vernichten, führt zu einem neuen Herr-Knecht-Verhältnis zwischen dem Bewusstsein und dem Unwandelbaren.
Die Religiosität des unglücklichen Bewusstseins: Dieser Abschnitt befasst sich mit der religionsphilosophischen Deutung des unglücklichen Bewusstseins, insbesondere mit dem Übergang vom jüdischen Geist zum frühen Christentum. Die Interpretation des Unwandelbaren als Gott im jüdischen bzw. frühchristlichen Geist wird untersucht. Der Übergang wird als Gestaltung des Unwandelbaren interpretiert.
Schlüsselwörter
Unglückliches Bewusstsein, Hegel, Phänomenologie des Geistes, Jenaer Logik, Kantisches Sittensubjekt, Herr-Knecht-Verhältnis, Strukturanalyse, Vollzugsanalyse, Unwandelbares, Religionsphilosophie, Selbstbewusstsein.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu Hegel's "Unglückliches Bewusstsein"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Hegels Konzept des „unglücklichen Bewusstseins“ in der Phänomenologie des Geistes. Sie untersucht dessen Struktur und Vollzug, den Zusammenhang zwischen individuellem und allgemeinem Bewusstsein im Kontext des Herr-Knecht-Verhältnisses und vergleicht es mit Konzepten aus Hegels Jenaer Logik und seiner Kritik am kantischen Sittensubjekt.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine Struktur- und Vollzugsanalyse des unglücklichen Bewusstseins. Sie vergleicht die Struktur des unglücklichen Bewusstseins mit Hegels Jenaer Logik und Kants Sittensubjekt und analysiert das Herr-Knecht-Verhältnis im Bewusstseinsprozess.
Welche Aspekte des unglücklichen Bewusstseins werden untersucht?
Die Analyse umfasst die Genese des unglücklichen Bewusstseins aus vorhergehenden Bewusstseinsformen (Stoizismus, Skeptizismus), die Struktur des unglücklichen Bewusstseins im Vergleich zur Jenaer Logik (Begriff, Urteil, Schluss), die Zerrissenheit des kantischen Sittensubjekts, die Rolle des „Unwandelbaren“ im Bewusstseinsprozess und eine religionsphilosophische Interpretation, insbesondere den Bezug zum Judentum und frühen Christentum.
Wie wird das unglückliche Bewusstsein mit der Jenaer Logik in Verbindung gebracht?
Die Arbeit zieht Parallelen zwischen den logischen Kategorien (Begriff, Urteil, Schluss) der Jenaer Logik und den Bewusstseinsgestalten in der Phänomenologie des Geistes. Sie untersucht die Analogie zwischen den logischen Formen und den Bewusstseinsstrukturen, um die innere Logik des unglücklichen Bewusstseins zu verstehen.
Welche Rolle spielt das kantische Sittensubjekt?
Das kantische Sittensubjekt wird als Vergleichspunkt für das unglückliche Bewusstsein herangezogen. Die Arbeit analysiert die Zerrissenheit des kantischen Sittensubjekts zwischen allgemeinem Pflichtgebot und sinnlichen Neigungen und vergleicht diese mit der inneren Zerrissenheit des unglücklichen Bewusstseins.
Was ist die Bedeutung des „Unwandelbaren“?
Das „Unwandelbare“ ist ein zentraler Begriff, der im Zusammenhang mit dem Wissensvollzug und dem Versuch des unglücklichen Bewusstseins, innere Versöhnung zu erreichen, untersucht wird. Es wird analysiert, wie der Versuch, das Unwandelbare zu verabsolutieren, zu einem neuen Herr-Knecht-Verhältnis führt.
Wie wird das unglückliche Bewusstsein religionsphilosophisch interpretiert?
Die religionsphilosophische Interpretation fokussiert auf den Übergang vom jüdischen Geist zum frühen Christentum. Das „Unwandelbare“ wird als Gott interpretiert und der Übergang als ein Prozess der Gestaltung des Unwandelbaren verstanden.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Unglückliches Bewusstsein, Hegel, Phänomenologie des Geistes, Jenaer Logik, Kantisches Sittensubjekt, Herr-Knecht-Verhältnis, Strukturanalyse, Vollzugsanalyse, Unwandelbares, Religionsphilosophie, Selbstbewusstsein.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur Phänomenologie des Geistes, zur Struktur des unglücklichen Bewusstseins, zum Hervortreten des Unwandelbaren, zur Religiosität des unglücklichen Bewusstseins und ein Fazit. Jedes Kapitel beleuchtet einen Aspekt des unglücklichen Bewusstseins.
- Arbeit zitieren
- Ercan Coskun (Autor:in), 2019, Die Konzeption des unglücklichen Bewusstseins in Georg Wilhelm Friedrich Hegels "Phänomenologie des Geistes", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/539046